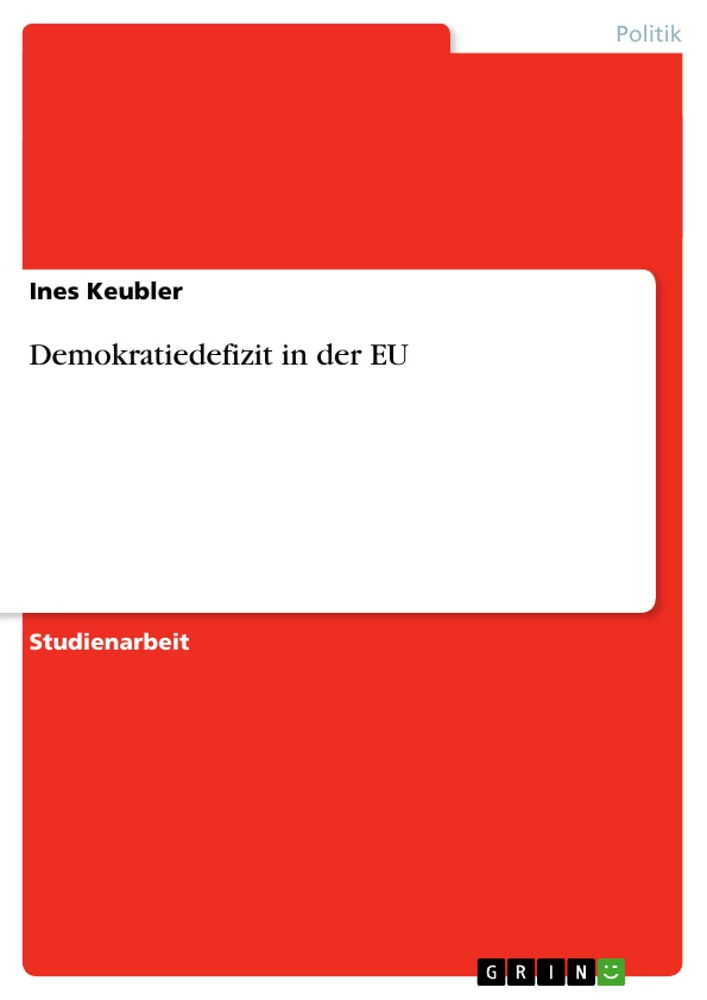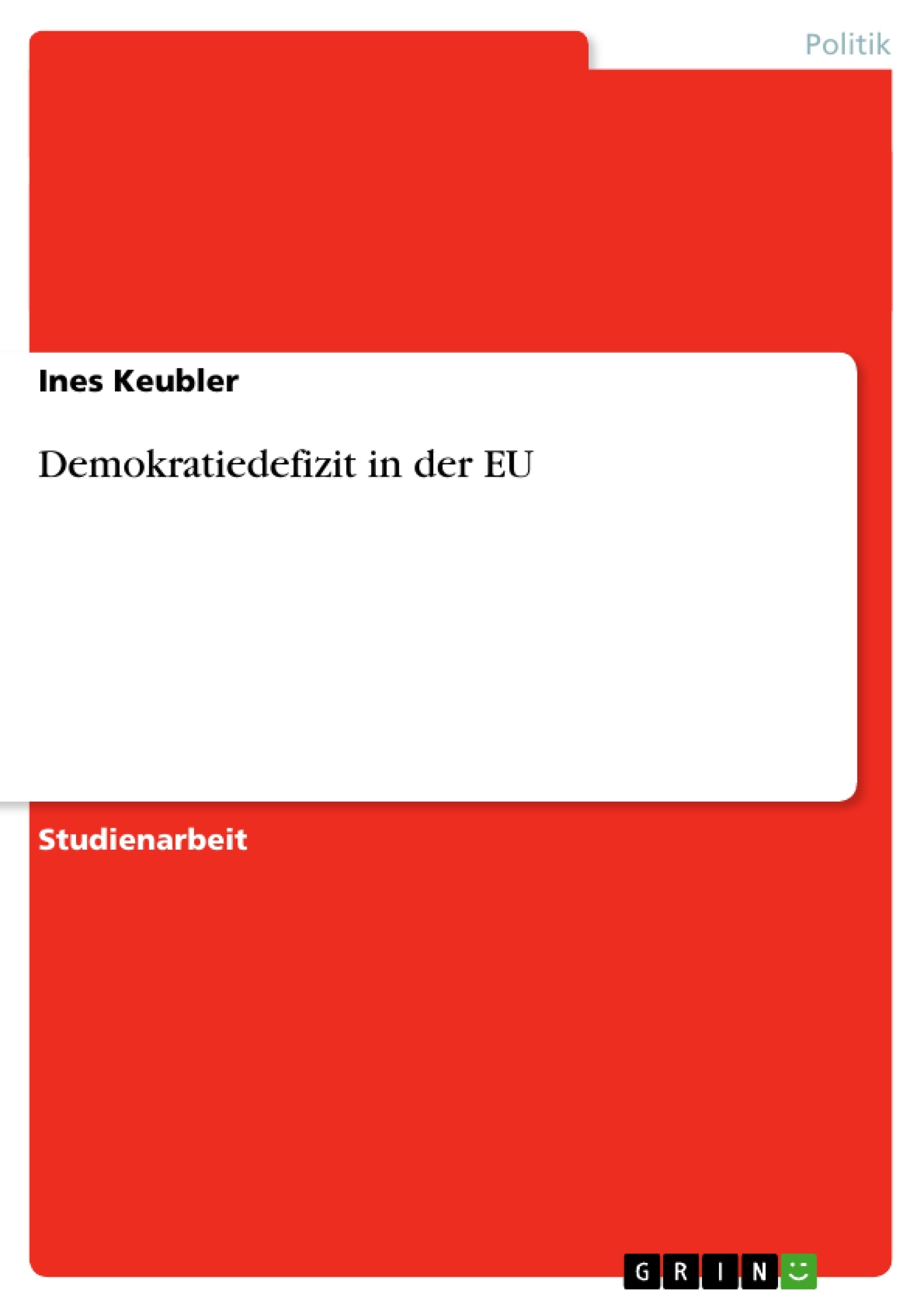Gliederung
Einleitung
Hauptteil
1. Was ist ein Weißbuch ?
2. Warum eine Reform europäischen Regierens ?
3. Grundsätze des guten Regierens
3.1 Offenheit
3.2 Partizipation
3.3 Verantwortlichkeit
3.4 Effektivität
3.5 Kohärenz
4. Vorschläge für einen Wandel
4.1 Bessere Einbindung aller Akteure und größere Offenheit
4.2 Eine bessere Politik, bessere Regeln und bessere Ergebnisse
4.3 Der Beitrag der EU zur Global Governance
4.4 Neuausrichtung der Politikfelder und Institutionen
Schluss - Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Einleitung
„Europäische Gemeinschaft, Brüssel (...), was interessiert mich das schon. Das kann man ja nicht durchschauen, was da so läuft. (...) Also, über was die überhaupt reden. Da kommt viel zu wenig rüber (...) Mich würde viel mehr interessieren, was es für den kleinen Mann bringt, in Deutschland oder anderswo.“1
Diese Aussage bringt auf den Punkt, was viele Bürger der Europäischen Union - von Stockholm bis Rom, von Lissabon bis Berlin - bewegt. Die Vorstellung einer zentralistischen und bürgerfernen Superbürokratie „Brüssel“, die sich im Regelungseifer und der Undurchsichtigkeit ihrer Entscheidungsprozesse zu verlieren scheint, zeigt sich in dem geringen Vertrauen, das die zur Zeit rund 376 Millionen Bürger der fünfzehn EU - Mitgliedstaaten der Politik auf europäischer Ebene entgegenbringen.2Um dieses negative Bild, in der die Konsenssuche hinter verschlossenen Türen und vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen stattfindet, zu entkräften, wurde am 25. Juli 2001 das „Weißbuch: Europäisches Regieren“3veröffentlicht, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Schritte für eine mögliche Vertiefung der Demokratie in der EU aufzuzeigen.
Diese Hausarbeit hat zum Ziel, einen genaueren Blick auf dieses Weißbuch und die Gründe seiner Entstehung - Schlagwort: Demokratiedefizit - zu werfen. Bei der Gliederung der vorliegenden Arbeit habe ich mich an der des Weißbuches orientiert, stelle aber eine Erläuterung zur Frage „Was ist ein Weißbuch ?“ voran. Anschließend werde ich mich mit den Ursachen beschäftigen, die eine Reform europäischen Regierens notwendig machen. Über die Grundsätze des guten Regierens führt der Weg dann zum wichtigsten Teil des Weißbuches, den Vorschlägen für einen Wandel. Der Schluss wird aus einem Fazit und Ausblick bestehen.
Hauptteil
1. Was ist ein Weißbuch ?
„Die Kommission hat ein Weißbuch verabschiedet zur ...“. So oder ähnlich beginnen Meldungen, die man ab und zu in Tageszeitungen lesen kann. Was aber ist ein Weißbuch ? Eine erste Antwort erhält man durch den Blick ins Lexikon4, wobei man hier vom Suchbegriff „Weißbuch“ auf den Begriff „Farbbücher“ verwiesen wird. Zu lesen steht folgendes: „Farbbücher,Buntbücher(urspr. engl. Brauch), d. Veröffentlichung diplomat. Akten in farbigem Umschlag (z.B.Weißbuchi. Dtld s. 1879,Blaubuchi. England,Rotbuchi. Östr. u. den USA,Gelbbuchin Frkr.,Grünbuchi. Italien).
Ein englischsprachiges Lexikon5, um den ursprünglich englischen Brauch zu untermauern, beschreibt ein „white paper“ als „report issued by the government to give information“.
In der EU gibt es bisher keine Regierung im engeren Sinne. Die Kommission, die als Hüterin der Verträge und Verkörperung des Gemeinschaftsinteresses von vielen als eine Art europäischer Regierung angesehen wird, versteht sich jedoch nicht nur als „Motor der Integration“, sie ist auch mit dem Initiativrecht ausgestattet, d.h. dem Recht, für die Bereiche gemeinschaftlicher Politik Gesetzentwürfe vorzulegen. So ist es auch die Kommission, die in der EU Grünbücher und Weißbücher, auch Konsultationsdokumente genannt, verfasst. Die Kommission beschreibt Grün - und Weißbücher wie folgt6:
„Grünbücher sind von der Kommission veröffentlichte Mitteilungen über einen bestimmten Politikbereich. Sie richten sich vor allem an interessierte Dritte, Organisationen und Einzelpersonen, die dadurch die Möglichkeit erhalten, an der Konsultation und Beratung teilzunehmen. In einigen Fällen ergeben sich daraus legistische Maßnahmen.
Weißbücher enthalten Vorschläge für ein Tätigwerden der Gemeinschaft in einem bestimmten Bereich. Sie folgen oft auf Grünbücher, die veröffentlicht werden, um einen Konsultationsprozess auf europäischer Ebene einzuleiten. Während in Grünbüchern eine breite Palette von Ideen präsentiert und zur öffentlichen Diskussion gestellt wird, enthalten Weißbücher förmliche Vorschläge für bestimmte Politikbereiche und dienen dazu, diese Bereiche zu entwickeln."
Grün - und Weißbücher sind nicht als Rechtsakte, sondern vielmehr als Diskussionsgrundlage zu verstehen. Als Beispiele für Grünbücher sollen das „Grünbuch zur europäischen Dimension des Bildungswesens7 und das „Grünbuch zum Verbraucherschutz in der Europäischen Union“8 genannt sein. Das wohl berühmteste Weißbuch ist jenes zum europäischen Binnenmarkt9, in dem der Weg zur Vollendung des Binnenmarktes vorgezeichnet worden ist. Das in der Einleitung bereits erwähnte „Weißbuch: Europäisches Regieren“ liegt dieser Hausarbeit zugrunde.10
2. Warum eine Reform europäischen Regierens ?
Die europäische Einigung hat vor über fünfzig Jahren zunächst mit sechs Staaten11begonnen. Seitdem sichert sie uns Frieden, Freiheit und Wohlstand.12Man hat dieses Einigungswerk oft mit dem Bau eines Hauses verglichen, obgleich dies zum Teil irreführend ist. Baut man ein Haus, so muss es in allen Einzelheiten geplant und entworfen sein, bevor man mit dem Bau beginnt. Das „Haus Europa“ aber war nur eine Vision, als man begann, seine Fundamente zu gießen. Man wusste nicht, ob und wann das Haus fertiggestellt sein könnte. Schon 1946 sprach Winston Churchill, damals in der Rolle des britischen Oppositionsführers, in seiner Rede von Zürich davon , „etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa“13zu schaffen. Doch erschien ein freiwilliger Zusammenschluss von Staaten früher unvorstellbar, da sie teilweise aufgeben mussten, was ihnen als unverzichtbar und als Zeichen ihrer Ehre gilt: ihre
Souveränität. Während dies für Deutschland im Grundgesetz festgeschrieben und wenig kompliziert ist14, erscheint es vielmehr für zukünftige Mitgliedstaaten (zum Beispiel Polen) als Problem, da diese sich erst seit wenigen Jahren ihrer Unabhängigkeit erfreuen können.
Souveränität bedeutet uneingeschränkte und ungeteilte Macht - Macht, die zum Ausbruch zweier verheerender Weltkriege geführt hatte. Um diesem vorzubeugen, musste etwas Neues entstehen, musste man etwas Neues versuchen: Nur auf dem Wege des Versuchs konnte die freiwillige Einigung in Europa vorangetrieben werden, durch Experimente, die man jederzeit korrigieren, schlimmstenfalls abbrechen konnte. Deshalb wurde in den Gründungsverträgen der EG in den fünfziger Jahren zwar das endgültige Ziel benannt: ein politisch vereinigtes Europa, man hat sich aber nicht auf eine bestimmte Form dieses Ziels festgelegt. „Europa lässt sich nicht mit einem Schlag herstellen und auch nicht durch eine einfache Zusammenfassung: Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen [...]“15sagte schon der damalige französische Außenminister Robert Schumann am 9. Mai 1950, als er seinen Plan verkündete, Europa friedlich zu einigen. In Maastricht aber ist im Dezember 1991 die Entscheidung über den endgültigen Bauplan gefallen: Aus der bisherigen Gemeinschaft Europäischer Staaten wurde die Europäische Union.
Doch gerade den Beschluss des Maastrichter Vertrages sehen viele Kritiker der Europäischen Union als einen Meilenstein („Katalysator“16) auf dem Weg der in den achtziger Jahren einsetzenden Europamüdigkeit, auch als „Eurosklerose“17bezeichnet. Die Angst vor einer zu großen bürokratischen Zentralisierung in Brüssel und dem Verlust der nationalen Identität18ließ am 2. Juni 1992 eine knappe Mehrheit von 50,7 Prozent der Wahlberechtigten in Dänemark gegen die Beschlüsse von Maastricht votieren, es drohte eine Blockade der darin enthaltenen wichtigen Reformen (zum Beispiel die vertragliche Festschreibung des Subsidiaritätsprinzips oder die Stärkung des Europäischen Parlaments). In Irland fand am 18. Juni 1992 ebenfalls eine Volksabstimmung statt, bei der es zu einer mehrheitlichen Annahme des EU - Vertrages kam. Am 20. September 1992 schließlich folgte das französische Referendum, das mit einer knappen Mehrheit zugunsten der Annahme des Vertragswerkes ausging. Trotz der später durch Zugeständnisse erreichten Umwandlung der dänischen Absage in eine Annahme des Maastrichter Vertrages, führte die „mythologische Undurchschaubarkeit des Vertrages über die Europäische Union“19zu einem verspäteten Inkrafttreten des Vertrages. Auch in Deutschland waren Verfassungsklagen gegen den Vertrag eingereicht worden, die vom Bundesverfassungsgericht zurückgewiesen wurden. Nachdem der Vertrag am 9./10. Dezember 1991 beschlossen und am 7. Februar 1992 unterzeichnet worden war, trat er schließlich am 1. Januar 1993 in Kraft.
Einerseits fühlen sich in den meisten Staaten der fünfzehn Mitgliedstaaten der EU über die Hälfte der Bürger mit Europa verbunden, andererseits fragen sich viele Menschen, ob eine weitere Einigung in der Gemeinschaft überhaupt wünschenswert und nützlich ist. Sie befürchten mit der zunehmenden Integration eine weitere Verlagerung der Ausübung der politischen Macht nach Brüssel, dieser erstarrten Eurokratie, deren Macht niemand mehr kontrollieren kann. Führt eine weitere Einigung nicht zu einem riesigen Zentralstaat Europa, der per Gesetz von Portugal bis Dänemark alles vorschreibt und gleichmacht, von der Apfelgröße bis zum Zollsatz ? Die Masse der Unionsbürger identifiziert sich nach wie vor über ihre nationale und regionale Identität, nicht über die europäische. Daran scheint auch die mit dem Vertrag von Maastricht eingeführte Unionsbürgerschaft20nichts geändert zu haben.
Die deutlichsten Zeichen des in jüngster Zeit sich verstärkenden Desinteresses an Europa waren sicherlich die geringe Wahlbeteiligung bei den Europawahlen vom 13. Juni 1999, bei denen nur 45,2 Prozent der Bürger der EU ihre Stimme abgaben (12. Juni 1994: 60 Prozent). Außerdem hat das irische Nein zum Vertrag von Nizza am 7. Juni 2001 viele Europabefürworter verzweifeln lassen. Bei einer Wahlbeteiligung von 34 Prozent stimmten 54 Prozent gegen den Vertrag. Zahlenfanatiker errechneten sogleich, dass damit nur rund 18 Prozent der wahlberechtigten Iren wirklich mit Nein gestimmt hatten - nicht wirklich repräsentativ. Zumal Stimmen laut wurden, die in der Entscheidung der Iren keine wirkliche Ablehnung des Vertrages entdecken wollten, sondern eher einen Aufschrei, dass es so mit der Politik Europas nicht weitergehen kann. Werden die Einzelstaaten nicht immer mehr entmachtet, welche unabsehbaren Kosten (für die wohlhabenden Staaten) zieht das Einigungswerk nach sich ? Der Umbruch in Europa findet in verschiedenen Geschwindigkeiten auf dem politischen Parkett einerseits und in den Köpfen der Bürger andererseits statt. Geht vielen Menschen die Entwicklung Europas zu rasant voran, erscheint anderen der Prozess der Integration und der Erweiterung zu langsam.
In den Augen der Menschen scheint die Union nicht fähig, anstehende Probleme zu lösen. Die wichtigsten Aufgaben der EU sehen die Bürger im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit (90 Prozent), in der Bewahrung des Friedens und der Sicherheit in Europa (89 Prozent) und der Bekämpfung des organisierten Verbrechens und des Drogenhandels (88 Prozent).21
Andererseits stellt das Weißbuch fest: „Wird die Union tätig, so werden ihr die Erfolge selten als Verdienst angerechnet.“ (9) Die Menschen hängen zu sehr an ihren nationale Regierungen und deren Entscheidungen, denen sie mehr Vertrauen entgegenbringen als der Politik auf europäischer Ebene. Die Segnungen und Erfolge der EU, positive Ergebnisse von Ratsgipfeln oder anderen Treffen werden zur eigenen Profilierung von den Staats - und Regierungschefs gern als nationale Erfolge anstatt als Erfolge für Europa „verkauft“. Und wem werden die Bürger von Deutschland oder Spanien eher glauben: Einem Politiker aus dem eigenen Land oder Repräsentanten, die man nicht mit einer bestimmten Person in Verbindung bringen kann ? Die EU - Kommissare gelten weniger als Fachleute, vielmehr als ineffiziente, im schlimmsten Fall korrupte Bürokraten bzw. „Eurokraten“22.
Indem nationale Politiker selbst über den undurchschaubaren und anonymen Dschungel Brüssels schimpfen, in dem nationale Parlamente zu „gesetzgeberischen Vollzugsautomaten“23degradiert werden und der eine „Spielwiese für Lobbyisten“24ist, wird den Bürgern kaum eine andere Perspektive eröffnet. Fehlt die Vermittlung von Informationen über die Aufgaben der EU, bleibt nicht viel mehr übrig, als in Brüssel immer wieder den Sündenbock für ungewollte Beschlüsse zu sehen, die aber von den Mitgliedstaaten letztendlich gefordert und mitgetragen wurden.
Eines der größten Probleme auf der europäischen Ebene stellt die Vielfalt der Institutionen dar, die für den einzelnen Bürger nicht zu überblicken ist, so dass sehr schnell ein Gefühl der Hilflosigkeit entsteht - nicht zu wissen, wer Entscheidungen trifft, wer für meine Anliegen ein offenes Ohr hat, wer dafür sorgt, dass die „Vielfalt in der Einheit“ erhalten bleibt.
En Weißbuch zum Regieren im Mehrebenensystem der EU war schon zu Beginn der Amtszeit der jetzigen Kommission unter Romano Prodi angekündigt worden. Die Veröffentlichung wurde durch einen aufwendigen Konsultationsprozess vorbereitet, in den Stellungnahmen der Verwaltungen der Mitgliedstaaten, der Regionen, der Politik und der Zivilgesellschaft eingegangen sind. Die Ausarbeitung der Vorschläge des Weißbuches erfolgte durch zwölf dienststellenübergreifende Arbeitsgruppen, die von den am stärksten von den geplanten Änderungen betroffenen Generaldirektionen geleitet wurden.
Die unter dem Begriff Europäisches Regieren bzw. Governane geführte Debatte soll zu einer Änderung der Arbeitsweise bei der Definition europäischer Strategien sowie bei der Realisierung dieser in der EU führen.
„Der Begriff `Governance´ steht für die Regeln, Verfahren und Verhaltensweisen, die die Art und Weise, wie auf europäischer Ebene Befugnisse ausgeübt werden, kennzeichnen, und zwar insbesondere in Bezug auf Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Wirksamkeit und Kohärenz.“ (10) Handelt die Kommission demokratisch ? Wie können die Bürger stärker in die Politikgestaltung einbezogen werden ? Wie kann man eine bessere Identifikation der Menschen mit der EU und deren Vertretern erreichen ? Dies sind Fragen, deren Beantwortung sich das Weißbuch auferlegt hat.
3. Grundsätze des guten Regierens
Dem Weißbuch geht es darum, Veränderungen für eine neue, demokratischere Form der Partnerschaft zwischen den verschiedenen Ebenen von Politik und Verwaltung vorzuschlagen. Diese möglichen Änderungen und das gute Regieren beruhen auf fünf Grundsätzen, die im folgenden vorgestellt werden sollen.
3.1 Offenheit
Nachdem die Kommission Santer im Frühjahr 1999 wegen Unregelmäßigkeiten in einzelnen Ämtern der Kommission geschlossen zurückgetreten war, versucht seit dem 15. September 1999 die Kommission unter Romano Prodi die im Februar 2000 vor dem Europäischen Parlament erklärten vier Schwerpunkte ihres Mandats zu verwirklichen.
Indem die Förderung neuer Formen europäischer „Governance“ eines dieser vier strategischen Ziele darstellt25, weist der Kommissionspräsident auf einen Widerspruch hin: „Die Bürger verlangen, dass Europa mit mehr Stärke und Präsenz handelt, und gleichzeitig äußern sie sich misstrauisch gegenüber den Institutionen.“26 Durch den Grundsatz der Offenheit soll eine transparente Arbeitsweise der Organe der Europäischen Union angestrebt werden. Die Menschen sollen verstehen, was die Politiker auf europäischer Ebene tun, sie sollen Entscheidungsprozesse nachvollziehen können. Der gewohnte Euro - Jargon soll in verständlicher Weise dem Bürger nahegebracht werden, um sein Vertrauen in die für ihn unüberschaubar scheinende Vielfalt der Institutionen zu gewinnen.
Mit Transparenz geht vor allem die Forderung nach besserer Verständlichkeit der Rechtsvorschriften und leichterem Zugang der Bürger zu Informationen und Rechtsakten der Union einher. Letztere Forderung wurde in Amsterdam mit dem Artikel 255 neu in den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften (EGV) aufgenommen: „Jeder Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder Sitz in einem Mitgliedstaat hat das Recht auf Zugang zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission [...].“27Eine fast gleichlautende Formulierung findet man auch in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.28
3.2 Partizipation
Das zunehmende Desinteresse an der Beschlussfassung und der Durchsetzung europäischer Politik entspringt vor allem dem Gefühl, den Politikentscheidungsprozess nicht wirklich beeinflussen zu können. Viele Unionsbürger empfinden zwar eine große Sympathie für die europäischen Ideale, doch können sie sich des Eindrucks nicht verwehren, dass die Verhältnisse vor Ort - der Reichtum aus Sprachen und Kulturen - nicht berücksichtigt wird. Im Arbeitsprogramm zu diesem Weißbuch heißt es dazu treffend: „Die Vorstellung, einem erweiterten Europa anzugehören und seine Ziele zu teilen, hängt von dem Gefühl ab, die Funktionsweise der Europäischen Union mit fünfzehn Mitgliedstaaten steuern sowie an Debatten und Beschlüssen über die Weiterentwicklung ihrer Politik mitwirken zu können.“29
Die Menschen wollen eine Demokratie „zum Anfassen“, sie wollen an der Formulierung der Ziele, der Umsetzung der Politik und der Begutachtung der Fortschritte mitwirken. Durch eine verstärkte politische Teilhabe an diesen Prozessen soll es möglich sein, das Vertrauen in die Politik der Union zu vertiefen.
3.3 Verantwortlichkeit
Das Informationsdefizit der EU - Bürger über die einzelnen Institutionen auf europäischer Ebene bleibt nach wie vor beträchtlich. Im Jahre 1998 fragte das Allensbacher Institut „Wer trifft die wichtigsten Entscheidungen für die Europäische Union: die Kommission der Europäischen Union oder der Ministerrat ?“ Es entschieden sich 22 Prozent für die Kommission und 16 Prozent für den Ministerrat. Doch entschloss sich die überwiegende Mehrheit der Befragten - 62 Prozent - für die Antwortmöglichkeit „Unentschieden, weiß nicht“.30
Nach dem hier ansetzenden Grundsatz der Verantwortlichkeit müssen die Rollen im Gesetzgebungs - und Verwaltungsverfahren klarer werden. Jede der EU - Institutionen hat ihre Zuständigkeiten und die Verantwortung dafür deutlich zu machen. Dies gilt ebenfalls für alle, die in den Mitgliedstaaten an der Entwicklung und Umsetzung der EU - Politik beteiligt sind, um die Entfremdung zwischen den EU - Organen und den EU - Bürgern abzubauen.
3.4 Effektivität
Zwar erwarten die Europäerinnen und Europäer von der Europäischen Union die politische Lösung aktueller Probleme wie Globalisierung, Arbeitslosigkeit, Umweltzerstörung und Nahrungsmittelsicherheit, jedoch erscheint ihnen das Vorgehen der EU zum Teil unwirksam oder zum falschen Zeitpunkt einsetzend. Dem möchte man mit dem Grundsatz der Effektivität entgegentreten, der sich auf die Zielgenauigkeit der politischen Maßnahmen, den proportionalen Aufwand sowie die Auswahl der angemessenen Handlungsebene bezieht. Es wird angestrebt, zukünftig „auf der Grundlage von klaren Zielen, Folgenabschätzungen und gegebenenfalls Erfahrungswerten das Nötige“ (13) vorzusehen und keinen unnötigen Papierkrieg zu führen, da es immer wichtiger wird, dass die Bürger die Zusammenhänge von Politik und Aktionen der EU verstehen. Gründe dafür sind die gewachsenen Aufgaben, die Verstärkung der Vielfalt durch die Erweiterung und die stärkere Einbeziehung der regionalen und lokalen Behörden in die EU - Politik.
3.5 Kohärenz
Der Europapolitik fehlt es weiterhin an Lesbarkeit und Verständlichkeit, so dass es wenig verwunderlich ist, dass die europäischen Bürger dem EU - System skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen und der politische Prozess auf europäischer Ebene selbst für den interessierten Staatsbürger weitgehend unzugänglich bleibt. Das Einigungswerk der EU wird erschwert durch gemeinsame Beschlüsse, die tief in das Leben der Staaten und ihrer Bürger eingreifen, die also immer wieder nur durch Kompromiss, durch langwierigen Ausgleich unterschiedlicher Wünsche und Ansprüche möglich sind.
Doch gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Erweiterung der EU greifbar nahe erscheint, ist es wichtig, dass die europäische Politik nachvollziehbar bleibt. Es findet eine immer stärkere Einbindung regionaler und lokaler Akteure statt, eine erhöhte Bedeutung kommt dabei der kommunalen Ebene im staatlichen und politischen Gefüge zu. Gerade diese Ebene ist es, die als unterste staatliche Einheit dem Bürger am nächsten steht. Gleichzeitig bietet ein Modell wie das der kommunalen Selbstverwaltung die Möglichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger, am konkreten politischen Geschehen zu partizipieren, das eigene (lokale) Lebensumfeld zu gestalten und so Demokratie als Form der Bürgerbeteiligung erlebbar zu machen. Zudem fällt die Umsetzung von Entscheidungen aus Brüssel in der EU der kommunalen Ebene zu, es sind demzufolge Kommunalpolitiker, die diese Umsetzung in konkrete Politik gegenüber dem Bürger zu verantworten haben und die damit die Garanten „europäischer Demokratie von unten“31sind.
Diese fünf Grundsätze des guten Regierens verstärken ihrerseits die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität. Alle Entscheidungen und Regelungen sollen nur dann ergehen, wenn sie auch wirklich erforderlich sind. Ist die Bedingung der Erforderlichkeit gegeben, so muss die Regelung die zweckmäßigste Lösung bei möglichst geringer Belastung der Bürger und der Gesellschaft enthalten. Der größtmöglichen Bürgernähe gilt bei der Wahl der Entscheidungsebene Priorität, denn die EU ist das „Europa der Bürger“, in dem die Gemeinschaftsorgane bestrebt sind, alle den Bürger unmittelbar betreffenden Entscheidungen auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips zu treffen, zu dem es im Artikel 5 EGV heißt:
„ Die Gemeinschaft wird innerhalb der Grenzen der ihr in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten Zielen tätig.
In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, wird die Gemeinschaft nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf der Gemeinschaftsebene erreicht werden können.
Die Maßnahmen der Gemeinschaft gehen nicht über das für die Erreichung der Ziele dieses Vertrages erforderliche Maß hinaus.“32
4. Vorschläge für einen Wandel
4.1 Bessere Einbindung der Akteure
Den ersten Unterpunkt der besseren Einbindung aller Akteure in die Gestaltung und Umsetzung der EU - Politik stellt die angestrebte offenere Arbeitsweise der Union dar. Die Diskussion um die Europäische Union wird unter den Stichworten „mehr Bürgernähe“ und „größere Transparenz“ der Brüsseler Entscheidungsverfahren, sowie der Forderung nach mehr Demokratie geführt. Indem den Bürgern das Recht zur Beteiligung am öffentlichen Diskurs zugestanden werden soll, ist es notwendig, ihnen auch den ungehinderten Zugang zu Informationen über Europa zu ermöglichen. Es geht deshalb vor allem um die Einrichtung internet - und Email - gestützter Informationssysteme, die einen besseren Informationsfluss zwischen der Europäischen Union, ihren Partnern und den Bürgern ermöglichen sollen, da sie die unmittelbarste und effizienteste Form der Weitergabe von Informationen darstellen.
Die Website EUROPA33soll dafür weiter ausgebaut werden. Doch schon jetzt bietet sie dem interessierten Bürger eine unglaubliche Fülle an Informationen zur EU - Politik: man kann seine Kenntnisse über die einzelnen Organe der EU erweitern, sich über die verschiedenen Tätigkeitsbereiche der Europäischen Union informieren oder die neuesten Pressemitteilungen und andere amtliche Dokumente lesen. Dieser Service wird in den zur Zeit elf Amtssprachen34der EU angeboten.
Das Problem der Sprachen steht auf der Ebene der europäischen Union schon seit längerem im Raum. Den deutsche EU - Beamten wird vorgeworfen, sich in Brüssel nicht mit Nachdruck für eine bessere Etablierung der deutschen Sprache als Arbeitssprache einzusetzen. Zumeist wird in Englisch oder Französisch verhandelt, gesprochen und gestritten - selbst Kommissionspräsident Romano Prodi gibt zu, Probleme mit Fremdsprachen zu haben, so dass es für ihn schwierig ist, „rhetorische Glanzleistungen“35zu vollbringen. Mit dem Beitritt neuer Mitgliedstaaten steht die EU somit und vor allem auch auf sprachlicher Ebene vor einer großen Herausforderung, indem im Zuge dieses Beitrittsprozesses die Website EUROPA um die neuen Sprachen erweitert werden soll. Damit wird es auch den neuen EU - Bürgern ermöglicht, den Politikgestaltungsprozess der EU zu verstehen und nachzuvollziehen.
Unter der Internet - Adresse http://eur-op.eu.int bietet die EU seit Anfang des Jahres 2002 eine Website, die einen besseren Überblick über neue Veröffentlichungen und die Entwicklung bei der europäischen Gesetzgebung geben soll.36
Innerhalb der Verbesserung des Verhältnisses zwischen Europäischer Union und den Bürgern soll außerdem Wert gelegt werden auf einen Ausbau des interaktiven Verhältnisses in den Mitgliedstaaten. In Deutschland versucht man, durch das e - Demokratie Projekt des Deutschen Bundestages zur Modernisierung des Informationsrechtes37, den Bürgern eine bessere Kommunikation mit dem Deutschen Bundestag zu ermöglichen. In erster Linie geht es um die Erarbeitung des Informationsfreiheitsgesetzes, doch soll es vor allem möglich werden, den allgemeinen Gesetzgebungsprozesse mitzuerleben.
Durch die Veranstaltung von „Bürgerkonferenzen“38sollen Experten, politische Verantwortliche und „gebildete“ Bürger gemeinsam mit Wissenschaftlern debattieren können, um eine Kommunikationskultur zu etablieren, die den Bürgern das Gefühl vermittelt, mit ihren Ansichten, aber auch mit ihren Sorgen und Nöten, ernst genommen zu werden. Dies würde den Bürgern nicht nur das Gefühl der Zugehörigkeit zu Europa und die Möglichkeit der Artikulation gegenüber der EU geben, sondern es Politikern auch ermöglichen, geplante europäische Projekte zur Diskussion zu stellen, um über das Feedback der Bürger Schlussfolgerungen für mögliche Änderungen zu ziehen.
Der zweite Unterpunkt ist der Einbeziehung der Bürger auf regionaler und kommunaler Ebene gewidmet, die über demokratische Strukturen stattfinden soll. Die Kompetenzen und die praktischen Erfahrungen der regionalen und lokalen Akteure sollen durch einen systematischeren Dialog mit den Regionen, Städten und Kommunen in einem frühzeitigeren Stadium der Entscheidungsfindung besser genutzt werden, ein Ausdruck ihrer „wachsenden Verantwortlichkeiten“ (16) in den Mitgliedstaaten.
Die Bereiche, in denen die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den verschiedenen Ebenen verbessert werden sollen, sind zum einen die Einbindung in die Politikgestaltung, größere Flexibilität und die Gesamtkohärenz der Politik. Die regionalen und lokalen Erfahrungen sollen bei der Entwicklung politischer Vorschläge einbezogen werden, wobei die „verfassungs - und verwaltungsrechtlichen Regelungen der einzelnen Staaten zu beachten sind.“ (17) Der durch den Vertrag von Maastricht geschaffene Ausschuss der Regionen (AdR) soll somit von seinem Schattendasein befreit werden und bei der Prüfung der Politik eine „proaktivere Rolle“ (18) spielen. Der AdR besteht aus 222 Vertretern der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und wird vom Rat oder von der Kommission zu regional relevanten Fragen - zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Jugend, Kultur oder Gesundheitswesen - gehört und kann überdies auch aus eigener Initiative Stellungnahmen abgeben.39
Eine Möglichkeit zum besseren Verständnis der Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen sieht das Weißbuch in einem Personalaustausch, um die jeweiligen politischen Ziele, Arbeitsmethoden und - instrumente besser kennen zu lernen und um so die „Richtigkeit eigener Rechtsgrundsätze kritisch zu überprüfen.“40
Den lokalen Akteuren soll eine größere Bewegungsfreiheit bei der Umsetzung von Vorschriften zugestanden werden, da die im Moment vom Rat und vom Europäischen Parlament erlassenen Rechtsvorschriften entweder zu detailversessen oder kaum auf die jeweiligen Verhältnisse vor Ort zugeschnitten sind. Was für Portugal gut ist, muss nicht im gleichen Maße auch für Finnland geeignet sein. Romano Prodi weiß um das Problem, indem er anführt: „Europa, zumal ein erweitertes Europa, kann nicht nur von Brüssel aus geführt werden.“41
Der dritte Unterpunkt widmet sich den Beziehungen mit der Zivilgesellschaft.42 Über Organisationen der Zivilgesellschaft können sich Bürger am kommunalen und lokalen Leben beteiligen, sie können ihren Anliegen eine Stimme geben. Indem Akteure der Zivilgesellschaft in die Entscheidungsprozesse der EU einbezogen werden sollen, wächst deren Akzeptanz für Prozesse und Regeln auf europäischer Ebene.
Es soll eine „verstärkte Konsultations - und Dialogkultur“ (22) entstehen, vor allem unter Beteiligung der Vertreter des Europäischen Parlaments. Vielleicht würde sich sogar die Möglichkeit eröffnen, die Debatten der nationalen Parlamente zu europäischen Fragen zu „vernetzen“43.
Die angestrebte Konsultationskultur soll mittels eines „Verhaltenskodexes“ (22) strukturiert werden, in dem die Verantwortlichkeiten festgelegt und die Rechenschaftspflicht aller Partner geregelt werden.
Es wird außerdem ein Nachdenken über die Organisation und Rolle des Wirtschafts - und Sozialausschusses (WSA) gefordert, dem Vertreter der verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft angehören.44Wie der AdR soll auch der WSA eine proaktivere Rolle bei der Erarbeitung von Stellungnahmen und Berichten spielen, vor allem sollen Stellungnahmen zukünftig vor anstatt nach der Unterbreitung von Vorschlägen an die Legislative abgegeben werden.
4.2 Eine bessere Politik, bessere Regeln und bessere Ergebnisse
Das Weißbuch nennt die Detailversessenheit der EU - Gesetzgebung als Grund für deren geringe Anpassungsfähigkeit an Veränderungen der Marktbedingungen oder der Technologie. Die Vorschriften sind zu unflexibel, vor allem wird die Länge des Gesetzgebungsprozess bemängelt. Wenn derzeit ein Gesetz vom Vorschlag bis zur nationalen Umsetzung im Schnitt zwei Jahre braucht, so ist das, nicht nur in den Augen der Kommission, ein zu langer Zeitraum.
Um schneller zu besseren Ergebnissen zu kommen, wird man zukünftig weiterhin vor allem Expertenwissen vertrauen. Doch das derzeitige System der europäischen Sachverständigenausschüsse wird zurecht als undurchsichtig erkannt. Mit dem Einsatz von mehrheitlich nationalen Experten wird man versuchen, den Bürgern das Vertrauen in die politischen Behörden und deren Entscheidungsvorbereitung zurückzugeben, indem sich das System der Hinzuziehung von Experten stärker der öffentlichen Kontrolle und Debatte stellt.
Ein wichtiger Punkt kommt auch dem kombinierten Einsatz von Politikinstrumenten zu. Durch eine Kombination aus förmlichen Rechtsvorschriften und nicht bindenden Regelungen und Selbstverpflichtungen sollen die komplizierten Rechtsvorschriften der Europäischen Union vereinfacht und von ihrer Starrheit befreit werden, soll der Rechtsetzungsprozess beschleunigt werden.45Um diese Verbesserungen erreichen zu können, werden Voraussetzungen genannt, die zusammengefasst folgendes beinhalten: bereits im Vorfeld der Vorschlagsausarbeitung soll geprüft werden, ob diese politischen Initiativen überhaupt notwendig sind und ob die EU tätig werden muss. Ist dies der Fall, wird man verstärkt auf das Abwägen von Kosten und Nutzen achten bzw. Auswirkungen auf Wirtschaft und Natur einbeziehen.
Die Wahl und der Einsatz verschiedener Politikinstrumente müssen gut überlegt sein, außerdem soll der Möglichkeit der Koregulierung zunehmende Bedeutung zugesprochen werden. „Koregulierung kombiniert bindende Rechtsetzungs - und Regelungstätigkeit mit Maßnahmen der Hauptbeteiligten unter Nutzung ihrer praktischen Erfahrungen.“ (27) Der Vorteil wird in der stärkeren Identifikation der Akteure mit der Politik gesehen, die zur besseren Einhaltung nicht bindender Regeln führt.
Durch die Methode der offenen Koordinierung will die Kommission die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördern, zum Beispiel im Bereich nationaler Bildungssysteme.46
Die Entwicklung einer Evaluierungs - und Feedback - Kultur wird ebenso als Ziel genant, wie die Verpflichtung der Kommission, Vorschläge zurückzuziehen, wenn „die vertraglich verankerten Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit oder die Ziele des Vorschlags im Zuge der Verhandlungen zwischen den Institutionen ausgehöhlt werden.“ (29)
Des weiteren sollen im Zuge der Vereinfachung des Gemeinschaftsrechts Gesetzestexte neu geordnet und überflüssige Vorschriften gänzlich gestrichen werden. Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten besteht in der Zusage, den nationalen bürokratischen Aufwand in einem verträglichen Maß zu halten.
Angestrebt wird außerdem die Schaffung weiterer EU - Regulierungsagenturen, die EU - Recht einerseits der Wirtschaft, andererseits den Bürgern näher bringen könnten, indem die Verhältnisse der von bestimmten Entscheidungen besonders betroffenen Bevölkerungskreise besser beachtet werden. Daneben geben die Agenturen der Kommission die Möglichkeit, sich wieder verstärkt auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren.
Zur Zeit liegen Vorschläge für drei Agenturen vor: eine Europäische Lebensmittelbehörde, eine Agentur für die Sicherheit im Seeverkehr und eine Agentur für die Sicherheit im Luftverkehr, wobei erstere durch den Kampf um ihren Standort Schlagzeilen aufwarf und wo letztere im Zusammenhang mit den Ereignissen des 11. September 2001 keine weitere Betätigungserlaubnis zu brauchen scheint.
Ganz konkret werden die Mitgliedstaaten gebeten, für eine rechtzeitige Um - und Durchsetzung der Regeln der EU zu sorgen, da Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht in Zukunft stärker geahndet werden sollen. Den Bürgern steht zwar weiterhin die Möglichkeit der Beschwerde beim Petitionsausschuss47 oder dem Bürgerbeauftragten des Europäischen Parlamentes48 offen (wobei diese Einrichtungen durch ähnliche Netzwerke auf nationalstaatlicher Ebene ergänzt werden sollen), durch eine bessere Aus - und Weiterbildung von Rechtsanwälten und Richtern sollte es jedoch gelingen, diese vertiefend mit dem Gemeinschaftsrecht vertraut zu machen, so dass sie den Bürgern zufriedenstellendere Auskünfte geben und mehr Hilfe anbieten können.
4.3 Der Beitrag der EU zur Global Governance
Indem man bei der Bewältigung der Globalisierung auf ähnliche Probleme stößt wie man sie durch europäische „Governance“ zu lösen gedenkt (immer mehr Nationen sehen sich immer mehr Vorschriften gegenüber, multilaterale Regeln gehen zum Teil kaum mit nationalen Beschlüssen einher), scheint es angebracht, europäische „Governance“ in einem umfassenderen, globalen Raum zu sehen.
Die Europäische Union hat es sich zur Aufgabe gemacht, die ihr inhärenten Ziele der Friedenssicherung und der Aufrechterhaltung von Wachstum, Beschäftigung und sozialer Gerechtigkeit auch außerhalb ihrer Grenzen zu fördern, die Union ist mehr oder weniger selbst zum „Exportartikel“49geworden.
Die Voraussetzung für dieses hochgesteckte Ziel ist jedoch die Reform des „eigenen Hauses“, bevor man sich der globalen Dimension zuwenden kann, um sich so auch in multilateralen Verhandlungen stärker einbringen und um mit einer Stimme sprechen zu können. Dies wird angesichts der Verantwortung, die die EU in Zukunft mit der globusumspannenden Präsenz des Euro zu tragen hat, immer wichtiger.
4.4 Neuausrichtung der Politiken und Institutionen
„Politikfelder neu ausrichten bedeutet, dass die Union ihre langfristigen Ziele klarer fassen muss.“ (37) Es geht vor allem um das Ziel der Erweiterung bei gleichzeitiger Integration, so dass die Vergrößerung der Europäischen Union nicht zu einer Verwässerung der Gemeinschaft führt. Den Bürgern der EU soll so eine bessere Identifikation mit der Politik der Union ermöglicht werden, da sie schließlich immer mehr in das tägliche Leben jeder einzelnen Europäerin und jedes einzelnen Europäers eingreift.
Unter dem Punkt der Neuausrichtung der Institutionen geht es um die Klarstellung der Rollen und Verantwortlichkeiten der einzelnen Organe, so dass die Bürger ihre eigenen Politiker und Institutionen leichter für Entscheidungen verantwortlich machen können, die die EU trifft. Schon in der Präambel des Vertrages über die Europäische Union50findet man den Wunsch, „Demokratie und Effizienz in der Arbeit der Organe weiter zu stärken, damit diese in die Lage versetzt werden, die ihnen übertragenen Aufgaben in einem einheitlichen institutionellen Rahmen besser wahrzunehmen [...].“
An erster Stelle steht der Europäische Rat, der sich nicht mit tagespolitischen Angelegenheiten befassen soll, da die in ihm geforderten Mehrheitsentscheidungen zu oft durch nationale Interessen behindert werden. Vielmehr soll er strategische Ziele formulieren und Fortschritte und Erfolge der Union im Verlauf der Realisierung dieser Ziele besser kontrollieren.
Zu dieser Feststellung kommen auch der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder und der britische Premier Tony Blair. In einem am 25. Februar 2002 in Berlin veröffentlichten Brief der beiden Regierungschefs sprechen sie sich für eine Initiative zur Reform des Europäischen Rates und der Ministerräte aus. Die Arbeit dieser Gremien müsse gestrafft und öffentlicher gemacht werden, um eine „verbesserte Transparenz der Beschlussfassung“ und mehr demokratische Verantwortung zu erreichen.51
Die Institutionen sollen sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, um eine genauere Abgrenzung der Aufgaben und Pflichten des Rates, des Europäischen Parlamentes und der Europäischen Kommission zu erreichen. Der Rat und das Europäische Parlament sollen sich vermehrt auf die politische Führung konzentrieren, sie sollen die Ausrichtung und den politischen Inhalt der Rechtsvorschriften definieren und die Umsetzung der Exekutive überlassen. Die Kommission, die zum einen von den Regierungen zunehmend zum reinen Erfüllungsorgan degradiert wird und der zum anderen immer weniger Vertrauen durch die EU - Bürger entgegengebracht wird52, soll in der Verwaltung unabhängiger arbeiten können und von ihrem Initiativrecht gezielter Gebrauch machen. Außerdem soll sie die Überwachung des Gemeinschaftsrechts gewährleisten und die Verträge hüten.
Der Rat soll seine verschiedenen Fachministerräte und damit alle Aspekte der EU - Politik besser koordinieren. Er soll seine politische Führungsfähigkeit und seine Fähigkeit, Maßnahmen auf EU - und nationaler Ebene zu verknüpfen, verstärken.
Das Europäische Parlament und alle nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten und der Beitrittsländer sollen mit der Bevölkerung in einen Dialog treten und eine öffentliche Diskussion über die Zukunft Europas und seiner Politik anstoßen. Außerdem soll das Europäische Parlament seine Kontrolle über die Durchführung der EU - Politiken und die Ausführung des Haushalts verstärken.
Insgesamt soll der Entscheidungsprozess vereinfacht, schneller und transparenter werden. Angestrebt wird eine Änderung des Artikel 202 EGV53:
„Zur Verwirklichung der Ziele und nach Maßgabe dieses Vertrages
- sorgt der Rat für die Abstimmung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten;
- besitzt der Rat eine Entscheidungsbefugnis;
- überträgt der Rat der Kommission in den von ihm angenommenen Rechtsakten die
Befugnisse zur Durchführung der Vorschriften, die er erläßt. Der Rat kann bestimmte Modalitäten für die Ausübung dieser Befugnisse festlegen. Er kann sich in spezifischen Fällen außerdem vorbehalten, Durchführungsbefugnisse selber auszuüben. Die oben genannten Modalitäten müssen den Grundsätzen und Regeln entsprechen, die der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments vorher einstimmig festgelegt hat.“
Da heute jedoch vermehrt Entscheidungen von Rat und Europäischen Parlament gemeinsam getroffen werden, sollen diese beiden Organe auch bei der Kontrolle des Vollzugs gleichgestellt sein.
Schluss - Fazit und Ausblick
Die Europäische Union steht zur Zeit vor einer ihrer größten Herausforderungen, sie will größer, effektiver und bürgernäher werden. Sollte es 2004 zum „Big Bang“ bzw. dem „Großen Konvoi“, d.h. dem gleichzeitigen Beitritt mehrerer Staaten kommen54, so gilt es, den Prozess europäischer Politik vor der Erweiterung um weitere 75 Millionen Menschen zu reformieren. Um aufnahmebereit zu sein, muss sich die Union gründlich verändern, um auch als erweiterte Gemeinschaft noch effektiv arbeiten und entscheiden zu können. Mit jenen komplizierten Entscheidungsverfahren, die einst für sechs Staaten erfunden worden waren und heute mit fünfzehn mehr schlecht als recht funktionieren, kann die Gemeinschaft nicht auf 20 oder mehr Mitgliedstaaten anwachsen.
Gerade in vielen ostmitteleuropäischen Ländern weicht die Euphorie über einen EU - Beitritt allmählich der Skepsis. Und solange sich in den jetzigen Mitgliedstaaten die Enttäuschung über die europäische Politik hält, wird man den neuen Mitgliedern kaum glaubhaft machen können, dass die EU gerade nicht überbürokratisiert und uneffektiv ist.
Die durch das Weißbuch vorgegebenen und zu bewältigenden Aufgaben betreffen nicht nur die Kommission, sondern alle europäischen Institutionen. Auch die Regierungen und gewählten Volksvertretungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene müssen gewillt sein, ihren Beitrag zum Ausbau einer Demokratie zu leisten, die den Bürgern fassbarer erscheint und ihnen mehr Möglichkeiten zur politischen Teilhabe bietet.
Die Aufgabe, die sich Romano Prodi gestellt hat, heißt: vollkommen neue Wege zu finden, wie Europa gestaltet werden soll. Über „Governance“ zu reden heißt für Prodi, „über europäische Demokratie, über ihre Funktionsweise, über Probleme, aber auch Perspektiven“55zu reden.
Mit diesem Weißbuch wollte Romano Prodi nicht mehr als eine Debatte über die Veränderung europäischen Regierens anstoßen. Doch gerade daran stören sich die Kritiker. Indem keine der schon morgen realisierbaren Reformen einer Vertragsänderung bedarf, muss der Vorwurf aufkommen, dass es Prodi nicht wirklich ernst ist. Der Bürgerbeauftragte des Europäischen Parlaments, der Finne Jacob Magnus Södermann56, nannte das Weißbuch „blutleer und technokratisch“57und warf Prodi vor, dass es ihm nicht wirklich um die Sache gegangen ist, denn dann hätte er sich für einen bindenden und justiziablen Verhaltenskodex für alle EU - Beamten stark gemacht, anstelle wie bisher lediglich auf unverbindliche Richtlinien zu setzen. Er begrüßt zwar die Anstrengungen, den Bürgern offener und verlässlicher entgegen zu treten, doch kann er dem Dokument keine Schritte entnehmen, wie diese Prinzipien von trockener Theorie in die Praxis umgesetzt werden sollen, um die EU den Bürgern wirklich näher zu bringen.58
So ist zum Beispiel der Abschnitt über die Einbeziehung der Zivilgesellschaft einer der wenigen Abschnitte, an dessen Ende keine „Aktionspunkte“ präsentiert werden. Außerdem gilt es hier zu beachten, dass die Einbeziehung von Nichtregierungsorganisationen und anderen informellen Gruppen die Transparenz und Effektivität des EU - Handelns zwar verbessern kann, dass diese Gruppen aber nicht über ein demokratisches Wahlmandat verfügen und nicht vom Parlament kontrolliert werden.
Auch im Ausschuss für Recht und Binnenmarkt stieß das Weißbuch auf Ablehnung. Manuel Medina, spanischer Abgeordneter der Sozialdemokratischen Partei Europas, wies auf die Gefahr der Beeinträchtigung der Gesetzgebungskompetenz des Parlaments hin. Er sprach sich gegen weiterer Regulierungsagenturen aus, da diese einer wirksamen Kontrolle der Kommission durch das Parlament entgegenstünden und zu einer Machtbündelung in einzelnen Gremien führten.
Drastisch, aber immerhin die Lacher auf seine Seite ziehend, drückte der deutsche Abgeordnete der Europäischen Volkspartei Klaus - Heiner Lehne seine Meinung zum Weißbuch „Europäisches Regieren“ aus: Es sei „eine Schande, dass wegen solcher Papiere Bäume sterben müssen.“59
Das Weißbuch soll zwar einerseits kein Patentrezept zur Lösung aller Probleme sein, doch ein paar neue Expertinnen und Experten, ein paar neue Gremien und ein Diskussionsforum im Internet werden wohl kaum ausreichen, um die Entfremdung vieler Europäerinnen und Europäer von der EU zu stoppen, vielmehr schüren sie die Angst vor weiterer bürokratischer Regelungswut, so dass Brüssel nur noch mehr als Bevormundung anstatt als Herausforderung angesehen werden wird.
Brandenburgs Europaminister Prof. Dr. Kurt Schelter meinte, dass das Weißbuch „ein wichtiger und notwendiger Schritt der Europäischen Kommission hin zu mehr Bürgernähe“60sei. Ebenso wie Vertreter des Deutschen Städtetages begrüßte er die angestrebte verstärkte Einbindung von regionaler und kommunaler Ebene in die Rechtsetzungstätigkeit der Europäischen Kommission und die stärkere Dezentralisierung, die der lokalen Ebene größere Gestaltungsspielräume eröffnet.
Doch auch Monika Kuban, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages, vermisst konkrete Hinweise darauf, „wie die angestrebten Konsultationen tatsächlich in eine wirksame Beteiligung der kommunalen Seite münden“61sollen.
Schwer verständlich kommt das Weißbuch außerdem daher und wird es so wohl kaum in die Köpfe der europäischen Bürger schaffen. Aber soll sich dieses Dokument auch nicht nur an die Bürger der Europäischen Union wenden. Vielmehr ist es für alle europäischen Entscheidungsträger in den Institutionen und Mitgliedstaaten gedacht, denen viel daran liegen sollte, die Bürger der Union an der Gestaltung der Zukunft Europas teilhaben zu lassen, zu einer „Kultur der Beratung und des Dialogs“ zu finden.
In näherer Zukunft gilt es, auf die Ergebnisse des Konvents unter dem Vorsitz des französischen Ex - Präsidenten Valéry Giscard D`Estaing zu hoffen, der Vorschläge für eine grundlegende EU - Reform erarbeiten wird. Es soll beraten werden, wie das Kräfteverhältnis zwischen der EU und den Mitgliedstaaten in der Zukunft aussehen wird und wie Europa bürgernäher gestaltet werden kann. So will man auf Kritiker des Weißbuches reagieren, denen Vorschläge für eine wirkliche Demokratisierung der EU (zum Beispiel durch eine Stärkung des Europäischen Parlaments) fehlen. Auch wird bemängelt, dass keine Aussagen zu einer europäischen Verfassung enthalten sind.
Die öffentliche Diskussion zum Weißbuch soll bis zum 31. März 2002 dauern. Romano Prodi bittet alle Europäer, sich an dieser Debatte zu beteiligen. Wie viele seinen Wunsch wohl vernommen haben mögen ?
Literaturverzeichnis
Ein Weißbuch zur „Governance“ für die Europäische Union - „Die Demokratie in der
Europäischen Union vertiefen“ - Arbeitsprogramm - Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission. Brüssel. 11.10.2000
Europäisches Regieren - Ein Weißbuch. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Brüssel. 2001 - KOM (2001) 428 vom 25. Juli 2001
Staats - und Verwaltungsrecht Bundesrepublik Deutschland. 30., neubearbeitete Auflage. Heidelberg. C. F. Müller Verlag. 2000
FRITZLER, Marc / USER, Günter: Die Europäische Union. Bonn. Bundeszentrale für politische Bildung. 2001
GASTEYER, Curt: Europa von der Spaltung zur Einigung. Band 360 (vollständig
überarbeitete Neuauflage von Band 348). Bonn. Bundeszentrale für politische Bildung. 2001
HORNBY, A. S.: Oxford Advanced Learner`s Dictionary Of Current English. Bielefeld. Cornelsen-Velhagen & Klasing Verlagsgesellschaft. 1982
LÄUFER, Thomas (Hrsg.): Vertrag von Amsterdam. Texte des EU - Vertrages und des EG - Vertrages mit den deutschen Begleitgesetzen. Bonn. Bundeszentrale für politische Bildung. 2000
MEHLING, Franz N. (Hrsg.): Knaurs Lexikon von a bis z. München. Droemersche Verlagsanstalt. 1995
NOHLEN, Dieter (Hrsg.): Kleines Lexikon der Politik. Bonn. Bundeszentrale für politische Bildung. 2001
WEIDENFELD, Werner (Hrsg.): Europa - Handbuch. Band 359. Bonn. Bundeszentrale für politische Bildung. 1999
Die Europäische Gemeinschaft - Informationen zur Politischen Bildung Heft 213. Bonn. Bundeszentrale für politische Bildung. 1992
Europa für Einsteiger. Thema im Unterricht - Lehrerheft 5. Bonn. Bundeszentrale für politische Bildung. 1998
Europa in 100 Stichworten. Handbuch zur Europa-Politik. Berlin. Presse -u. Informationsamt der Bundesregierung. 2000
Wie die Europäer sich selbst sehen. Aktuelle Themen im Spiegel der öffentlichen Meinung.
Europäische Kommission. Luxemburg. Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 2001
Zeitungsartikel
FOCUS. 4/2002
„Raumschiff Brüssel“. STERN. Nr. 48/2000
23
Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) vom 26.05.2000
06.11.2001
07.11.2001
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 03.03.2002
VOP 1 - 2/2000
EU - NACHRICHTEN. Nr. 28. 26.07.2001
BRÜSSEL AKTUELL. 33/2001 der Woche vom 31.08. bis 04.09.2001 BRÜSSEL AKTUELL. 35/2001 der Woche vom 14. bis 21.09.2001 EU - Wochenspiegel Nr. 30/01 vom 27.07.2001
Internetquellen
www.europa.eu.int Stand: 14.02.2002
eur-op.eu.int Stand: 02.03.2002
www.elektronische-demokratie.de Stand: 02.03.2002
www.msn.de Stand: 25.02.2002
www.mdje.brandenburg.de Stand: 13.10.2001
www.staedtetag.de Stand: 13.10.2001
[...]
1Schüler, 16 Jahre, Berlin, zitiert nach: Petra Moritz / Bruno Zandonella: Europa für Einsteiger. Thema im Unterricht - Lehrerheft 5. Bonn. Bundeszentrale für politische Bildung. 1998. Seite 5
2Demnach begegnen 40 Prozent der Bürger der fünfzehn EU - Mitgliedstaaten der EU misstrauisch, 41 Prozent
bringen ihr Vertrauen entgegen und 19 Prozent sind unentschieden. Quelle: Eurobarometer. Stand: Dezember 2001. in: „Euro - Fighter am Start“. FOCUS. 4/2002. Seite 176
3KOM (2001) 428
4Franz N. Mehling (Hrsg.): Knaurs Lexikon von a bis z. München. Droemersche Verlagsanstalt. 1995. Seite 272
5A. S. Hornby: Oxford Advanced Learner`s Dictionary Of Current English. Bielefeld. Cornelsen-Velhagen & Klasing Verlagsgesellschaft. 1982. Seite 981
6www.europa.eu.int/comm/off/info_de.htm, Stand: 14.02.2002
7KOM (93) 457
8KOM (2001) 531
9„Vollendung des Binnenmarktes: Weißbuch der Kommission an den Europäischen Rat“, KOM (85) 310
10die Seitenangaben in Klammern beziehen sich auf dieses Weißbuch
11In Paris unterzeichneten am 18. April 1951 Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) - auch Montanunion genannt - der am 23. Juli 1952 in Kraft tritt. Die Hohe Behörde der EGKS nimmt am 10. August unter ihrem ersten Präsidenten Jean Monnet die Arbeit auf.
12ausführlich zur Entwicklung der europäischen Einigung Curt Gasteyer: Europa von der Spaltung zur Einigung. Band 360 (vollständig überarbeitete Neuauflage von Band 348). Bonn. Bundeszentrale für politische Bildung. 2001, ein kürzerer Überblick findet sich in Marc Fritzler/Günther User: Die Europäische Union. Bonn. Bundeszentrale für politische Bildung. 2001
13Rede Churchills am 19. September 1946 in Zürich (Auszug), abgedr. in: Curt Gasteyer: Europa von der Spaltung zur Einigung. a.a.O. Seite 43 - 44, hier Seite 43
14Artikel 23 Absatz 2 GG [Europäische Union]
15Europa in 100 Stichworten. Handbuch zur Europa - Politik. Berlin. Presse - u. Informationsamt der Bundesregierung. 2000. Seite 8
16Manuela Glaab: Die Bürger in Europa, in: Werner Weidenfeld (Hrsg.): Europa - Handbuch. Band 359. Bonn. Bundeszentrale für politische Bildung. 1999. Seite 607
17Elisabeth Noelle-Neumann/Thomas Petersen: Die Bürger in Deutschland, in: Werner Weidenfeld (Hrsg.): Europa - Handbuch. a.a.O. Seite 591
18zu weiteren Gründen für die ablehnende Reaktion vieler Europäerinnen und Europäer auf den Vertrag von Maastricht näher bei Dieter Nohlen (Hrsg.): Kleines Lexikon der Politik. Bonn. Bundeszentrale für politische Bildung. 2001. Seite 106
19Werner Weidenfeld: Europa - aber wo liegt es ?, in: Werner Weidenfeld (Hrsg.): Europa - Handbuch. a.a.O. Seite 37
20Artikel 17 EGV
21Eurobarometer 52.0 - Umfrage Oktober - November 1999, in: Wie die Europäer sich selbst sehen. Seite 33
22„Raumschiff Brüssel“. STERN. 48/2000. Seite 259
23Armin Czysz: Maastricht - nach dem Jubel der Katzenjammer ?, in: Die Europäische Gemeinschaft - Informationen zur Politischen Bildung Heft 213. Bonn. Bundeszentrale für politische Bildung. 1992. Seite 43
24ebd.
25neben dem Eintreten für ein stabiles Europa mit einer stärkeren Stimme in der Welt, einer neuen wirtschafts - und sozialpolitischen Agenda und dem Schaffen einer höheren Lebensqualität für alle
26EU - Wochenspiegel Nr. 30/01 vom 27.07.2001. Seite 2
27Artikel 255 Absatz 1, in: Thomas Läufer (Hrsg.): Vertrag von Amsterdam. Texte des EU - Vertrages und des EG - Vertrages mit den deutschen Begleittexten. Bonn. Bundeszentrale für politische Bildung. 2000. Seite 157
28Artikel 42 der Charta
29Ein Weißbuch zur „Governance“ für die Europäische Union - „Die Demokratie in der Europäischen Union
vertiefen“ - Arbeitsprogramm - Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission. Brüssel. 11.10.2000. Seite 5
30Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage Nr. 6061, nach: Elisabeth Noelle-Neumann/Thomas Petersen: Die Bürger in Deutschland, in: Werner Weidenfeld (Hrsg.): Europa-Handbuch. a.a.O. Seite 599
31Otto Schily, Bundesminister des Inneren der Bundesrepublik Deutschland, in: VOP 1 - 2/2000. Seite 13
32Thomas Läufer (Hrsg.). a.a.O. Seite 51
33www.europa.eu.int
34dänisch, deutsch, englisch, finnisch, französisch, griechisch, italienisch, niederländisch, portugiesisch, schwedisch, spanisch
35Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) vom 7. November 2001. Seite 7
36seit Sommer 2000 läuft auch das EU-Programm IDA (interchange of data between administrations), nähere Informationen unter www.europa.eu.int/ISPO/ida
37www.elektronische-demokratie.de, Stand: 02.03.2002
38Ein Weißbuch zur „Governance“ für die Europäische Union - „Die Demokratie in der Europäischen Union vertiefen“ - Arbeitsprogramm - Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission. Brüssel. 11.10.2000. Seite 8
39zum AdR: Artikel 263 - 265 EGV
40Otto Schily, Bundesminister des Inneren der Bundesrepublik Deutschland, in: VOP 1 - 2/2000. Seite 13
41F.A.Z. vom 26. Mai 2000. Seite 13
42Zivilgesellschaft: Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Nichtregierungsorganisationen, Berufsverbände, gemeinnützige Einrichtungen, gesellschaftliche Basisgruppen, Kirchen, Religionsgemeinschaften (19)
43Ein Weißbuch zur „Governance“ für die Europäische Union - „Die Demokratie in der Europäischen Union vertiefen“
- Arbeitsprogramm - Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission. Brüssel. 11.10.2000. Seite 8
44zum WSA: Artikel 257 - 262 EGV
45vor allem über die Möglichkeit der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit im Rat
46auf eine bessere Abstimmung ihrer Bildungssysteme einigten sich die Bildungsminister der fünfzehn EU - Staaten bei einem informellen Treffen am 2. März 2002 in Granada/Spanien - Quelle: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 3. März 2002. Seite 2
47Artikel 194 EGV
48Ombudsmann, der von den Bürgern der Union Beschwerden über Missstände bei der Tätigkeit der Organe oder
Institutionen der Gemeinschaft entgegennimmt. Er kann bei gerechtfertigten Beschwerden Untersuchungen einleiten, die er dem Parlament und dem betroffenen Organ zuleitet. (Artikel 195 EGV)
49EU - NACHRICHTEN. Nr. 28. 26.07.2001. Seite 13
50Thomas Läufer (Hrsg.) a.a.O. Seite 20 - 21. hier Seite 20
51Artikel unter www.msn.de/artikel/368-14215472.asp, Stand: 25.02.2002 (nicht mehr abrufbar)
52Eurobarometer 55 (Frühling 2001): 45 Prozent der EU 15 sprechen der Kommission ihr Vertrauen aus, 27 Prozent das Misstrauen, 28 Prozent sind unentschieden, in: F.A.Z. vom 6. November 2001. Seite 31
53Thomas Läufer (Hrsg.). a.a.O. Seite 138
54Im Gespräch sind: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern
55BRÜSSEL AKTUELL 33/2001 der Woche vom 31.08. bis 04.09.2001
56er übt diese Funktion seit Juli 1995 aus und wurde im November 1999 durch das Europäische Parlament in seinem Amt bestätigt
57BRÜSSEL AKTUELL 33/2001 der Woche vom 31.08. bis 04.09.2001
58ebd.
59Zur Aufnahme des Weißbuches im Ausschuss für Recht und Binnenmarkt: BRÜSSEL AKTUELL 35/2001 der Woche vom 14. bis 21.09.2001
60www.mdje.brandenburg.de/publikationen/pm2001/pm27-07-01-2.htm, Stand: 13.10.2001
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Weißbuch und worum geht es im "Weißbuch: Europäisches Regieren"?
Ein Weißbuch ist ein Dokument, das von der Europäischen Kommission veröffentlicht wird und Vorschläge für das Handeln der Gemeinschaft in einem bestimmten Bereich enthält. Das "Weißbuch: Europäisches Regieren" zielt darauf ab, Schritte zur Vertiefung der Demokratie in der EU aufzuzeigen und das Vertrauen der Bürger in die europäischen Institutionen zu stärken. Es behandelt Themen wie Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität und Kohärenz im europäischen Regierungsprozess.
Warum wurde das "Weißbuch: Europäisches Regieren" veröffentlicht?
Das Weißbuch wurde als Reaktion auf ein wahrgenommenes Demokratiedefizit in der Europäischen Union veröffentlicht. Viele Bürger äußerten Misstrauen gegenüber den EU-Institutionen, die als bürgerfern und undurchsichtig wahrgenommen wurden. Das Weißbuch sollte dazu beitragen, dieses negative Bild zu entkräften und die Bürger stärker in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen.
Welche sind die fünf Grundsätze des guten Regierens, die im Weißbuch genannt werden?
Die fünf Grundsätze sind:
- Offenheit: Transparente Arbeitsweise der EU-Organe, verständliche Rechtsvorschriften und leichterer Zugang zu Informationen.
- Partizipation: Stärkere Einbeziehung der Bürger in die Formulierung der Ziele, die Umsetzung der Politik und die Begutachtung der Fortschritte.
- Verantwortlichkeit: Klärung der Rollen und Verantwortlichkeiten im Gesetzgebungs- und Verwaltungsverfahren.
- Effektivität: Zielgenaue politische Maßnahmen, proportionaler Aufwand und Auswahl der angemessenen Handlungsebene.
- Kohärenz: Nachvollziehbare europäische Politik trotz komplexer Entscheidungsprozesse und unterschiedlicher Interessen.
Welche Vorschläge macht das Weißbuch für einen Wandel im Europäischen Regieren?
Zu den Vorschlägen gehören:
- Bessere Einbindung aller Akteure, einschließlich der Bürger, der regionalen und kommunalen Ebene sowie der Zivilgesellschaft.
- Eine offenere Arbeitsweise der Union durch bessere Informationssysteme und interaktive Beziehungen in den Mitgliedstaaten.
- Stärkere Berücksichtigung der regionalen und lokalen Ebene durch systematischen Dialog mit Regionen, Städten und Kommunen.
- Einbeziehung von Organisationen der Zivilgesellschaft in die Entscheidungsprozesse.
- Verbesserung der Politik, Regeln und Ergebnisse durch Expertenwissen, flexible Rechtsvorschriften und einen kombinierten Einsatz von Politikinstrumenten.
- Die Schaffung weiterer EU-Regulierungsagenturen.
- Die Reform des Europäischen Rates und der Ministerräte.
Was ist die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips im Kontext des Europäischen Regierens?
Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass die EU nur dann tätig werden sollte, wenn die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf der Gemeinschaftsebene erreicht werden können. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit ist ebenfalls zentral. Dies bedeutet, dass die Maßnahmen der Gemeinschaft nicht über das für die Erreichung der Ziele des Vertrags erforderliche Maß hinausgehen dürfen.
Welche Kritik wurde am Weißbuch geäußert?
Einige Kritiker bemängelten, dass das Weißbuch zu unkonkret sei und keine substanziellen Reformen vorschlage. Es wurde als "blutleer und technokratisch" bezeichnet. Andere kritisierten die fehlende Stärkung des Europäischen Parlaments und die fehlenden Aussagen zu einer europäischen Verfassung. Einige Abgeordnete äußerten die Besorgnis, dass die Gesetzgebungskompetenz des Parlaments beeinträchtigt würde.
Welche Rolle spielt die Erweiterung der EU im Zusammenhang mit dem Weißbuch?
Die Erweiterung der EU stellt eine große Herausforderung dar, da die Union größer, effektiver und bürgernäher werden muss. Das Weißbuch soll dazu beitragen, den Prozess europäischer Politik vor der Erweiterung zu reformieren, um auch als erweiterte Gemeinschaft noch effektiv arbeiten und entscheiden zu können.
Wie kann man sich an der Diskussion über das Europäische Regieren beteiligen?
Das Weißbuch ruft zur öffentlichen Diskussion auf. Bürger können sich an der Debatte beteiligen, indem sie sich über die europäischen Institutionen und Politik informieren, ihre Meinung äußern und sich in zivilgesellschaftlichen Organisationen engagieren.
Was wird von dem Konvent unter dem Vorsitz von Valéry Giscard D'Estaing erwartet?
Es wird von den Ergebnisse des Konvents unter dem Vorsitz des französischen Ex - Präsidenten Valéry Giscard D`Estaing erwartet, der Vorschläge für eine grundlegende EU - Reform erarbeiten wird. Es soll beraten werden, wie das Kräfteverhältnis zwischen der EU und den Mitgliedstaaten in der Zukunft aussehen wird und wie Europa bürgernäher gestaltet werden kann.
- Arbeit zitieren
- Ines Keubler (Autor:in), 2002, Demokratiedefizit in der EU, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/106757