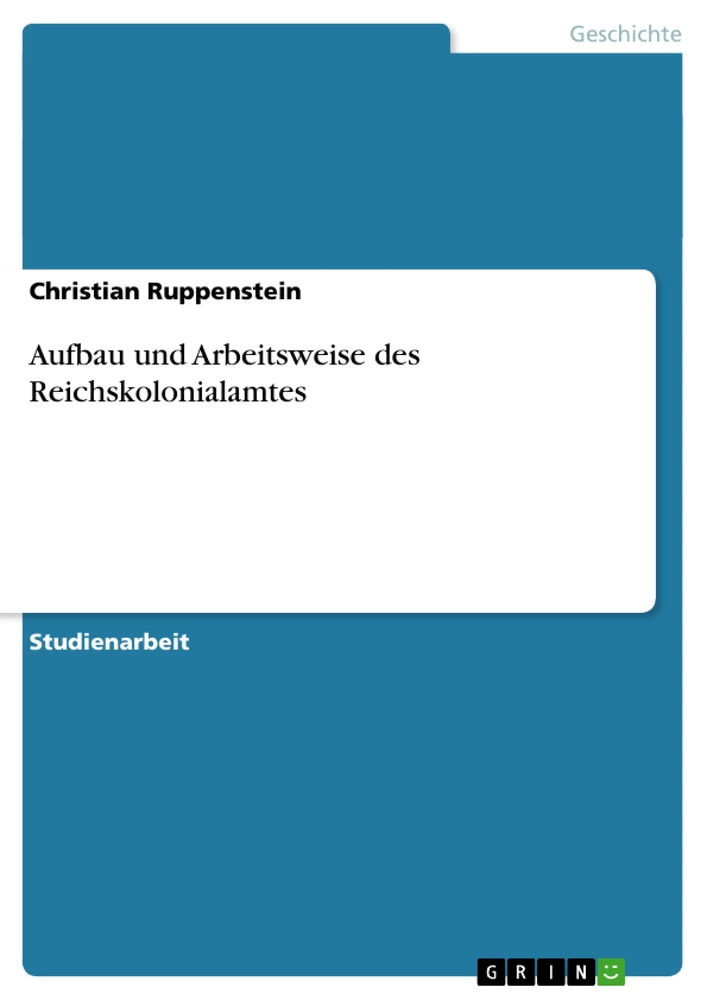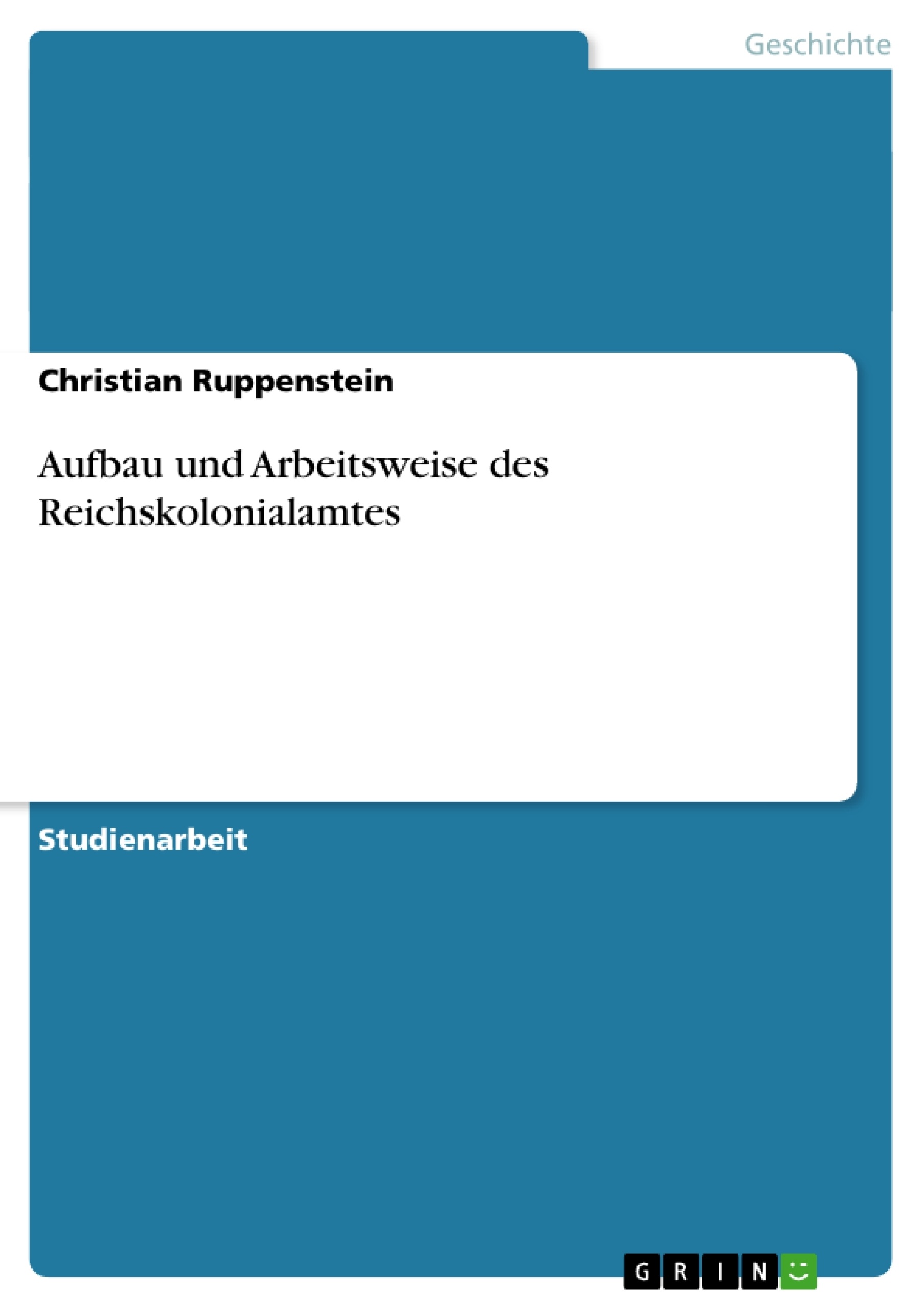Inhaltsverzeichni
A. Einleitung
B. Haupteil
1. Exkurs: Die Ausbildung der obersten Reichsverwaltung
1.1. Die Auseinandersetzung um ein verantwortliches Ministerkollegium
1.2. Der Übergang zur Reichsverwaltung
1.3. Das Stellvertretergesetz von 1878
1.4. Die Weiterentwicklung der Reichsverwaltung nach Bismarck
2. Der Beginn der deutschen Kolonialverwaltung
3. Die Kolonialabteilung im Auswärtigem Amt
3.1. Die Gründung der Kolonialabteilung
3.2. Verwaltungsaufbau der Kolonialabteilung
3.3. Politik der Kolonialabteilung
4. Dernburg und die Kolonialkrise
4.1. Die Kolonialkrise 1905/06
4.2. Die Hottentotten-Wahlen 1907
5. Das Reichskolonialamt
5.1. Gründung des Reichskolonialamtes
5.2. Verwaltungsaufbau des Reichskolonialamtes
5.3. Politik des Reichskolonialamtes
5.3.1. Die Reformen Dernburgs
5.3.1.1. Die Verwaltungsreformen
5.3.1.2. Die Wirtschaftspolitik
5.3.1.3. Die Eingeborenenpolitik
5.3.2. Die Fortführung durch seine Nachfolger
C. Schlußbetrachtungen
D. Literaturliste
A. Einleitung
Das Reichskolonialamt, 1907 als das letzte Reichsamt vor dem Krieg entstanden, steht nur am Ende einer langen Entwicklung in der Kolonialverwaltung, die mit Bismarcks Entschluß, zum formellen Imperialismus überzugehen, ihren Anfang nahm. Es stellt sich nun die Frage, warum man erst 21 Jahre nach dem Erwerb der ersten Kolonien ein eigenständiges für die Kolonialpolitik zuständiges Reichsamt schuf. Welche Beweggründe ließen ausgerechnet 1907 die Gründung eines Reichskolonialamtes für geboten erscheinen? Wie entwickelte sich überhaupt so eine Kolonialverwaltung, da doch Bismarck recht überraschend für seine Zeitgenossen und die Historiker daran ging ein Kolonialimperium aufzubauen1 ? Wie gestaltete sich deren Kolonialpolitik?
Diesen Fragen soll auf den folgenden Seiten nachgegangen werden. Aber zunächst soll auf die vorhandene Literatur verwiesen werden. Jüngere Untersuchungen, die sich spezifisch mit dem Reichskolonialamt befassen, gibt es eigentlich nicht. Zu verweisen ist hier zunächst auf die „Deutsche Verfassungsgeschichte“ von Huber2, die einen knappen Überblick über die Kolonialverwaltung liefert. Einen weiteren kurzen Überblick liefert auch die „Deutsche Verwaltungsgeschichte“3. Einen sehr guten Überblick über die Kolonialverwaltung von 1885-1910 liefert Spidle4, der einen besonderen Blick auf das Kolonialbeamtentum wirft. Für die Frühphase der Kolonial- Zentralverwaltung ist auch das Werk von Kade5 heranzuziehen, der leider sein Vorhaben einer kompletten Darstellung der Kolonial-Zentralverwaltung von den Anfängen bis zum Weltkrieg nicht verwirklichen konnte. Zu dem wohl bedeutendsten Kolonialpolitiker Bernhard Dernburg ist von Werner Schiefel eine Biographie6 erschienen, die durchaus einen kritischen Blick auf Dernburgs Wirken im Reichskolonialamt wirft. Auch verschiedene koloniespezifische Werke liefern einen kurzen Überblick über die Kolonialverwaltung7, die allerdings zum Teil aufgrund der Fülle des Stoffs, die die Geschichte der einzelnen Kolonien liefert, nur wenig über die Kapitel in der „Deutschen Verfassungsgeschichte“ bzw. „Deutschen Verwaltungsgeschichte“ hinausgehen.
Um die Entstehung des Reichskolonialamtes genauer in die Ausbildung der obersten Reichsverwaltung einordnen zu können, wollen wir uns zunächst mit dem Ausbau der obersten Reichsverwaltung befassen, bevor wir uns der Entstehung der Kolonialverwaltung bis hin zum Reichskolonialamt widmen.
B. Haupteil
1. Exkurs: Die Ausbildung der obersten Reichsverwaltung
1.1. Die Auseinandersetzung um ein verantwortliches Ministerkollegium
Um die Entwicklung der Verwaltung des Deutschen Reiches verstehen zu können, ist es notwendig einen Blick zurück zu werfen, und zwar bis zu den Verhandlungen 1867 über die Verfassung des Norddeutschen Bundes. Nachdem die Reichsverfassung vom 16. April 1871 zum Großteil auf eben diesen Verfassungstext vom 1. Juli 1867 beruht8, sind für diese Untersuchung eben auch die Vorgänge um den Art. 17/2 der Verfassung des Norddeutschen Bundes vom 16. April 18679.
Bismarcks Entwurf sah zunächst nur den Bundesrat und den Reichstag als verfassungsmäßige Organe vor, wobei der Bundesrat als unverantwortliche Bundesregierung mit legislativen und exekutiven Befugnissen fungieren sollte. Die Institution des Bundeskanzlers sollte nach Vorbild des österreichischen Bundespräsidialgesandten mit parlamentarischer Tätigkeit geschaffen werden. Der Bundeskanzler sollte, quasi als Untergebener des preußischen Ministers des Auswärtigen, lediglich den Vorsitz und die Geschäftsführung des Bundesrates übernehmen. Die eigentliche Ausführung sollte jedoch bei den preußischen Ministerien liegen.
Naturgemäß stieß dieses Konzept einer unverantwortlichen Bundesregierung auf den Widerstand des nationalliberal dominierten Reichstages. Dem Reichstag schwebte vielmehr ein kollegiales Ministerium - Minister als politisch verantwortliche Ressortleiter verstanden - vor, was allerdings Bismarck vehement ablehnte, da er so eine zu große Einflußnahme des Reichstages auf die Bundesregierung fürchtete. Das Parlament könnte ja so dem Monarchen seine Minister aufzwingen10.
Nachdem zwei Anträge zur Einführung eben jenes Ministerkollegiums im Reichstag scheiterten, wurde von Bennigsen11 ein Antrag eingereicht, um wenigstens einen verantwortlichen Bundeskanzler zu erhalten. Gleichzeitig brachte auch der Alt- Liberale v. Sänger einen gleichlautenden Antrag ein, der allerdings auf eine verfassungsmäßige Regelung dieser Verantwortlichkeit verzichtete. So wurde am 27. März 1867 dieser Antrag „Bennigsen“ mit in den Verfassungstext aufgenommen. Inwiefern dieser Antrag von Bismarck selber initiiert worden ist (vgl. die These Otto Beckers 1952), darauf soll jetzt nicht näher eingegangen werden12.
Somit wurde der Grundstein gelegt zu einer Institution, der des Bundeskanzlers, der sowohl dem Reichstag als auch dem Bundespräsidium, dem preußischen König, gegenüber verantwortlich war. Am 12. August 1867 wurde durch Erlaß des preußischen Königs die Einrichtung eines Bundeskanzleramtes beschlossen, welches den Bundeskanzler bei der Verwaltung der dem Norddeutschen Bund obliegenden Aufgaben unterstützen sollte. Der Aufgabenbereich erstreckte sich über das Post- und Telegraphenwesen, dem Konsulatswesen, der Aufsicht über die den Einzelstaaten überwiesene Bundesverwaltung und die Bearbeitung der übrigen Bundesangelegenheiten, v. a. Zoll- und Handelspolitik, aber auch die Haushaltsplanung13.
Bereits 1870 kam die Aufsicht über das Konsularwesen zurück an das auswärtige Amt, das neben das Bundeskanzleramt als oberste Bundesbehörde tritt14. Während eben das Bundeskanzleramt für die Innenpolitik des Bundes zuständig war, so übernahm das aus dem preußischen Ministerium des Äußeren hervorgegangene auswärtige Amt die Bereiche der Außenpolitik.
Bemerkenswert bleibt, daß bei der Einrichtung des auswärtigen Amtes, obwohl es aus einem Ministerium hervorgegangen ist, weiterhin der Reichskanzler als alleinig verantwortlicher Minister die Bundesgeschäfte führte. Erstmals taucht hier der Rang des Staatssekretärs auf, der oberster Amtsleiter ist. Allerdings verblieb beim Bundeskanzler eben auch die Verantwortung für dieses Ressort15.
1.2. Der Übergang zur Reichsverwaltung
Nach der Reichsgründung 1871 wuchsen der nun als Reichskanzleramt bezeichneten obersten Reichsbehörde neue Aufgaben zu. Es ist nun ein kombiniertes Handels- und Finanzministerium16. Neben den bereits bestehenden Abteilungen I, für das Postwesen, und II, für das Telegraphenwesen, wurde eine neue Abteilung III für die Verwaltung des hinzugewonnenen Reichslandes Elsaß- Lothringen eingerichtet. Der Zentralverwaltung verblieb somit, neben den bereits zu Zeiten des Norddeutschen Bundes übertragenen Aufgaben17, außerdem noch die Eisenbahnverwaltung für das Reich.
Im Zuge des fortschreitenden Reichsausbaus wuchsen dem Reichskanzleramt, als dem Reichsamt schlechthin, immer mehr Aufgaben zu, so daß sich Bismarck genötigt sah, Teile der Verwaltung aus dem Reichskanzleramt als neue Reichsämter auszugliedern. Zudem konnte Bismarck durch diese Ausgliederungen (Schaffung neuer Reichsämter) dem Drängen der Liberalen auf Einführung von Reichsministerien, denen sich Bismarck 1867 mit Vehemenz entgegenstemmte, entgegenwirken18.
1873 wurde das Reichseisenbahnamt als neue Reichsbehörde geschaffen, indem die Angelegenheiten der Eisenbahnverwaltung aus dem Reichskanzleramt ausgegliedert wurden. 1874 setzte sich die Amtsleitung des Reichskanzleramtes, die Bismarcks „Zerlegungsplänen“ kritisch gegenüber stand, noch einmal durch, und die zentrale Justizbehörde des Reiches ressortierte als Abteilung IV im Reichskanzleramt. Mit dem Rücktritt des langjährigen Leiters des Reichskanzleramtes Delbrück19 wurde der Weg frei für eine weitere Umgliederung der obersten Reichsverwaltung. Am 1.1.1876 wurden die bisherigen Abteilungen I und II im neuen Amt des Generalpostmeisters (ab 1880 Reichspostamt) zusammengefaßt und aus dem Reichskanzleramt ausgegliedert. Zum 1. Juli des gleichen Jahres wurde die bisherige Abteilung III als Reichskanzleramt für Elsaß- Lothringen zu einem eigenen Amt erhoben, das 1879 im Ministerium für Elsaß- Lothringen aufging. 1877 wurde die IV. Abteilung als Reichsjustizamt zu einer eigenständigen Behörde. Im selben Jahr wurde eine neue IV. Abteilung im Reichskanzleramt geschaffen zur Verwaltung der Reichsfinanzen, die Keimzelle des zwei Jahre später entstandenen Reichsschatzamts. 1879 wurde das nunmehr zu einer Art Verwaltungsamt geschrumpfte Reichskanzleramt in Reichsamt des Inneren umbenannt. 1889 wird die Marineverwaltung als eigenständiges Reichsmarineamt aus der Kaiserlichen Admiralität (1872) ausgegliedert. 1907 folgte schließlich als letztes Reichsamt vor dem 1. Weltkrieg das Reichskolonialamt. Im 1. Weltkrieg enstanden außerdem noch das Reichsernährungsamt (1916), das Reichswirtschaftsamt (1917) und das Reichsarbeitsamt (ebenfalls 1917).
Bis 1890 war die oberste Reichsverwaltung im Großen und Ganzen voll ausgebildet, vom Reichskolonialamt einmal abgesehen. Allerdings folgte dieser Auf- und Ausbau keinem vorgegebenen Plan, sondern war durch die Person Bismarcks geprägt, der als alleinig verantwortlicher Minister, als Reichskanzler eben, auch die Leitung über alle Reichsämter inne hatte. Die eigentliche Ausführung sollte jedoch bei den preußischen Ministerien liegen20.
1.3. Das Stellvertretergesetz von 1878
Mit dem zunehmenden Ausbau der Verwaltung des Norddeutschen Bundes bzw. des Deutschen Reiches aufgrund der wachsenden Gesetzgebungs- und Verwaltungstätigkeit nahm auch die Belastung des Bundes- bzw. Reichskanzlers zu, der als alleinig verantwortlicher Minister das Recht der Kontrasignatur innehatte. Um dieser Überlastung wirkungsvoll zu begegnen, wurde zunächst mit kaiserlicher Genehmigung ein eigens bestellter Vertreter ernannt, der zur Unterzeichnung berechtigt war. Bis zu seinem Rücktritt 1876 hatte Delbrück diese Stellvertretung inne.
Nach Delbrücks Rücktritt übertrug Bismarck die Stellvertretung 1877 auf den Leiter des Reichskanzleramtes und den Leiter des Auswärtigen Amtes, jeweils für deren Geschäftsbereich. Als gegen diese verfassungsmäßig nicht geregelte Stellvertretung von nationalliberaler Seite her Zweifel aufkamen, beabsichtigte Bismarck die Frage der Stellvertretung durch eine reichsgesetzliche Regelung zu lösen. Der erste Entwurf sah zunächst die Vertretung des Reichskanzler durch Mitglieder des Bundesrates vor. Diese wären zwangsweise durch den preußischen Staatsminister beauftragt gewesen, was eine stärkere Verzahnung Preußens mit dem Reich bedeutet hätte21. Als nun gegen diesen Entwurf von Seiten der im Bundesrat vertretenen Mitgliedsstaaten Widerstand aufkam, da man eine Übermacht Preußens in der Reichsverwaltung durch diese Verbindung von Reichsämtern und preußischen Ministerien befürchtete, einigte man sich auf einen Kompromiß. Dieser besagte, daß die Stellvertretung nur durch die Vorsteher der obersten Reichsbehörden, sprich den Staatssekretären, wahrgenommen werden konnte. Nach der Lesung im Reichstag erreichte das Stellvertretergesetz schließlich am 17. März 1878 Gesetzeskraft.
Die Stellvertretung des Reichskanzlers wurde wie folgt geregelt22:
- Die Stellvertretung ist dann gegeben, wenn der Kanzler an der Ausübung seine Amtes behindert ist.
- Der Kanzler erhält einen Generalstellvertreter (Vizekanzler)23 für den gesamten Umfang der Geschäfte, sowie Ressortstellvertreter.
- Es bleibt dem Kanzler vorbehalten, „jede Amtshandlung auch während der Dauer einer Stellvertretung selbst vorzunehmen“.
D. h. der Kanzler blieb auch weiterhin alleinig verantwortlicher Reichsminister, und er konnte weiterhin in die Geschäfte der obersten Reichsbehörden eingreifen. Die Behinderung des Reichskanzler wurde auch dann als gegeben angesehen, wenn „der große Umfang an Geschäftslast“ bzw. „der Mangel technischer Ressortkenntnisse“ den Kanzler zwangen Stellvertreter zu berufen. Somit wurde die im Gesetz als Ausnahme vorgesehene Stellvertretung zu einer Dauereinrichtung des Bismarckreiches24. Die Leiter der obersten Reichsbehörden, die Staatssekretäre, wurden damit zu „quasi Reichsministern“, die „Kanzlerqualität innerhalb der gesetzlicher Schranken“ erhielten. Durch das Festhalten an der alleinigen Verantwortlichkeit des Kanzlers wurde auch nicht die Tür in Richtung eines Ministerkollegiums geöffnet25.
Um den „quasi Reichsministern“ die Möglichkeit zu eröffnen, für ihr Ressort vor dem Reichstag Rede und Antwort zu stehen, wurden diese zu preußischen Bundesratsbevollmächtigten ernannt, da nur solche vor dem Reichstag Rederecht hatten. Dies bedeutete einen weiteren Ausbau der Selbständigkeit der Reichsämter26.
1.4. Die Weiterentwicklung der Reichsverwaltung nach Bismarck
War somit27 unter Bismarck die wesentliche Gestalt der Reichsverwaltung geschaffen worden, so gab es unter seinen Nachfolgern keine tiefgreifenden organisatorischen Veränderungen28. Was sich änderte, geschah im vorgegebenen Rahmen. So verselbständigten sich die Reichsämter unter Bismarcks unmittelbaren Nachfolgern Caprivi29 und Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst30 immer stärker, was durch starke Persönlichkeiten unter den Staatssekretären noch begünstigt wurde. Erst unter Bülow31 konnte diese „Ressortanarchie“ wieder beseitigt werden. Allerdings war die Reichsleitung nun verstärkt auf Verhandlungen mit dem Reichstag angewiesen, da sie für die erfolgreiche Durchführung ihrer Vorhaben die Zusammenarbeit mit dem Reichstag benötigte und so immer wieder neu Mehrheiten suchen mußte.
Auch begann man damit gemeinsame Besprechungen (Reichskanzler und Staatssekretäre) durchzuführen.
Kommandierender General des X. Armeekorps in Hannover. 1890-94 Reichskanzler, 1890-92 auch preuß. Ministerpräsident.
2. Der Beginn der deutschen Kolonialverwaltung
Als sich32 Bismarck 1884 entschied, den Weg zu einer formellen Kolonialherrschaft einzuschlagen33, kam zwangsläufig die Frage auf, wie die neu erworbenen Gebiete zu verwalten seien. Der Geheime Legationsrat von Kusserow34, der als Dezernent in der handelspolitisch- und staatsrechtlichen Abteilung II im Auswärtigem Amt für die „Handelsbeziehungen zu Asien, Afrika, Australien, Angelegenheiten der deutschen Flotte“ und dabei auch für die mit der europäischen kolonialen Expansion zusammenhängenden Fragen zuständig war, lieferte dazu eine Denkschrift, in der er sich für eine Verwaltung durch Handelsgesellschaften nach Vorbild der britischen „royal charter“ aussprach35. Da dieses System Bismarcks Wünschen nach einer eher zurückhaltenden Rolle des Deutschen Reiches in der Verwaltung der Kolonien entsprach36, machte sich Bismarck diesen Vorschlag zu eigen und man begann damit Handelsgesellschaften in den neu erworbenen Gebieten zu gründen, denen die Verwaltungstätigkeit in ihrem ihnen zugewiesenem Gebiet oblag37.
Allerdings zeigte sich recht rasch, daß der deutsche Überseehandel, speziell die in Westafrika tätigen Handelshäuser, nicht gewillt war, dem Reich diese Aufgabe abzunehmen, so daß man gezwungen war, schon 1885 den ersten Gouverneur in Kamerun einzusetzen.
Sah Bismarcks Verwaltungssystem also zunächst eine direkte Verwaltung der Schutzgebiete38 durch eben solche Handelsgesellschaften vor, so daß als Zentralverwaltung in Berlin lediglich eine kleine Abteilung im Auswärtigen Amt, zu Beginn nur ein Mann, nämlich von Kusserow, ausreichen sollte, zeigte sich nun, daß man die Zentralverwaltung ausweiten mußte, um den Anforderungen, die durch die Kolonialpolitik hinzukamen, Genüge zu leisten. So konnte von Kusserow sein Referat mehr und mehr ausbauen, bis schließlich am 19. Februar 1885 sein Referat, zuständig für „Kolonialangelegenheiten und Entsendung von Kriegsschiffen zum Schutz deutscher Interessen“, von der Abteilung II zur politischen Abteilung I A des Auswärtigen Amtes trat. Im Juni 1885 wurde er von Richard Krauel39 abgelöst, da er als erwiesener „Kolonialenthusiast“40 Bismarck nicht geeignet schien, das Referat in „neutraler“ Weise zu leiten. Zudem erschien er Bismarck als „übereifrig“41. Die ersten sechs Jahre, die man mit Spidle als „Jahre des Experimentierens“42 bezeichnen kann, waren geprägt von einer langsamen Gewöhnung sowohl der deutschen Bevölkerung als auch der Kolonialverwaltung an die neuen Gebiete43. So war auch in den ersten Jahren die Verwaltungstätigkeit sehr gering, wichtige Regelungen betrafen vor allem den Landerwerb und Landbesitz sowie die Anwerbung afrikanischer Arbeiter und die Kontrolle darüber.
1886 wurde schließlich das Gesetz zur „Regelung der Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzgebieten“ erlassen, in dessen erstem Paragraphen das umfassende Verordnungsrecht des Kaisers in den Schutzgebieten geregelt wird44. Dieses Gesetz regelte somit auch die Zuständigkeit der Verantwortung für die Kolonialverwaltung. Als ausführendes Organ der kaiserlichen Verfügungen war der Reichskanzler der verantwortliche „Kolonialminister“45.
3. Die Kolonialabteilung im Auswärtigem Amt
3.1. Die Gründung der Kolonialabteilung
Als 1888/89 in Deutsch-Ostafrika der Araberaufstand ausbrach und in den Kreisen der „Kolonialenthusiasten“ sich Enttäuschung über die, ihrer Ansicht nach, zu geringen Fortschritte in den Kolonien laut wurde, erwuchs aus ihren Reihen die Forderung nach einem eigenständigen Amt für die Kolonien. Da sie mangelnde Führung und unzureichende finanzielle Unterstützung durch das Reich als schwerwiegendste Verfehlungen ausmachten, hofften sie so, diese Mißständen zu beseitigen46.
Nachdem sich der Kolonialagitator Friedrich Fabri47 1889 mit seiner Schrift „Fünf Jahre deutscher Kolonialpolitik: Rückblick und Ausschau“ in der Kolonialdebatte zurück meldete, sah man sich auf Seite der Regierung veranlaßt tätig zu werden. Auch Bismarck selbst sah die Notwendigkeit einer Neuordnung der Kolonialverwaltung, allerdings mehr noch aufgrund der überbordenden Verwaltungstätigkeit als aufgrund nicht erfüllter Erwartungen über die Entwicklung der Schutzgebiete48. Dafür war Bismarck zu sehr Realist.
So begann man schon unter Bismarck die Aufwertung des bisherigen Referates für überseeische Angelegenheiten zu einer eigenständigen Abteilung des Auswärtigen Amtes vorzubereiten. Allerdings bedingte Bismarcks Entlassung (20. März 1890), daß die Gründung der Kolonialabteilung im Auswärtigem Amt als IV. Abteilung am 1. April 1890 erst unter seinem Nachfolger Caprivi erfolgen konnte. Am 1. Juli 1890 wurde der Helgoland-Sansibar-Vertrag mit Großbritannien ratifiziert, in dem das Deutsche Reich für den Besitz Helgolands auf Ansprüche in Ostafrika (Somali-Küste, Witu-Land, Uganda, Sansibar und Pemba) verzichtete. Dieser Vertrag stieß bei den „Kolonialenthusiasten“ auf Ablehnung, da sie in ihm eine Aufgabe der Weltpolitik sahen, die für sie in engem Zusammenhang mit den Erwerb von Kolonien stand. So ist die Gründung der Kolonialabteilung auch in Zusammenhang mit dem Helgoland-Sansibar-Vertrag zu sehen als ein Versuch, die aufgebrachten „Kolonialenthusiasten“ mit der Politik des Reiches zu versöhnen49. Indem man ihnen in diesem Punkt nachkommt, versuchte man ihnen zu erleichtern, „die schwere Kröte“ Helgoland-Sansibar zu schlucken.
Doch zunächst zur Struktur der neu entstandenen Kolonialabteilung.
3.2. Verwaltungsaufbau der Kolonialabteilung
Bei ihrer Gründung 1890 zählte die Kolonialabteilung 11 Mitarbeiter unter der Leitung des Dirigenten Dr. Krauel50:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Kolonialabteilung war in folgende Referate aufgeteilt51:
I. Kamerun und Togo
II. Südwestafrikanisches Schutzgebiet
III. Schutzgebiete in der Südsee (Samoa, Tonga)
IV. Ostafrika und Sansibar
V. Dienstrechtliche Angelegenheiten der Beamten in den Schutzgebieten (Personalabteilung)
VI. Etat- und Rechnungsangelegenheiten (Finanzabteilung)
Die Referatsleiter wurden vom auswärtigem Amt gestellt, die Hilfsarbeiter, Expedienten und das Kanzleipersonal rekrutierten sich aus den verschiedensten Verwaltungen. Zu dem neuen Personal zählten auch Offiziere und Unteroffiziere. 1896 kam dann noch die Verwaltung der Schutztruppen hinzu mit drei Offizieren, die von einer eigenen Abteilung in der Kolonialabteilung übernommen wurde. Im Laufe der Jahre erweiterte sich der Geschäftsbereich der neuen Abteilung beträchtlich. Waren es 1890 8700 Eingänge, so waren es im Jahre 1898 bereits 28000 und 1905 mehr als 50000. Gleichzeitig wuchs die Abteilung bis sie 1906 102 Beamte in der Zivilverwaltung und 71 Beamte und Offiziere zur Verwaltung der Schutztruppe umfaßte. Schließlich war sie zu einer Größenordnung gewachsen, wie sie manche Reichsämter, z. B. das Reichsjustizamt, nicht besaßen. Da man beim Aufbau der Beamtenschaft auf die Unterstützung anderer „Fachministerien“ angewiesen war, um die entsprechenden Experten für die vielschichtige Kolonialverwaltung zu bekommen, war diese Beamtenschaft oft nur aus zweitrangigen Beamten zusammengesetzt, weil die Dienststellen, die diese abstellen mußten natürlich darauf bedacht waren, ihre besten Männer selbst zu behalten52. Zudem hatte die Kolonialabteilung unter den Beamten einen schlechten Ruf, da man dort den stetigen Anfeindungen des Reichstages und der kolonialinteressierten Öffentlichkeit ausgesetzt war, die ihnen Assessorismus d. h. zuviel Bürokratismus und zuviel Zentralisierung der Verwaltung vorwarfen53.
3.3. Politik der Kolonialabteilung
Der Aufwertung zur eigenständigen Abteilung folgte recht bald ein Leitungswechsel. Am 29. Juni 1890 übernahm der Jurist Paul Kayser54 die Leitung der Kolonialabteilung. Unter seiner Führung wurden wichtige Schritte in der Verwaltung der Kolonien unternommen. Entgegen einer sich mehr und mehr ausbreitenden „Kolonialmüdigkeit“, einem zurückhaltenden Reichstag und einem an den Schutzgebieten desinteressierten Kanzlers konnte Kayser doch einige Fortschritte verbuchen55. Die Kolonialgesetzgebung, der Beginn des Aufbaus einer Infrastruktur in den Schutzgebieten, die Ausweitung der Missionstätigkeit und die Aufnahme der sogenannten „Konzessionspolitik“, das Überlassen ganzer Landstriche an einzelne Gesellschaften zur Ausbeutung mit gleichzeitig ausgedehnter Rechtshoheit, sind nur einige seiner Schwerpunkte.
Das Deutsche Kolonialblatt, 1890 zum ersten Mal erschienen, wurde zum Veröffentlichungsorgan der Kolonialabteilung.
Eine der wichtigsten Entscheidungen in seiner Amtszeit war die Einrichtung eines Kolonialrates56 am 10.10.1890, durch den die Verknüpfung zwischen Kolonialverwaltung und Kolonialinteressen gewährleistet werden sollte. Dies zeigt sich auch an der Zusammensetzung des Kolonialrates, in dem unter Vorsitz des Dirigenten der Kolonialabteilung Vertreter der in den Kolonien tätigen Handelsgesellschaften, Vertreter der Deutschen Kolonialgesellschaft57 im Reich, Vertreter der Missionsgesellschaften und Vertreter aus Presse und Wissenschaft zusammen kamen, um der Kolonialverwaltung mit ihrem Rat und Sachverstand zur Seite zu stehen. War der Kolonialrat zunächst als beratendes Gremium mit neunzehn vom Kanzler vorgeschlagenen Mitglieder gedacht, das sich ein- bis zweimal im Jahr traf, so entwickelte es sich bis 1901 zu einem Gremium von vierzig Mitgliedern, so daß der bisherige Arbeitsstil in camera nicht mehr beibehalten werden konnte und sich Ausschüsse bildeten. Der Kolonialrat nahm die Form eines kleinen Parlaments an, was auf Widerstand im Reichstag, dem Parlament des Reiches, stieß, so daß der Kolonialrat wiederholt Angriffen des Reichstags ausgesetzt war. Auch der Kolonialrat war ein Mittel zur Besänftigung der Gegner des Helgoland-Sansibar-Vertrages58.
1892 bereiste Kayser Ostafrika und besuchte Sansibar und die Küste DeutschOstafrikas. Es war das erstemal und das einzige Mal vor Dernburg, daß ein Vertreter der Zentralverwaltung die Kolonien besuchte.
Im gleichen Jahr erhielt der Reichstag das Budgetrecht über die Schutzgebiete zugesprochen, so daß nunmehr eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Reichstag von Nöten war59.
1894 wurde durch kaiserliche Order die gesamte Verwaltung der Schutzgebiete, einschließlich aller Behörden und Beamten, der Kolonialabteilung unterstellt. Der Reichskanzler war unmittelbar für die Kolonialabteilung verantwortlich. Nur in Fragen, die die Außenpolitik berührten, war man dem Auswärtigem Amt unterstellt. Die Kolonialabteilung bildete somit eine dem Auswärtigem Amt gleichgeordnete Behörde. Allerdings blieb ihr der Status einer obersten Reichsbehörde verwehrt60. Waren also zuvor die verschiedensten Reichsbehörden für Teilaspekte der Schutzgebiets- verwaltung zuständig, vor allem Reichspostamt, Reichsschatzamt und Reichsmarineamt, so wurden nunmehr alle Zuständigkeiten unter dem Dach der Kolonialabteilung gebündelt. Gleichzeitig erfuhr das Amt des Leiters der Kolonialabteilung eine Aufwertung, Kayser wurde nunmehr Direktor.
Durch das Schutztruppengesetz 1896 wurden die Truppen, die bisher dem Reichsmarineamt unterstellt waren, der Kolonialabteilung unterstellt. So wurden etwaige Unstimmigkeiten zwischen Zivil- und Militärverwaltung beseitigt. Im Zuge des Kolonialskandals um Peters61 trat Kayser von seinem Amt als Direktor zurück. Sein Nachfolger wurde von Richthofen62, ein Mann von dessen Erfahrungen in der ägyptischen Schuldenverwaltung und seinen Beziehungen zur Geschäfts- und Finanzwelt man sich einen Schub für die Kolonialverwaltung erhoffte. Eine Hoffnung, die allerdings enttäuscht wurde. Ohne der Kolonialabteilung neue Impulse geben zu können, wurde er 1898 Unterstaatssekretär im Auswärtigem Amt. Auf von Richthofen folgte der in Kolonialkreisen unbekannte von Buchka63, der bis dato lediglich durch seine Mitgliedschaft in der DKG mit der Kolonialpolitik in Berührung gekommen war. Seine Amtszeit war geprägt durch eine ausufernde „Konzessionspolitik“64, die neben den hohen Ausgaben und aufgedeckten Mißständen im Juni 1900 zu seinem Abschied führten.
Mit Stübel65 begann ein allmähliches Umdenken in der Kolonialverwaltung. Nicht nur daß unter ihm verstärkt der Eisenbahnbau angegangen wurde, auch die Dezentralisierung der Kolonialverwaltung wurde vorbereitet. Die plötzlich einsetzende Ruhe um die Kolonien, verursacht durch die Ereignisse in China und Südafrika im gleichen Jahr (Boxeraufstand und Burenkrieg), erleichterte erheblich die Arbeit der Zentralverwaltung. Mit der einsetzenden wirtschaftlichen Sanierung der Kolonien konnte auch privatwirtschaftliches Kapital zur Investition in den Kolonien gewonnen werden, so daß man von der stark kritisierten „Konzessionspolitik“ abrücken konnte. Zudem legte man verstärkt Wert auf die Ausbildung der Kolonialbeamten, die bisher bei Amtsantritt nur in den seltensten Fällen mit den Kolonien und dem für die Kolonialverwaltung wichtigen Handwerkszeug (Landeskunde, Volkswirtschaft, usw.) in Berührung gekommen waren.
Allerdings bereiteten der plötzlich ausbrechende Aufstand in Südwestafrika 1904 und die darauffolgenden Angriffe des Reichstags auf von Stübel und seine Abteilung seinen „kolonialen Flitterwochen“66 ein rasches Ende und im November 1905 trat von Stübel von seinem Amt zurück.
Sein Nachfolger ad interim wurde Erbprinz Ernst zu Hohenlohe-Langenburg67. Eher eine Verlegenheitslösung als der von vielen gewünschte starke Mann war der „arme kleine Erni“68 nicht in der Lage die Kolonialabteilung durch die gefahrvollen Gewässer der Kolonialkrise von 1905/06 zu steuern.
4. Dernburg und die Kolonialkrise
4.1. Die Kolonialkrise 1905/06
Als sich im Januar 1904 die Hereros in Deutsch-Südwestafrika gegen die Deutschen erhoben, bildete dies den Auftakt zum ersten Krieg der wilhelminischen Ära. Nachdem die Deutschen in einem Vernichtungsfeldzug die Hereros in der Schlacht am Waterberg und der nachfolgenden Vertreibung in die Omaheke-Wüste aufgerieben hatten, griffen die Hottentotten in die Kämpfe ein, mit eine Folge aus der Vernichtungsstrategie der Deutschen, die allen Schwarzen die gleiche Behandlung wie den Hereros versprochen hatten69.
Begrüßte die deutsche Öffentlichkeit zunächst das harte Vorgehen der Schutztruppen, hatten doch die Hereros 162 Siedler und Soldaten zu Beginn der Erhebung grausam getötet, so wandelte sich diese Meinung im Laufe der Zeit. Mit dem Bekanntwerden der Vernichtungsstrategie von Trothas70, dem Einsatz der deutschen Schutztruppe, ihrer massiven Verstärkung und der Erhöhung der Ausgaben zur Niederschlagung des Aufstandes machte sich in Deutschland Unmut über die Verfehlungen in der Kolonialverwaltung breit. Als 1905 noch der Maji-Maji- Aufstand in Deutsch-Ostafrika ausbrach, wertete man das als Zeichen des totalen Versagens der deutschen Kolonialverwaltung. Zu beiden militärischen Kampagnen, die aufgrund einer falschen Kolonialpolitik notwendig wurden, traten immer mehr Kolonialskandale über Fehlverhalten deutscher Soldaten und Siedler hinzu.
Die Aufdeckung ebendieser Skandale im Reichstag durch den jungen Zentrumsabgeordneten Erzberger71 führte zu einer Verschärfung der Stimmung gegen die Kolonialpolitik des Deutschen Reiches. Der Reichstag wurde quasi zum „Gerichtshof für Kolonialskandale“72. Das Zentrum im Verbund mit den Sozialdemokraten attackierte in der Folgezeit die Kolonialpolitik der Regierung. Zu Hohenlohe-Langenburg war dieser massiven Kritik nicht gewachsen. Vorwürfe der Mißhandlungen Eingeborener, Rückendeckung für die Täter durch die Kolonialabteilung, Verträge, die ohne Ausschreibung des Wettbewerbs mit bestimmten Gesellschaften ausgehandelt waren, zum Nachteil der Staatskasse, all dies kumulierte sich zu einer Forderung nach einer „neuen“ Kolonialpolitik73.
Im März 1906 brachte der Reichstag drei Vorlagen der Regierung zu Fall, die die Unterwerfung des Aufstandes in Südwestafrika (zur Unterhaltung der Schutztruppe, für den Bau einer Eisenbahnlinie im Süden der Kolonie und Schadensersatzzahlungen an Siedler) betrafen, d. h. er strich sie im Rahmen seines Budgetrechts zusammen. Schließlich im Mai 1906 verweigerte der Reichstag die Zustimmung zur Umstrukturierung der Kolonialabteilung zu einem Kolonialamt, da man sich mit zu Hohenlohe-Langenburg keine wirkungsvolle Kolonialreform vorstellen konnte. Der Reichskanzler von Bülow sah sich nun ernsthaft gezwungen, eine Kolonialreform mit dem richtigen Mann an der Spitze voranzutreiben. Mit dem Rücktritt von zu Hohenlohe-Langenburg am 3. September 1906 wurde der Weg frei zur Ernennung Bernhard Dernburgs74.
4.2. Die Hottentotten-Wahlen 1907
Die Ernennung Dernburgs kam für viele überraschend. Mit seiner Wahl kam Bülow einer der Forderungen der „Kolonialenthusiasten“ nach. Man wünschte sich für die schwierige Aufgabe in der Kolonialabteilung endlich einen Mann mit Wirtschaftsverstand. Davon besaß Dernburg augenscheinlich eine Menge. Sein Praktikum in New York, seine Tätigkeit bei der Deutschen Treuhandgesellschaft75 und seine erfolgreiche Tätigkeit als Direktor der Darmstädter Bank76 wiesen seine Wirtschaftskompetenz nach. Er galt als Mann der Freisinnigen (Linksliberalen), obwohl er bisher nie politisch in Erscheinung getreten war und kein Parteimitglied war. Bei der Treuhandgesellschaft war er als Sanitätsrat aktiv, d. h. er war ein Experte in der Umstrukturierung von Betrieben, was ihn als außerordentlich geeignet zur Reform der Kolonialabteilung erscheinen ließ77.
In seinen ersten Wochen im Amt verschaffte er sich einen Überblick über seine Mitarbeiter und ihre Fähigkeiten, um es von inkompetenten und korrupten Beamten zu säubern, die ja mit ein Grund für die starke Kritik der Öffentlichkeit darstellten78. Eines seiner Ziele war es die Deutschen von der Wichtigkeit der Kolonien zu überzeugen, nicht nur als Objekte zur Bestätigung des Nationalgefühls, sondern auch als zukunftsträchtige Wirtschaftsräume. Dernburg kündigte an, sobald als möglich sich selbst ein Bild von den Kolonien zu machen.
Als der Reichstag, nach der Sommerpause, im November 1906 wieder zusammentrat, legte ihm Dernburg zwei Denkschriften vor. In diesen gab er einen Überblick über das Entwicklungspotential der Schutzgebiete zum Besten. Untermauert mit Tabellen, Diagrammen und Statistiken sollten sie den Reichstag und die Wirtschaft zu einem stärkeren Engagement in den Schutzgebieten ermuntern. Diese Rentabilitätsberechnungen waren allerdings „frisiert“ - man nahm die Ausgaben zur Niederschlagung der Aufstände als Reichsausgaben aus der Statistik
- und zeigten so eine günstige Prognose für die Entwicklung der Kolonien und des in ihnen angelegten Kapitals79.
All diese Dinge zusammen - das energische Wirken Dernburgs, das Aufräumen mit den alten Skandalen, die augenscheinlich ökonomisch planende neue Politik der Kolonialabteilung, die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit - bereiteten der Kolonialpolitik für die folgenden Auseinandersetzungen im Reichstag einen guten Boden. Ende November 1906 brachte die Regierung erneut zwei Vorlagen in den Reichstag, die ähnlich wie im März des gleichen Jahres den Unterhalt der Schutztruppe und den Bau einer Eisenbahnlinie betrafen. Von Bülow nutzte diese Eingaben als Bühne zur Einführung Dernburgs. Dernburg legte in seiner Jungfernrede das Konzept seiner Reformpolitik vor. Beseitigung der Mißstände, eine nach ökonomischen Gesichtspunkten arbeitende Verwaltung, Gewinnung der Unterstützung der Öffentlichkeit und zunächst als ersten Schritt der Aufbau einer geeigneten Beamtenschaft für die Kolonialabteilung sah sein Programm vor. Erzberger, der Wortführer der kolonialkritischen Stimme, äußerte wohlwollende Kritik zu Dernburgs Plänen. Doch legte sich Dernburg auch mit dem Zentrum an, dem er vorwarf in die Personalpolitik der Regierung Einfluß zu nehmen. Die Auseinandersetzung gipfelte in dem Satz Dernburgs:
„..., nachdem ich mir ernsthaft überlegt habe, daß die Eiterbeule, die da war, aufgestochen werden müßte, - und ich habe sie aufgestochen, und ich trage ganz gern die Konsequenzen!“80
Dieses bestimmte Auftreten Dernburgs brachte ihm den Beifall der breiten Öffentlichkeit ein und wurde mit der Schlagzeile „Endlich ein Mann!“81 gewürdigt, der echten bismarckschen Geist zeigte. Bei der Abstimmung am 13. Dezember 1906 stimmte eine Mehrheit von 177:168 gegen die Regierungsvorlagen. Gleich nach der Bekanntgabe des Ergebnisses verlas Bülow die kaiserliche Verordnung zur Auflösung des Reichstages82.
Dies war der Auftakt zu den nun folgenden Wahlen, die unter dem Stichwort „Hottentottenwahlen“ bekannt werden sollten. Dernburg beteiligte sich mit zahlreichen Auftritten am nun einsetzenden Wahlkampf. Neben der Wahlpropaganda für eine Regierungsmehrheit im Reichstag nutze Dernburg den Wahlkampf als Bühne für seine kolonialpolitischen Vorstellungen und warb für ein stärkeres Bewußtsein für die Kolonien.
Das Ergebnis der Wahl war für die Regierung außerordentlich erfreulich, zwar konnte das Zentrum seine Sitzanzahl behaupten, doch die Verluste auf Seiten der Sozialdemokraten brachten dem Regierungsblock aus Nationalliberalen, Konservativen und Freisinnigen die Mehrheit der Sitze im Reichstag.
5. Das Reichskolonialamt
5.1. Gründung des Reichskolonialamte
So mit einer kolonialfreundlichen Regierungsmehrheit im Reichstag ausgestattet, konnte man an die Umgestaltung der Kolonialabteilung gehen. Im Mai 1907 wurden endlich die oben bereits erwähnten Vorlagen vom Reichstag genehmigt und zugleich am 17. Mai 1907 die Kolonialabteilung zu einem eigenständigen Reichskolonialamt umgestaltet. Erster Staatssekretär des neuen Reichsamtes wurde , wer sonst kam schon in Frage, Bernhard Dernburg. Friedrich von Lindequist wurde am 23.Juni 1907 sein Stellvertreter als Unterstaatssekretär.
5.2. Verwaltungsaufbau des Reichskolonialamtes
Die 83personelle Ausstattung des Amtes wurde beträchtlich erweitert. Neben den Staatssekretär als Amtsleiter traten ein Unterstaatssekretär, ein Direktor und ein Dirigent (1913 ein weiterer) als Abteilungsleiter. Die Struktur der Verwaltung wurde nach fachspezifischen Anforderungen umgestaltet. Vier Abteilungen wurden gebildet:
Abt. A Politische, allgemeine Verwaltungs- und Rechtsangelegenheiten der Schutzgebiete unter Leitung des Unterstaatssekretärs (seit 1913 des Direktors)
Aufgaben:, Gesetzgebung, Behördenorganisation, Beaufsichtigung der Rechtspflege in den Schutzgebieten, Rechtshilfesachen; Angelegenheiten der Polizei und innerer Verwaltung; hygienische, medizinische und Veterinär-Versorgung; Landvermessung; Missions- und Schulwesen; Statistik, Jahresberichte, Kolonialblatt; Land- und Forstwirtschaft, Schiffahrt, Post- und Telegraphiewesen.
Abt. B Finanzen, Bauwesen, Verkehrsangelegenheiten und sonstige technische Angelegenheiten unter Leitung des Direktors(seit 1913 eines Dirigenten)
Aufgaben: Etat-, Kassen- und Rechnungswesen; Münz- und Währungsverhältnisse; Versicherungswesen; Eisenbahnwesen, Bauwesen, Wassererschließung, Verkehrswesen; Beschaffungswesen.
Abt. C Personalangelegenheiten unter der Leitung eines Dirigenten
Aufgaben: Organisation der Zentralverwaltung, Personalwesen einschließlich Disziplinarangelegenheiten
Abt. M Militärverwaltung (Kommando der Schutztruppe) unter Leitung eines Oberst/ Kommandeur der Schutztruppe
Aufgaben: alle rein militärische Angelegenheiten der Zentralverwaltung und der Schutzgebiete
1911 setzte sich das Reichskolonialamt (RKA) aus folgenden höheren Beamten zusammen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Abteilung M setzte sich wie folgt zusammen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Reichskolonialamt besaß somit die Verfügungsgewalt über alle Kolonialgebiete mit Ausnahme des Pachtgebietes Kiautschou, das weiterhin dem Reichsmarineamt unterstellt blieb.
5.3. Politik des Reichskolonialamte
5.3.1. Die Reformen Dernburg
Mit Dernburg ging man den Weg weg von einem „Zerstörungskurs“ hin zu einem „Erhaltungskurs“ in der Kolonialpolitik84. Zunächst trat Dernburg im Juni 1907 sein bereits im Wahlkampf angekündigte Informationsreise an, und zwar führte sie in nach Ostafrika. Innerhalb von drei Monaten bereiste er mit seinen Begleitern, zu denen neben seinem Freund Rathenau85, verschiedenen Sachverständigen aus der Reichsverwaltung, auch Industrielle sowie ein Fotograf, ein Landschaftsmaler und sieben Journalisten gehörten, Ostafrika. Dar-es-Salam, Sansibar, Britisch-Ostafrika sowie das Landesinnere des deutschen Schutzgebietes galt es einen Besuch abzustatten. Unter Führung des Gouverneurs Rechenberg86, dessen Politik auf eine Förderung der „cash crop“-Produktion der Eingeborenen und dem damit verbunden Bau einer Zentralbahn zielte, wurde vor allem die Reise durch Deutsch-Ostafrika durchgeführt. Seine Routenplanung führte vorwiegend durch die Gebiete der Eingeborenenkulturen und sparte die Plantagen- und Siedlungsgebiete weitgehend aus. Dernburg machte sich die Vorstellungen des Gouverneurs zu eigen, da sie sich auch weitgehend mit seinen eigenen Vorstellungen deckten87. Im Sommer 1908 bereiste Dernburg wiederum den schwarzen Kontinent. Diesmal quer durch Südafrika. Mit dem Besuch des britisch verwalteten Südafrikas verband er die Möglichkeit Einsicht in die britische Verwaltungstätigkeit in diesem Gebiet zu nehmen. Neben dem Besuch in den Diamantengebieten von Kimberley und Pretoria standen vor allem die Eingeborenen- und die damit verbundene Arbeiterpolitik im Zentrum. In Deutsch-Südwestafrika besuchte man die neu entdeckten Diamantenvorkommen bei Lüderitzbucht.
Nachdem sich Dernburg nun selbst einen Überblick über die Kolonien an Ort und Stelle verschafft hatte, konnte man nun an die Verwirklichung der angekündigten Reform gehen, die schon Ende 1907 von der Presse mit der Forderung „Auf Dernburgs Reden Dernburgs Taten“88 eingefordert wurde.
5.3.1.1. Die Verwaltungsreformen
Durchliefen zu Beginn die meisten Beamten im Kolonialdienst eine reine juristische Ausbildung in Deutschland, die die Grundlage zu einer Karriere im deutschen Beamtentum legte, so begann im Laufe der Zeit allmählich neben den reinen Juristen eine bereits mit in den Kolonien gesammelten Erfahrungen beschlagene Beamtenschaft sich herauszubilden. Allerdings waren die meisten Neulinge in der Kolonialverwaltung nur sehr wenig beschlagen mit eben diesen Erfahrungen, so daß sich die Frage einer kolonialspezifischen Ausbildung stellte: „Die Beamten sollten eine wirtschaftliche Vorbildung erhalten, afrikanische Sprachkenntnisse erlernen und eine längere Zeit als bisher an demselben Ort arbeiten, um Land und Leute kennenzulernen.“89 Zu diesem Zweck wurden die neuen Beamten nach Berlin zur Ausbildung ans Seminar für Orientalische Sprachen und an die Handelshochschule geschickt bzw. an das am 20. Oktober 1908 in Hamburg gegründete Kolonialinstitut, das auf eine Anregung Dernburgs zurückging.
Dernburg zielte auf „die Schaffung einer leistungsfähigen, in guter Tradition erwachsenen, verläßlichen und dem Heimatlande treu ergebenen Beamtenschaft“90. Bisher war die Stellung der Kolonialbeamten nicht verläßlich gesetzlich geregelt, so daß das Kolonialbeamtentum im Vergleich zum Reichsbeamtentum auf wackeligen finanziellen Beinen stand. Erst mit dem Kolonialbeamtengesetz von 8. Juni 1910 konnte diesem Mißstand abgeholfen werden.
Am 17. Februar 1908 wurde schließlich der arg kritisierte Kolonialrat durch kaiserlichen Erlaß aufgelöst, und dem Staatssekretär im Reichskolonialamt die Schaffung geeigneter Fachkommissionen zugebilligt91.
Dernburgs Pläne sahen eine weitgehende Selbstverwaltung der Kolonien vor, bei der auch die weiße Bevölkerung auf kommunaler Ebene mitwirken sollte, solange diese Mitwirkung nicht der finanziellen Autonomie und der damit verbundenen administrativen Unabhängigkeit der Kolonie im Wege stand. Aus diesem Grund wurden auch am 1. April 1909 die bereits bestehenden Kommunalverbände in Deutsch-Ostafrika mit Ausnahme von Dar-es-Salam und Tanga für aufgelöst erklärt. Sobald die Schutzgebiete ohne Reichshilfe auskamen, sollte sie ihre Finanzen selbst verwalten können. Solange das Reich aber für einen beträchtlichen Teil de Schutzgebietshaushalts aufkommen mußte, sollte es auch über diese Gelder entscheiden können.
Deutsch-Südwestafrika war allerdings als Siedlungskolonie ein grundlegend anderer Fall. Anfang 1909 wurde eine Selbstverwaltungsverordnung erlassen, die neben der kommunalen Selbstverwaltung auch einen Landesrat als Verwaltungseinheit für da gesamte Schutzgebiet vorsah, der schließlich 1913 beschränkte Gesetzgebungskompetenzen erhielt.
Im Finanzwesen erhielten die Kolonialbehörden „vermehrte Befugnisse: Die Finanzverwaltung der afrikanischen Kolonien wurde in die Schutzgebiete verlegt, die Rechnungsvorprüfung- und abnahme beim Gouvernement selbst vorgenommen und nur durch Kommissare des Rechnungshofes nachgeprüft. Zivil- und Militärausgaben figurierten fortan getrennt in den Haushalten der einzelnen Schutzgebiete. Während das Reich die Deckung der Militärausgaben übernahm [eine Rechnung die Dernburg bereits bei der Werbung für seine „neue“ Kolonialpolitik vollzog], sollten die Zivilausgaben von den Kolonien selber getragen werden.“92
Um den Finanzbedarf der Kolonien decken zu können, wurde am 18. Mai 1908 ein Anleihegesetz für Kolonialanleihen erlassen, das eine Reichsgarantie für die Kolonialanleihen schuf. Seit 1909 war die finanzielle Selbstverwaltung in weiten Teilen des deutschen Kolonialreiches Realität.
5.3.1.2. Die Wirtschaftspolitik
In der Wirtschaftspolitik zielte Dernburg auf einen verstärkten infrastrukturellen Ausbau der Kolonien, um Kapital in die Kolonien zu locken. Wichtigster Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur war die verkehrsmäßige Erschließung durch Eisenbahnen93. Anfang 1905 waren 479 Eisenbahnkilometer in Betrieb, 1907 waren es rund 1390 km und 598 km im Bau. Unter Dernburg wurden weitere 1460 km Kolonialbahnen genehmigt. Zwei Drittel dieser Kilometer wurden noch zu Dernburgs Zeiten als Staatssekretär vollendet.
Ein weiteres Ziel von Dernburgs Wirtschaftspolitik stellte die Förderung des Baumwollanbaus dar. Hierzu begab er sich ein weiteres Mal auf eine Auslandsreise und zwar in die USA, um an Ort und Stelle sich über den Baumwollanbau zu informieren.
In der Frage der Konzessionsgesellschaften wurde diesen gegenüber ein harter Kurs gesteuert und sie mußten auf viele ihrer Landrechte verzichten, um so dem Ausbau der Kolonie nicht im Wege zu stehen.
Mit den Diamantenfunden 1908 in Deutsch-Südwestafrika gab es für die Zentralverwaltung eine neue Aufgabe. Die Ausbeutung der Diamantenfelder mußte geregelt werden. Entgegen seiner bisherigen gegen die Konzessionsgesellschaften gerichteten Politik übertrug Dernburg einigen Monopolisten das Diamantengeschäft. Er tat dies aus zweierlei Gründen. Zum einen wollte er dem deutschen Kapital Gelegenheit geben, in die bis dato vernachlässigten Kolonien zu investieren, zum anderen wollte er verhindern, daß das Diamantengeschäft die Entwicklung der Kolonie beeinträchtigte. Diese Politik führte in der Öffentlichkeit zu Widerspruch, der auch einen Teil zu Dernburgs Rücktritt beitrug94.
5.3.1.3. Die Eingeborenenpolitik
Dernburg sah die Eingeborenen als wichtigste Aktiva der Kolonien an95. Für ihn führte der Weg zu einer wirtschaftlich sinnvollen Eingeborenenpolitik über den Schutz und die humane Behandlung der Eingeborenen, denn nur „ein satter Neger ist ein guter Arbeiter“96. Man warf ihm deswegen eine „negerfreundliche“ Politik vor. Dernburg sprach indessen von einer „negererhaltenden“ Politik97. Eine seiner Maßnahmen in Bezug auf die Verbesserung der Lebensumstände der Eingeborenen war die Regelung der Prozedur der körperlichen Züchtigung, der sogenannte „Prügelerlaß“98. War bisher die Prügelstrafe beinahe an der Tagesordnung, so sollte ihre Anwendung nun eingeschränkt werden. Diese Anordnung stieß in den Kolonien hingegen auf große Ablehnung. In Südwestafrika sah nach den Aufständen die Lage allerdings anders aus. In der Siedlungskolonie wurde die Eingeborenengesetzgebung noch verschärft.
Mit der Förderung der einheimischen „cash crop“-Kulturen verband Dernburg die Zielsetzung der Schaffung eines eingeborenen Kleinbauernstandes, um so die Herausbildung eines „schwarzen Proletariats“ zu verhindern.
Um die Arbeiterfrage in den Kolonien zu lösen, speziell in den afrikanischen Plantagen- und Farmkolonien, setzte Dernburg auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der schwarzen Arbeiterschaft. Mit „Anwerbe- und Arbeiterverordnung“ vom 27. Februar 1909 für Deutsch-Ostafrika beschritt er diesen Weg. Staatliche Kontrolle über die Anwerbung, Beschränkung der Arbeitsverträge, ein geregelter Mindestlohn und Mindestarbeitszeiten, medizinische Versorgung, Stellung von Unterkünften und Kündigungsbestimmungen sollten die Lage der eingeborenen Arbeitskräfte verbessern und sie so zur Arbeit auf den Plantagen zu ermutigen99.
In seiner Eingeborenenpolitik fanden sich sowohl die Gouverneure von DeutschOstafrika und Kamerun, die als Protagonisten des neuen Kurses in den Kolonien wirkten, als auch das Zentrum wieder, welches ja bisher gegen die Mißhandlung der Eingeborenen im Reichstag protestiert hatte.
Allerdings war von den erlassenen Schutzbestimmungen ohne die Unterstützung der Kolonisten und der Verwaltung in den Kolonien keine Besserung zu erwarten, so daß zwischen Intention und Realität eine Diskrepanz zu beobachten war100. Allerdings bildete Dernburgs neuer Ansatz fortan den offiziellen Standpunkt des Reiches. „Humanität“ und „Arbeiterschutz“ bildeten den Kern der neuen Politik101.
5.3.2. Die Fortführung durch seine Nachfolger
Das Auseinanderbrechen des Bülow-Blocks und der Abschied des Reichskanzlers im Juli 1909 bildeten mit der so entstandenen Ungewißheit für Dernburgs Kolonialreform mit einen Grund für Dernburgs Rücktritt am 12. Mai 1909. Er begründete seinen Rücktritt oftmals damit, daß seine Arbeit getan sei. Was übrig wäre, könnte ein anderer ebenso gut machen, auch verlöre sie dadurch an Interesse für ihn102.
Auf Dernburg folgte sein langjähriger Unterstaatssekretär Friedrich von Lindequist103. Obwohl er als Unterstaatssekretär Dernburgs Reformen im Großen und Ganzen kritisch gegenüberstand, war er doch als ehemaliger Gouverneur in Deutsch- Südwestafrika eher geneigt die Position der Siedler zu vertreten, wurden sie im wesentlichen unter seiner Leitung weitergeführt. Im November trat von Lindequist von seinem Amt zurück, da er das ohne Beteiligung des Reichskolonialamtes ausgehandelte Marokko-Abkommen mit Frankreich mißbilligte. Die Gebietsgewinne in Kamerun erschienen im aus kolonialpolitischen Gründen nicht sinnvoll, waren es doch zum Großteil unerschlossene und bereits ausgebeutete Dschungelgebiete. Hier zeigte sich ein Nachteil der Ausgliederung der Kolonialpolitik aus dem Auswärtigem Amt. War man bisher immer direkt an der Quelle der Außenpolitik, so war man nun auf den Informationsfluß aus dem Auswärtigem Amt angewiesen. Auf Lindequist folgte Wilhelm Solf104, unter dem auch weiterhin die von Dernburg angestoßenen Reformen die Grundlage der Kolonialpolitik bildeten. Es wurde unter beiden Nachfolgern zwar ein schärferer Kolonialkurs gefahren, aber die wesentlichen Errungenschaften der Dernburgschen Reformen blieben (Ausbau des Eisenbahnnetzes, gestiegenes Bewußtsein für die Kolonien, verstärkte Investitionsbereitschaft des Kapitals und das Bekenntnis zu einer humanen, ökonomisch orientierten Eingeborenenpolitik). Allerdings folgte ihnen nicht ein weiterer konsequenter Ausbau, wie ihn Dernburgs liberales Intermezzo erfordert hätte, um seiner Reformpolitik zum großen Durchbruch zu verhelfen105.
C. Schlußbetrachtungen
Die Entwicklung der deutschen Kolonialverwaltung hin zum Reichskolonialamt ist nicht immer auf geraden Bahnen verlaufen. Vielmehr war die Weiterentwicklung der Zentralverwaltung oftmals von äußeren Umständen diktiert. Das Versagen des bismarckschen „royal charter“-Systems, die Kritik der „Kolonialschwärmer“106 an der unzureichenden Kolonialpolitik des Reiches und schließlich die Kolonialkrise 1905/06 mit den heftigen Attacken aus dem Reichstag führten immer wieder zu Fortschritten in der Ausbildung einer Kolonialverwaltung.
War zunächst die Kolonialpolitik von einem Minimalismus in Aufwand und Auftreten gezeichnet, man versteckte sozusagen die Kolonien107, so wurde im Laufe der Zeit die Kolonialpolitik immer mehr intensiviert, was schon allein das Anwachsen der Zahl der in der Verwaltung tätigen höheren Beamten zeigt108.
Jeweils nach einschneidenden Ereignissen verstärkte man die Reformen in der Zentralverwaltung. Am einprägendsten ist dieses Phänomen in dem Wirken Dernburgs sichtbar. Unter ihm erfuhr die Kolonialverwaltung ihre einschneidenste Reform, die den Grundstein für das prosperierende deutsche Kolonialreich nach 1907 legte. Allerdings bereitete der ausbrechende erste Weltkrieg diesem deutschen Kolonialreich ein rasches Ende, so daß man lediglich aus den guten Zwischen- ergebnisse der Vorkriegsjahre einen gewissen Erfolg der Politik der Reichs- kolonialamtes ableiten kann.
Dennoch bleibt die Frage, ob die Reformen Dernburgs wirklich einen Schlußstrich unter die „systemlose“ Entwicklung109 der Kolonialverwaltung gezogen haben, oder ob sie nur ein liberales Intermezzo geblieben sind. Hatte sich die deutsche Kolonialpolitik wirklich grundlegend geändert oder verharrte sie noch auf alten eingefahrenen Positionen? Es bleibt wohl festzustellen, daß mit Dernburg wirklich ein Ruck durch die Kolonialverwaltung ging, aber ob der Ruck auch in den Kolonien ankam, steht auf einem anderen Blatt.
D. Literaturverzeichnis:
Quellen:
Dernburg, Bernhard: Zielpunkte des Deutschen Kolonialwesens. Zwei Vorträge. Berlin 1907.
Deutsches Kolonialblatt. Amtsblatt für die Schutzgebiete in Afrika und in der Südsee. Jg. 1-25. Berlin 1890-1914.
Deutsche Kolonialzeitung.
Erzberger, Matthias: Die Kolonialbilanz. Bilder aus der deutschen Kolonialpolitik auf Grund der Verhandlungen des Reichstags im Sessionsabschnitt 1905-1906. Berlin 1906.
Handbuch für das Deutsche Reich. Jg. 9-39. Berlin 1876ff.
Helfferich, Karl: Zur Reform der kolonialen Verwaltungsorganisation. Berlin 1905.
Stenographische Berichte über die Verhanldungen des Deutschen Reichstages nebst Anlagen. Berlin 1901ff.
Darstellungen:
Biographische Hilfsmittel:
Neue Deutsche Biographie (NDB). Berlin 1953ff. http://www.dhm.de/lemo/ Datum: 26.03.02 Literatur:
Beneke, Max: Die Ausbildung der Kolonialbeamten. Berlin 1894.
Bley, Helmut: Kolonialherrschaft und Sozialstruktur in Deutsch-Südwestafrika 1894 bis 1914. Hamburg 1968.
Böttger, Hugo: Die neue Ära der deutschen Kolonialpolitik. Berlin 1907.
Conze, Werner (Hg.): Deutschland und Europa. Festschrift für Hans Rothenfels. Düsseldorf 1951.
Fischer, Hans-Jörg: Die deutschen Kolonien. Die koloniale Rechtsordnung und ihre Entwicklung nach dem ersten Weltkrieg (= Schriften zur Rechtsgeschichte Heft 85). Berlin 2001.
Florack, Franz: Die Schutzgebiete, ihr Organisation in Verfassung und Verwaltung. Tübingen 1905.
Gann, Lewis H./ Duignan, Peter: The Rulers of German Africa. 18884-1914. Stanford, Cal. 1977.
Hampe, Karl-Alexander: Das auswärtige Amt in der Ära Bismarck. Mit einem Vorwort von Klaus Hildebrand. Bonn 1995.
Hampe, Karl-Alexander: Das auswärtige Amt in wilhelmischer Zeit. Münster 2001.
Hausen, Karin: Deutsche Kolonialherrschaft in Afrika. Wirtschaftinteressen und Kolonialverwaltung in Kamerun vor 1914. Zürich/ Freiburg i. Br. 1970.
Hoffmann, Hermann von: Deutsches Kolonialrecht. Leipzig 1908.
Huber, Erns Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte. Seit 1789. Bd. III u. IV. Stuttgart u.a. 1969.
Gründer, Horst: Geschichte der deutschen Kolonien. Paderborn u.a., 4. Aufl., 2000.
Jeserich, Kurt (Hg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte. Bd. 3. Das Deutsche Reich bis zum Ende er Monarchie. Stuttgart 1984.
Kade, Eugen: Die Anfänge der deutschen Kolonial-Zentralverwaltung. WürzburgAumühle 1939.
Kaulich, Udo: Geschichte der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika (1884- 1914). Eine Gesamtdarstellung. (Mainz. Univ. Diss. 2000). Frankfurt a. Main u. a. 2001.
Köbner, Otto: Einführung in die Kolonialpolitik. Jena 1908.
Morsey, Rudolf: Dier Oberste Reichsverwaltung unter Bismarck 1867-1890. Münster 1957.
Müller, Helmut/ Fieber, Hans-Joachim: Die Deutsche Kolonialgesellschaft
(DKG).1882 (1887)-1933. In: Die bürgerlichen Parteien in Deutschland, hrsg. v. einem Redaktionskollektiv unter Leitung von D. Fricke. Leipzig 1968, Bd. 1,
S. 390-407.
Nussbaum, Manfred: Vom „Kolonialentusiasmus“ zur Kolonialpolitik der Monopole. Zur deutschen Kolonialpolitik unter Bismarck, Caprivi, Hohenlohe. Berlin (Ost) 1962.
Pierard, Richard V.: The Dernburg Reform Policy and German East Africa. In: Tanzania Notes and Records. Nr. 67 (Juni 1967). S. 31ff.
Pogge von Stratmann, Hartmut: The Kolonialrat. Its Significance and Influence on German Politics 1890 to 1906. Phil. Diss. (Masch.) Oxford 1970.
Schack, Friedrich: Das deutsche Kolonialrecht in seiner Entwicklung bis zum Weltkriege. Hamburg 1923.
Schiefel, Werner: Bernhard Dernburg. 1865-1937. Kolonialpolitiker ind Bankier im wilhelminischen Deutschland. Zürich/ Freiburg i. Br. 1974.
Schnee, Heinrich (Hg.): Deutsches Koloniallexikon. 3 Bde. Leipzig 1920. Solf, Wilhelm: Kolonialpolitik. Mein politisches Vermächtnis. Berlin 1919. Spellmeyer, Hans: Deutsche Kolonialpolitik im Reichstag. Stuttgart 1931.
Spidle, Jake Wilton jr.: The German Colonial Civil Sevice: Organization, Selection and Training. Phil. Diss. (Masch.) Stanford University 1972.
Tesch, Johannes: Die Laufbahn der deutschen Kolonialbeamten: Ihre Pflichten und Rechte. Berlin, 6. Aufl. 1912.
Townsend, Mary Evelyn: The Rise and Fall of Germany´s Colonial Empire 1884 to 1918. New York 1930.
Vietsch, Eberhard von: Wilhelm Solf. Botschafter zwischen den Zeiten. Tübingen 1961.
Wehler, Hans-Ulrich: Bismarck und der Imperialismus. Köln/ Berlin 1969.
Zimmermann, Alfred: Geschichte der Deutschen Kolonialpolitik. Berlin 1914.
Die voranstehende Literaturliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie soll lediglich nach Meinung des Autors wichtige weiterführende Literatur anführen.
[...]
1 vgl. Gründer: Deutsche Kolonien. S. 51-60.
2 Huber, Ernst: Deutsche Verfassungsgeschichte. Seit 1789. Bd. III u. IV. Stuttgart u.a. 1969.
3 Jeserich, Kurt (Hg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte. Bd. 3. Das Deutsche Reich bis zum Ende er Monarchie. Stuttgart 1984.
4 Spidle, Jake Wilton jr.: The German Colonial Civil Sevice: Organization, Selection and Training. Phil. Diss. (Masch.) Stanford University 1972.
5 Kade, Eugen: Die Anfänge der deutschen Kolonial-Zentralverwaltung. Würzburg-Aumühle 1939.
6 Schiefel, Werner: Bernhard Dernburg. 1865-1937. Kolonialpolitiker ind Bankier im wilhelminischen Deutschland. Zürich/ Freiburg i. Br. 1974.
7 z. B. Hausen, Karin: Deutsche Kolonialherrschaft in Afrika. Wirtschaftinteressen und Kolonialverwaltung in Kamerun vor 1914. Zürich/ Freiburg i. Br. 1970. ; Kaulich, Udo: Die Geschichte der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika (1884-1914). Eine Gesamtdarstellung. Frankfurt a. Main 2001.
8 vgl. Jeserich (Hg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte Bd. 3, S. 128; Änderungen zur Verfassung des Norddeutschen Bundes ergaben sich hauptsächlich durch die den süddeutschen Staaten zugebilligten Reservatsrechten
9 „Die Anordnungen und Verfügungen des Bundespräsidiums werden im Namen des Bundes erlassen und
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Bundeskanzlers, welcher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt.“ (vgl. Morsey: Oberste Reichsverwaltung unter Bismarck, S. 19.
10 vgl. Morsey: Oberste Reichsverwaltung unter Bismarck S. 22.
11 von Bennigsen, Rudolf (1824-1902), Politiker; 1846-65 im hannoveranischen Staatsdienst. 1859-67
Vorsitzender des „Deutschen Nationalvereins“, 1867-83 im preuß. Abgeordnetenhaus. 1867-83 und 1887-98 Vositzender der Nationalliberalen Fraktion im Reichstag.
12 vgl. Morsey: Oberste Reichsverwaltung unter Bismarck, S. 25ff.
13 vgl. a. a. O. S. 35f.
14 vgl. a. a. O. S. 61.
15 vgl. a. a. O. S. 107
16 vgl. Jeserich (Hg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 3, S. 147.
17 „aa) die Aufsicht über die den Einzelstaaten überwiesene Reichsverwaltung, bb) die Vermittlung des geschäftlichen Verkehrs zwischen Bundesrat, Reichstag und Bundeskanzler, cc) die Aufstellung des Etatentwurfs, dd) die Ausführung des gesetzlich festgestellten Etats, ee) die gesamte Finanzwirtschaft und Vermögensverwaltung des Reiches, ff) die Bearbeitung der handelspolitschen Aufgaben, gg) die Ausführung und die Kontrolle der Ausführung der Reichsgesetze über Maße, Gewichte, Münzwesen, Papiergeld, Banken, hh) die Kontrolle der Erhebung der Zölle und Verbrauchssteuern sowie deren Abrechnung mit den Einzelstaaten, ii) die Bearbeitung der Personalien (einschließlich des Pensionswesen) für die vom Reichskanzleramt ressortierenden Behörden.“ (vgl. Jeserich (Hg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 3, S. 147.)
18 vgl. Jeserich (Hg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 3, S. 148.
19 (von) Delbrück, Rudolf (1817-1903), Jurist; seit 1837 im preuß. Verwaltungsdienst, seit 1844 im
Handelsministerium (1848 Vortr. Rat, 1849 Abteilungsleiter), 1867-71 Präsident des Bundeskanzleramts, 1871-76 des Reichskanzleramts, seit 1868 auch preuß. Staatsminister. 1879-81 MdR .
20 vgl. Morsey: Oberste Reichsverwaltung unter Bismarck, S. 314.
21 vgl. a. a. O. S. 304f.
22 vgl. a. a. O. S. 308.
23 Einen reinen Vizekanzler gab es selten, in der Regel wurde das Amt des Vizekanzlers durch einen
Ressortleiter ausgeführt. Zu der Frage der Generalstellvertretung vgl. Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte Bd. 3, S. 824.
24 vgl. Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte Bd. 3, S. 823.
25 vgl. Morsey: Oberste Reichsverwaltung unter Bismarck, S. 309.
26 vgl. a. a. O. S. 311.
27 vgl. Jeserich (Hg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte Bd. 3, S. 180ff.
28 Erst die Herausforderungen des I. Weltkriegs brachten neue Bewegung. Vgl. Jeserich (Hg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte Bd. 3, S. 866-908.
29 (Graf) von Caprivi, Leo (1831-99) seit 1849 preuß. Offizier, 1870/71 Generalstabschef des X. Armeekorps, dann Abteilungschef im Kriegsministerium, 1882 Generalleutnant, 1883-88 Chef der Admiralität, 1888-90
30 Fürst zu Hohenlohe-Schillimgsfürst, Chlodwig (1819-1901), seit 1840 auch Prinz zu Ratibor und Corvey, seit 1846 erbliches Mitglied der bayerischen ersten Kammer, 1866-1870 bayerischer Ministerpräsident, 1871-77 MdR (freikonservativ), 1874-85 Botschafter in Paris, 1885-94 Statthalter in Elsaß-Lothringen. 1894-1900 Reichskanzler und preuß. Ministerpräsident.
31 (Fürst) von Bülow, Bernhard (1849-1929), seit 1874 im preuß. diplomatischen Dienst, 1877 Geschäftsträger in Athen, 1879 Botschaftsrat in Paris, 1884 Botschaftsrat in St. Petersburg, 1888 Gesandter in Bukarest, 1893 Botschafter in Rom, 1897-1900 Staatssekretär des Auswärtigen Amts. 1900-09 Reichskanzler und preuß. Ministerpräsident.
32 Zum Beginn der Kolonialverwaltung siehe vor allem Kade, Eugen: Die Anfänge der deutschen Kolonial-
Zentralverwaltung. Würzburg-Aumühle 1939. und Spidle, Jake Wilton jr.: The German Colonial Civil Sevice: Organization, Selection and Training. Phil. Diss. (Masch.) Stanford University 1972.
33 Schutzerklärung für die von Lüderitz erworbenen Gebiete in Südwestafrika 24. April 1884
34 von Kusserow, Heinrich (1836-1900), Jurist; seit 1862 im preuß. diplomatischen Dienst, 1871-74 MdR („Liberale Reichspartei“), 1874 Vortragender Rat im Auswärtigem Amt (1879 Geh. Legationsrat); 1880-85 Leiter des Dezernats für die deutsche überseeischen Interessen. Er bereitete 1880 die Samoa-Vorlage vor und leitete 1884/85 den Erwerb des deutschen Kolonialbesitzes in Kamerun und Togo, Südwestafrika, Ostafrika sowie Neuguinea. Auch war sein Verdienst die Errichtung der subventionierten deutschen Dampferlinien nach Ostasien und Australien. Er bearbeitete ferner die Vorlagen für die Kongo-Konferenz und unterzeichnete auf deutscher Seite die Kongo-Akte vom 25. Februar 1885. Von Juni 1885 bis Juni 1890 war er preuß. Gesandter in Mecklenburg und bei den Hansestädten.
35 Spidle: Colonial Service. S. 8f
36 Bismarck bevorzugte in freihändlerischer Tradition einen zurückhaltenden Staat im ihm aufgenötigten Kolonialerwerb vgl. Gründer: Deutsche Kolonien. S. 51-60.
37 Für Deutsch-Südwestafrika: Deutsche Kolonialgesellschaft für Deutsch-Südwestafrika, für Deutsch-Ostafrika: Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, für Neuguinea: Neuguinea-Compagnie und für Kamerun und Togo das rasch zerfallende Westafrika-Syndikat
38 Bismarck sträubte sich den Begriff Kolonien zu verwenden, da er mit ihm eine starkes Engagement des Reiches verband vgl. Gründer: Deutsche Kolonien. S. 58, Hausen: Deutsche Kolonialherrschaft. S. 24.
39 Krauel, Richard (1848-1918) Jurist; seit 1873 im deutschen diplomatischen Dienst, 1873-78 Konsul in China, 1879-1884 Generalkonsul in Australien, 1885-1890 Vortr. Rat und Leiter des Dezernats für die deutschen überseeischen Interessen; 1. April - 30. Juni 1890 Dirigent der neuerrichteten Kolonialabteilung des Ausw. Amts. Dann Gesandter in Buenos Aires (1890) und Rio de Janeiro (1894). Seit 1898 im einstw. Ruhestand. Seit 1904 ord. Honorarprofessor an der Universität Berlin (jur. Fak.) für Völkerrecht und Politik.
40 Er war Mitglied des 1878 gegründeten „Zentralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher
Interessen im Ausland“, seit 1883 gehörte er auch dem „Deutschen Kolonialverein“ an; Adolph von Hansemann war sein Schwager, ein führender Exponent der in den Kolonialgebieten tätigen Kapitalanleger.
41 vgl. Hampe: Auswärtiges Amt in der Ära Bismarck. S. 172.
42 vgl. Spidle: Colonial Service. S. 17.
43 vgl. Hausen: Deutsche Kolonialherrschaft. S. 28.
44 vgl. Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte Bd. IV. S. 626ff
45 vgl. Jeserich (Hg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte Bd. 3. S. 160.
46 vgl. Spidle: Colonial Service. S. 39f
47 Fabri, Friedrich (1824-1891) Theologe; Studium der ev. Theologie in Erlangen und Berlin, 1848 Stadtvikar in Würzburg, 1851 Pfarrer in Bonnland ,1857 Direktor der Rheinischen Mission in Wuppertal-Barmen, 1855-1878 Kirchenpolitische Schriften, 1869 Gründung der „Missions-Handels-Gesellschaft“, 1879 „Bedarf Deutschland Kolonien?“. Danach Kontaktaufnahme zu und Förderung Hübbe-Schleidens, Kontaktmann Bismarcks zur
Kolonialbewegung. 1889 „Fünf Jahre deutsche Kolonialpolitik“, 1889 Honorarprofessor in der ev.-theol. Fakultät in Bonn
48 vgl. a. a. O. S. 42f.
49 Jeserich (Hg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte Bd. 3. S. 160.
50 vgl. Deutsches Kolonialblatt 1 (1890), Heft 2, S. 22.
51 vgl. Hampe: Auswärtiges Amt in wilhelminischer Zeit. S. 6f.
52 vgl. Spidle: Colonial Service. S. 80f.
53 vgl. a. a. O. S. 82f.
54 Kayser, Paul (1845-1898), Jurist; seit 1872 im preuß. Justizdienst; 1880 Regierungsrat im Reichsjustizamt; 1885 Geh. Regierungsrat im neuerrichteten Reichsversicherungsamt; im gl. Jahr Vortr. Rat in der Rechtsabteilung des Ausw. Amts (1888 Geh. Legationsrat); 30. Juni 1890 - 14. Oktober 1896 Leiter der Kolonialabteilung (1890 Dirigent, 1894 Direktor); 1896-1898 Senatspräsident im Reichsgericht.
55 vgl. a. a. O. S. 87-89.
56 zum Kolonialrat siehe vor allem das Werk von Pogge von Stratmann, Hartmut: The Kolonialrat. Its Significance and Influence on German Politics 1890 to 1906. Phil. Diss. (Masch.) Oxford 1970.
57 Die Interessensvertretung der „Kolonialenthusiasten“ im Reich, hervorgegangen am 1. Januar 1888 durch den Zusammenschluß des „Deutschen Kolonialvereins“ und der „Gesellschaft für Deutsche Kolonisation“ (vgl. Gründer: Deutsche Kolonien. S. 39-43.).
58 vgl. Spidle: Colonial Service. S. 48.
59 vgl. Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte Bd. IV. S. 629f. und Schiefel: Dernburg. S. 33f.
60 vgl. Koloniallexikon Bd. 2. S. 322.
61 Peters, Carl (1856-1918) Kolonialpolitiker. 1880 Privatdozent in Berlin. März 1884 Gründung der
„Gesellschaft für Deutsche Kolonisation“. Seit Oktober 1884 in Ostafrika tätig, Abschluß von Schutzverträgen; Februar 1885 Erwirken eines Schutzbriefs des Reiches. 1891-92 Reichskommissar in Deutsch-Ostafrika; 1892 zur Disposition gestellt wegen Verfehlungen in der Eingeborenenpolitik. 1897 in einem Disziplinarverfahren aus dem Reichsdienst entlassen. 1914 rehabilitiert.
62 Freiherr von Richthofen, Oswald (1847-1906), Jurist, seit 1875 im auswärtigen Dienst; 1881 Vortragender Rat im Auswärtigen Amt, 1885 deutsches Mitglied der Direktion der ägyptischen Staatsschuldenverwaltung, 15. Oktober 1896 - 31. März 1898 Direktor der Kolonialabteilung im Auswärtigen Amt. 1898-1900 Unterstaatssekretär, 1900-1906 Staatssekretär des Auswärtigen Amts, seit 1905 auch preuß. Staatsminister.
63 von Buchka, Gerhard (1851-1935), mecklenburgischer Jurist; 1886 Oberlandesgerichtsrat in Rostock; 1893-98 MdR (Kons.); an der Vorbereitung des BGB maßgebend beteiligt; Mitglied des Vorstands der Deutschen Kolonialgesellschaft; 31. März 1898 - 6. Juni 1900 Direktor der Kolonialabteilung.
64 vgl. Spidle: Colonial Service. S. 95f.
65 Stübel, Oskar (1846-1921), sächs. Jurist; seit 1879 im konsularischen Reichsdienst; 1884 Generalkonsul in Samoa, 1887 in Kopenhagen, 1889-90 wieder in Samoa, 1891-99 in Schanghai, 1899-1900 Gesandter in Santiago; 30. Juni 1900 - 27. November 1905 Direktor der Kolonialabteilung.
66 vgl. a. a. O. S. 98.
67 Prinz zu Hohenlohe-Langenburg, Ernst (1863-1950), Sohn des Fürsten Herrmann zu Hohenlohe-Langenburg (1832-1913), des Statthalters von Elsaß-Lothringen 1894-1907, Jurist; zunächst im diplomatischen Reichsdienst, dann im Ministerium für Elsaß-Lothringen; 1900-05 Regent von Sachsen-Koburg-Gotha (für den minderjährigen Herzog Karl Eduard); 27. November 1905 - 5. September 1906 Direktor der Kolonialabteilung; 1907-1912 MdR (freikonservativ).
68 Wie er Bülow und dem kaiserlichen Hof auch bekannt war (vgl. Spidle: Colonial Service: 99f.).
69 vgl. Gründer: Deutsche Kolonien. S. 120.
70 von Trotha, Lothar (1848-1920) preuß. Offizier; seit 1889 Major bei der deutschen Schutztruppe in DeutschOstafrika (1894-95 Kommandeur); 1894-97 Vizegouverneur in Deutsch-Ostafrika; dann wieder in der Armee (1897 Regiments-, 1899 Brigadekommandeur); 1900 im Chinafeldzug Kommandeur der 1. Ostasien-Brigade; 1903 Divisionskommandeur in Trier; 1904 Kommandeur des Expeditionskorps in Deutsch-Südwestafrika; 1905 Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika; 1906 zur Disposition gestellt (General der Infanterie).
71 Erzberger, Matthias (1875-1921), Politiker; 1894-96 im Schuldienst; 1896-1903 Schriftsteller und Redakteur in Stuttgart; 1899 Mitbegründer der christlichen Gewerkschaft. 1903-18 MdR (Zentrum); ab 1907 Finanzexperte in Kolonial- und Budgetfragen; 1912 in der Fraktionsführung. Oktober 1918 Staatssekretär ohne Geschäftsbereich, November 1918 Leitung der Waffenstillstandskommission, erster Unterzeichner des Waffenstillstandsabkommen von Compiègne 11. November 1918. Februar 1919 Reichsminister ohne Geschäftsbereich; Juni 1919 - März 1920 Vizekanzler und Finanzminister. Am 26. August 1921 fällt er einem Attentat zum Opfer.
72 vgl. Spidle: Colonial Service. S. 163.
73 vgl. a. a. O. S. 168-188.
74 Dernburg, Bernhard ( 1865-1937), ein Sohn des liberalen hessischen Schriftstellers und Politikers Friedrich Dernburg (1833-1911), ein Neffe des Juristen Heinrich Dernburg (1829-1907), begann seine Laufbahn im Bankfach; 1889 Direktor der Deutschen Treuhandgesellschaft, 1901 Mitglied des Direktoriums der Deutschen Bank. 1906 Direktor der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amts; 1907-1910 Staatssekretär des Reichskolonialamts. 1919-20 Mitglied der Weimarer Nationalversammlung, anschließend des Reichstags (Deutsche Demokratische Partei). Von April bis Juni 1919 Reichsfinanzminister.
75 Einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bank, die sich auf die in Deutschland wenig bekannte Form der Trustgesellschaft spezialisierte, also auf Geschäfte in Amerika (vgl. Schiefel: Dernburg. S. 20.).
76 Eines der ältesten deutschen Kreditinstitute wurde sie unter Dernburg in die Riege der großen deutschen Bank zurückgeführt (vgl. Schiefel: Dernburg: S. 24-27.).
77 vgl. Schiefel: Dernburg. S. 19-24 .
78 vgl. Spidle: Colonial Service. S. 199f.
79 vgl. Hausen: Deutsche Kolonialherrschaft. S. 30.
80 vgl. Schiefel: Dernburg. S. 52.
81 vgl. Spidle: Colonial Service. S. 217.
82 zu den „Hottentotten-Wahlen“ und dem Bülow-Block vgl. Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte Bd. IV. S. 293f. zu den Gründen Bülows zur Bildung des sogenannten Bülow-Blocks vgl .auch Spidle: Colonial Service. S. 156-221.
83 für das folgende Kapitel vgl. Handbuch für das Deutsche Reich auf das Jahr 1911. Bearbeitet im Reichsamt des Inneren. Jahrgang 36. Berlin 1911. und Gann u. Duignan: Rulers of German Africa. S. 255.
84 vgl. Jeserich: Deutsche Verwaltungsgeschichte Bd. 3. S. 161f.
85 Rathenau, Walter (1867-1922), Industrieller, Politiker, Schriftsteller; seit 1892 in der Industrie tätig. 1893-98 Geschäftsführer der Elektrochemischen Werke Bitterfeld; 1899-1902 im Vorstand der AEG. 1902 Wechsel zur Berliner Handelsgesellschaft; 1904 Mitglied im Aufsichtsrat der AEG. 1907/08 Zwei Inspektionsreisen mit Dernburg nach Afrika. 1910 stellvertretender Vorsitzender, 1912 Vorsitzender des AEG-Aufsichtsrats. 1912-17 Publikation philosophischer und sozialpolitischer Studien. 1914-15 Leiter der Kriegsrohstoffabteilung im preuß. Kriegsministerium. 1915 Präsident der AEG. 1921 Wiederaufbauminister. 1922 Außenminister, Abschluß des Rapallo-Vertrags. 24. Juni 1922 er fällt einem rechtsradikalen Attentat zum Opfer.
86 von Rechenberg, Albrecht (1861-1935); 1906-12 Gouverneur von Deutsch-Ostafrika; 1913-14 MdR (Zentrum); Vizepräsident der Deutschen Kolonialgesellschaft 1923-25.
87 vgl. Schiefel: Dernburg. S. 70.
88 vgl. a. a. O. S. 80.
89 vgl. a. a. O. S. 83.
90 vgl. a. a. O. S. 83.
91 vgl. Deutsches Kolonialblatt. 19 (1908) Heft 6.
92 vgl. Schiefel: Dernburg. S. 89.
93 vgl. a. a. O. S. 92.
94 vgl. a. a. O. S. 106.
95 vgl. a. a. O. S. 120.
96 vgl. a. a. O. S. 108.
97 vgl. a. a. O. S. 108f.
98 vgl. a. a. O. S. 110.
99 vgl. a. a. O. S. 115f.
100 vgl. a. a. O. S. 119.
101 vgl. a. a. O. S. 120.
102 vgl. a. a. O. S. 127ff.
103 von Lindequist, Friedrich (1862-1945), Jurist; seit 1892 im auswärtigen Dienst, dann im Kolonialdienst. 1894 Richter in Deutsch-Südwestafrika; 1895 Oberrichter und ständiger Vertreter des Gouverneurs. 1900 Generalkonsul in Kapstadt. 1907-1910 Unterstaatssekretär, 10. Juni 1910 - 3. November 1911 Staatssekretär des Reichskolonialamtes.
104 Solf, Wilhelm (1862-1936), Jurist; seit 1894 in der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes; 1898 Bezirksrichter in Dar-es-Salam (Deutsch-Ostafrika), 1899 Präsident des Munizipialrats von Apia (Samoa), 1900 Gouverneur von Samoa. 20. Dezember 1911 - 13. Dezember 1918 Staatssekretär des Reichskolonialamts, von Oktober bis Dezember 1918 zugleich des Auswärtigen Amtes. 1920-28 Botschafter in Tokio.
105 vgl. Jeserich: Deutsche Verwaltungsgeschichte Bd. 3. S. 162.
106 vgl. Spidle: Colonial Service. S. 58.
107 vgl. Schiefel: Dernburg. S. 31.
108 vgl. die Tabelle bei Hausen: Deutsche Kolonialherrschaft. S. 26.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Reichskolonialamt und wann wurde es gegründet?
Das Reichskolonialamt war das letzte Reichsamt, das vor dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1907 gegründet wurde. Es entstand aus der Kolonialabteilung im Auswärtigen Amt und war für die Verwaltung der deutschen Kolonien zuständig.
Warum dauerte es so lange, bis ein eigenes Kolonialamt gegründet wurde?
Die Gründung eines eigenen Kolonialamtes erfolgte erst 21 Jahre nach dem Erwerb der ersten Kolonien. Dies lag unter anderem daran, dass Bismarck zunächst eine eher zurückhaltende Rolle des Deutschen Reiches in der Kolonialverwaltung befürwortete und die Verwaltung der Kolonien anfangs Handelsgesellschaften übertragen werden sollte. Die Notwendigkeit einer umfassenderen Kolonialverwaltung ergab sich erst im Laufe der Zeit.
Wie entwickelte sich die Kolonialverwaltung vor der Gründung des Reichskolonialamtes?
Ursprünglich sollte die Verwaltung der Kolonien durch Handelsgesellschaften erfolgen. Da dies jedoch nicht funktionierte, wurde bereits 1885 der erste Gouverneur in Kamerun eingesetzt. Die Kolonialverwaltung wurde zunächst als Referat im Auswärtigen Amt eingerichtet und später zur Kolonialabteilung aufgewertet. Erst mit der Gründung des Reichskolonialamtes wurde eine eigenständige Behörde für die Kolonialpolitik geschaffen.
Wer war Bernhard Dernburg und welche Rolle spielte er bei der Gründung des Reichskolonialamtes?
Bernhard Dernburg war ein bedeutender Kolonialpolitiker und Bankier. Er wurde 1906 Direktor der Kolonialabteilung im Auswärtigen Amt und 1907 erster Staatssekretär des Reichskolonialamtes. Dernburg setzte sich für eine Reform der Kolonialverwaltung ein und trug maßgeblich zur Gründung des Reichskolonialamtes bei.
Welche Reformen wurden unter Bernhard Dernburg im Reichskolonialamt durchgeführt?
Dernburg initiierte umfassende Reformen in der Kolonialverwaltung. Dazu gehörten Verwaltungsreformen, eine neue Wirtschaftspolitik und eine verbesserte Eingeborenenpolitik. Er setzte sich für eine Dezentralisierung der Kolonialverwaltung, den Ausbau der Infrastruktur, die Förderung des Baumwollanbaus und den Schutz der Eingeborenen ein.
Wie war das Reichskolonialamt aufgebaut?
Das Reichskolonialamt bestand aus vier Abteilungen: Abteilung A für politische, allgemeine Verwaltungs- und Rechtsangelegenheiten, Abteilung B für Finanzen, Bauwesen, Verkehrsangelegenheiten und sonstige technische Angelegenheiten, Abteilung C für Personalangelegenheiten und Abteilung M für Militärverwaltung (Kommando der Schutztruppe).
Was geschah mit dem Reichskolonialamt nach dem Rücktritt von Bernhard Dernburg?
Nach Dernburgs Rücktritt im Jahr 1910 wurde die Kolonialpolitik von seinen Nachfolgern Friedrich von Lindequist und Wilhelm Solf fortgeführt. Die von Dernburg angestoßenen Reformen bildeten weiterhin die Grundlage der Kolonialpolitik, obwohl ein schärferer Kolonialkurs gefahren wurde.
Welche Bedeutung hatte das Reichskolonialamt für die deutsche Kolonialpolitik?
Das Reichskolonialamt markierte einen Wendepunkt in der deutschen Kolonialpolitik. Durch die Reformen unter Dernburg wurde die Kolonialverwaltung professionalisiert, die Wirtschaft in den Kolonien gefördert und die Lebensbedingungen der Eingeborenen verbessert. Der Erste Weltkrieg beendete jedoch die deutsche Kolonialherrschaft und somit auch die Tätigkeit des Reichskolonialamtes.
- Arbeit zitieren
- Christian Ruppenstein (Autor:in), 2001, Aufbau und Arbeitsweise des Reichskolonialamtes, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/106455