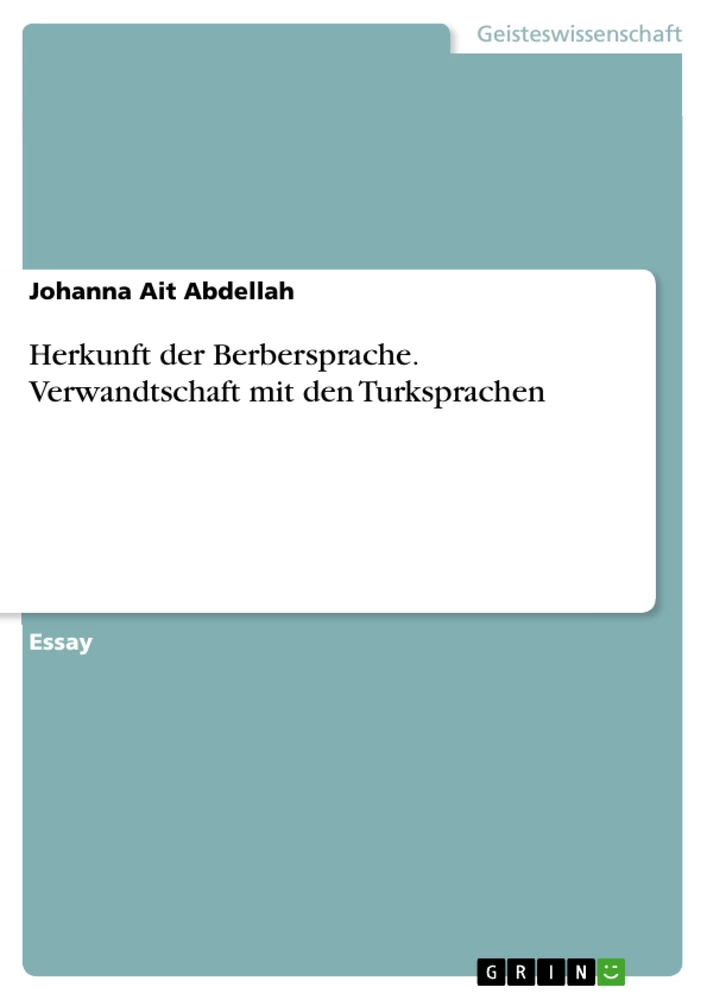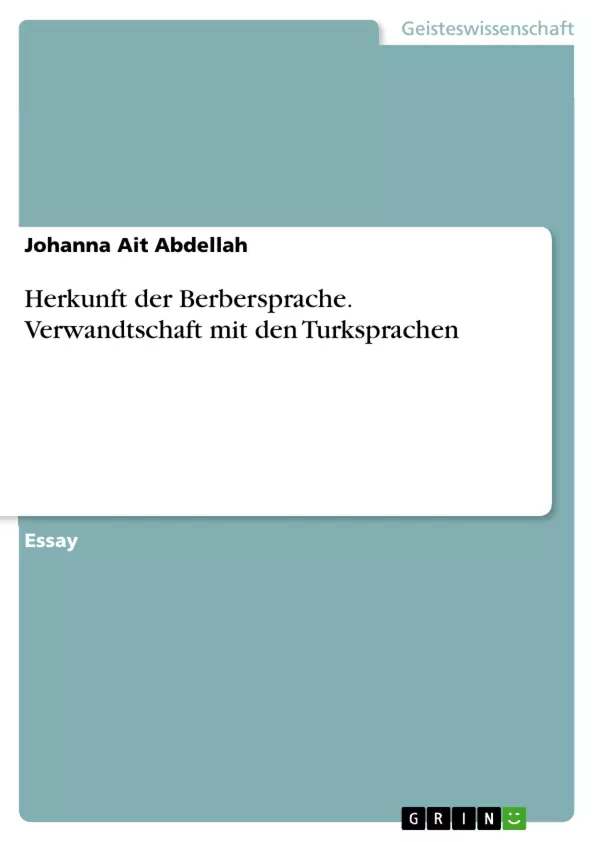Das Essay beschäftigt sich mit der Herkunft der Berbersprache. Über der Herkunft der Berber liegt bisher ein großer Schatten. Herodot, der sich bei den wissenschaftlich sehr bewanderten Priestern Ägyptens erkundigt hatte, hielt sie neben den schwarzafrikanischen Äthiopiern für die Ureinwohner Nordafrikas.
Diese Auffassung ist inzwischen vielfach widerliegt worden. Die Wissenschaft benennt sie mit dem etwas schwammigen Begriff afroasiatisch, im Gegensatz zu etwa dem nilotischen Sprachkreis. Man erkannte vermutlich in der Grammatik und in der Lexik der afroasiatischen Sprache den semitschen Anteil. Dieser ist jedoch auf den frühen Einfluss der semitisch-sprachigen Völker, der Phönizier und Araber zurückzuführen, die ja auch auf die ägyptische Sprache sehr früh eingewirkt haben. Der Wortschatz kann eindeutig im mittelasiatischen Raum lokalisiert werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Die vorhandene Einteilung der Berbersprache in das weltweite System der Sprachen
2 Der Wortschatz der Berbersprache und seine eindeutige Lokalisierung im turksprachigen asiatischen Raum
3 Einfluss aus dem Iranischen
4 Herkunft aus einem potentiellen Mittelmeerkreis
5 Der Besitz – Kasus
6 Die Verneinung
7 Das Problem der Selbstbezeichnungen
8 Die archäologischen Zeugnisse der Berber in ihrem Aussagewert für den Werdegang der Berber-Völker
9 Nachwort
Literatur
1 Die vorhandene Einteilung der Berbersprache in das weltweite System der Sprachen
Über der Herkunft der Berber liegt bisher ein großer Schatten. Herodot, der sich bei den wissenschaftlich sehr bewanderten Priestern Ägyptens erkundigt hatte, hielt sie neben den schwarzafrikanischen Äthiopiern für die Ureinwohner Nordafrikas.
Diese Auffassung ist inzwischen vielfach widerliegt worden. Die Wissenschaft benennt sie mit dem etwas schwammigen Begriff afroasiatisch, (Peter K Austin, 1000 Languages, 2008, Thames&Hudson), im Gegensatz zu etwa dem nilotischen Sprachkreis. Man erkannte vermutlich in der Grammatik und in der Lexik der afroasiatischen Sprache den semitischen Anteil. Dieser ist eindeutig je doch auf den frühen Einfluss der semitisch sprachigen Völker, der Phönizier und Araber zurückzuführen, die ja auch auf die ägyptische Sprache sehr früh eingewirkt haben.
2 Der Wortschatz der Berbersprache und seine eindeutige Lokalisierung im turksprachigen asiatischen Raum
Der Wortschatz und seine eindeutige Lokalisierung in dem mittelasiatischen Raum Ich führe alle Wörter aus dem Berberdialekt tamazirt an, darauf folgt der türkische Ausdruck
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3 Einfluss aus dem Iranischen
Garm in der Bedeutung "Warm" wurde zur Bezeichnung einer Stadt in Libyen und zum Handelsplatz der Garamanten.
Agur in der Bedeutung "Groß" kommt in Djebl Agur zum Ausdruck, ebenso bei der Bezeichnung eines Heiligengrabes AGURRAMEN.
4 Herkunft aus einem potentiellen Mittelmeerkreis
Argas - der Mann kehrt wieder in der italienischen Form Ragazzo (kleiner Junge) und in der französichen Form Garcon (Kellner).
5 Der Besitz – Kasus
Generell mit der Partikel N gebildet Imi - n- tigemi in der Bedeutung "Eingang des Hauses"
6 Die Verneinung
Sie wird ausschließlich mit "Ur" ausgedrückt.
Ur sinr - ich weiß nicht
Ur isin - er weiß nicht
Ur illi - er ist nicht da
7 Das Problem der Selbstbezeichnungen
Bei den Tuareg gibt es keinen eindeutigen Ursprung. Die Tubu (auch Tibu genannt) sind Bewohner des Tibestigebirges.
8 Die archäologischen Zeugnisse der Berber in ihrem Aussagewert für den Werdegang der Berber-Völker
In der gesamten Sahara finden sich archäologische Zeugnisse für die Anwesenheit des Menschen schon seit dem achten Jahrtausend v.d.Z. Über 100 000 Abbildungen sind bekannt. Es sind Gravuren und Malerein, die von verschiedenen Gruppen geschaffen wurden. Die älteren zeigen vom Körperbau her Schwarzafrikaner beim Hüten von Rindern (in der sogenannten Rundkopfperiode), auch Kämpfe mit Viehdieben sind darunter. Später treten dann offenbar weißhäutige Viehhirten dazu. Interessant ist unter diesen die Szene, bei der zwei Hirten ihre Wurfhölzer austauschen. Beide tragen Kopftücher, sind unbekleidet, wobei einer auf einer großen gewebten Matte sitzt. Zahlreiche Bilder zeigen sehr ausdrucksstark springende Gazellen, kämpfende Rinder, schwimmende Menschen, aber auch Szenen mit erotischem Inhalt.
Abbildungen von Wagen und von Pferden kommen in den letzten zwei Jahrtausenden v.d.Z. hinzu. In Süd-Marokko (Tuat) findet sich sogar die Abbildung eines Karavans mit sechs Rädern! Es ist bekannt, dass es auch feste Routen gab; Im algerischen In Salah kreuzte sich der Ost-West-Karavanenweg mit dem von Nord nach Süd. Für die unterirdischen Tiefbrunnen, die Foggaras, wurden schon lange vor der Zeitenwende schwarzafrikanische Arbeitskräfte als Sklaven rekrutiert. Der Handel mit Elfenbein, Gold und Straußenfedern, später auch Salz lag in den Händen der Garamanten.
Ganz Nordafrika wird von Herodot Libyen genannt, das seiner Meinung nach von verschiedenen Hirtenstammen bewohnt wird, die er namentlich aufführt: Maker, Maxyer, Nasamonnen. Offensichtlich hat er ihre unterschiedlichen Sitten durch Informationen seiner Gewährsmänner im Nildelta erhalten oder aber auch durch Griechen im östlichen Kyrene, deren Handelsaktivitäten uns auf einer griechischen Schale aus dem 6. Jahrhundert v.u.Z. sehr lebendig geschildert werden.
Die Namen der Hirtenvölker, die von ihren ägyptischen Nachbarn erwähnt werden, sind die Tehenu und weiter westlich die Temehu. Die Tehenu werden als hellhäutige Männer dargestellt, mit kreuzweise auf der Brust gebundenen Lederriemen, mit Gürtel und Phallustasche und Schmuckbändern an Hals und Armen. Das Haar wird offen getragen, mit einer Strähne vor dem Ohr und einer Locke auf der Stirn.
In der Zeit der „Seevölker“- Einfälle (12Jh.) hatten es die Ägypter bereits mit kriegsfürsten zu tun. Auf einer Stele, die Mernemptah als Sieger über Israel zeigt, werden auch seine Siege über die libyschen Maschwasch und deren „erbärmlichen feindlichen Fürst“ gerühmt, der nach Ägypten kam, um „seines Leibes Nahrung zu suchen“. Im 9. Und 8. Jahrhundert finden wir Mittel- und Unterägypten von Großfürsten der Maschwasch regiert, unter ihnen mehrere mit dem Namen Schoschenk und Osorkon. Osorkon II gründete sogar die 22. Dynastie der Pharaonen.
Dann verliert sich die Spur der libyschen Stämme innerhalb Ägyptens, um dann im Handelsvolk der Garamanten weiterzuleben, deren mächtige Siedlungen in der libyschen Sahara noch heute als Ruinen von ihrem gewaltigen Imperium Zeugnis ablegen.
9 Nachwort
Als ich 1991 nach der Wiedervereinigung eine 3-wöchige Busreise nach Marokko antrat, wusste ich über die Berber nur so viel, was in Reiseführern geschrieben stand. Bei einem marokkanischen Taxi-Fahrer lernte ich die Konjugation des Verbs und erfuhr von Einheimischen unter vorgehaltener Hand einige Buchstaben des Tifinarh-Alphabets. Unter dem König Hassan waren die Leute noch sehr eingeschüchtert, jedoch seit sein Sohn Mohammed VI das Ruder des Staates übernahm, hat die Berberkultur eine enorme Unterstützung und Aufwertung erfahren: Es wurde ein spezielles Königliches Institut für die Berberkultur gegründet: IRCAM. Auch mit der Bezeichnung Amazirh/Tamazirht wurde der korrekte Begriff für die Berber und ihre Sprache geschaffen.
Leider ist bisher keine Grammatik beziehungsweise kein Wörterbuch des Tamazirht erschienen. Mir stand 1991 jedoch das in französischer Sprache geschriebene Cours de Berber Marocain von E.Laoust Paris 1921 zur Verfügung.
Inzwischen hatte ich nach meiner Heirat und meinem 3-jährigen Wohnen am Fuße des Hohen Atlas in der Familie meines Mannes die Umgangssprache erlernt. Mein Schlüsselerlebnis war jedoch der Besuch eines Tüzgolü/eines Salzsees im Süden der Türkei. Da schoss es mir durch den Kopf: Tüz-Salz, das ist doch unser tissint. Und Göl- konnte ich zunächst nur mit dem Namen der Stadt Goulmima verbinden, die sich von einem ehemals bestehenden See herleitet.
Natürlich wollte ich nun der Frage nachgehen, wann diese Einflussnahme eines Turkvolks in Nord-Afrika stattgefunden hat. Leider bin ich über keine anderen Zeugnisse als die aus ägyptischen Quellen gestoßen.
Literatur
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text ist eine sprachwissenschaftliche Untersuchung zur Herkunft und Einordnung der Berbersprache. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Wie ist die Berbersprache bisher in das weltweite System der Sprachen eingeordnet?
Die Berbersprache wird im Allgemeinen als Teil der afroasiatischen Sprachfamilie betrachtet. Der Text hinterfragt jedoch diese Einordnung.
Welchen Ursprung vermutet der Text für den Wortschatz der Berbersprache?
Der Text lokalisiert den Ursprung des berberischen Wortschatzes im turksprachigen asiatischen Raum.
Welche Einflüsse aus dem Iranischen werden genannt?
Die Wörter "Garm" (warm) und "Agur" (groß) werden als Beispiele für iranischen Einfluss genannt.
Gibt es Hinweise auf einen Ursprung aus einem potentiellen Mittelmeerkreis?
Ja, das Wort "Argas" wird mit den italienischen und französischen Wörtern "Ragazzo" und "Garcon" in Verbindung gebracht.
Wie wird der Besitz (Kasus) in der Berbersprache gebildet?
Generell wird der Besitz mit der Partikel "N" gebildet, wie im Beispiel "Imi - n- tigemi" (Eingang des Hauses).
Wie wird die Verneinung in der Berbersprache ausgedrückt?
Die Verneinung wird ausschließlich mit "Ur" ausgedrückt.
Was ist das Problem der Selbstbezeichnungen der Berber?
Bei den Tuareg gibt es keinen eindeutigen Ursprung.
Welche archäologischen Zeugnisse gibt es für die Berbervölker?
In der Sahara finden sich archäologische Zeugnisse bis ins achte Jahrtausend v.d.Z., darunter Gravuren und Malerein. Es gibt Darstellungen von Schwarzafrikanern, Viehhirten und später auch weißhäutigen Viehhirten. Auch Abbildungen von Wagen und Pferden sind zu finden.
Was sind die Garamanten?
Die Garamanten waren ein Handelsvolk, dessen mächtige Siedlungen in der libyschen Sahara Zeugnis von ihrem gewaltigen Imperium ablegen.
Welche Nachbetrachtungen gibt es zur Entdeckung der türkischen Verwandschaft?
Der Autor erfuhr eine Auseinandersetzung mit der Sprache und der Geschichte der Berber nach einer Reise nach Marokko und durch eigene Sprachforschung und Familienaufenthalt. Der Besuch eines türkischen Salzsees (Tüzgölü) veranlasste ihn, Parallelen zur Berbersprache zu erkennen.
- Quote paper
- Johanna Ait Abdellah (Author), 2021, Herkunft der Berbersprache. Verwandtschaft mit den Turksprachen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1064432