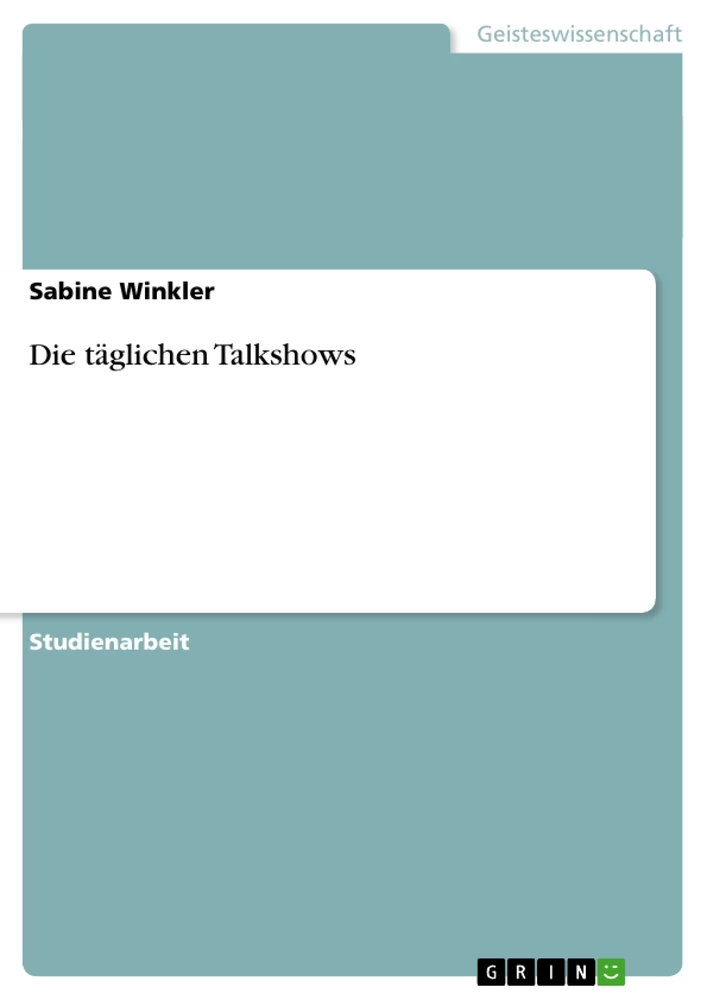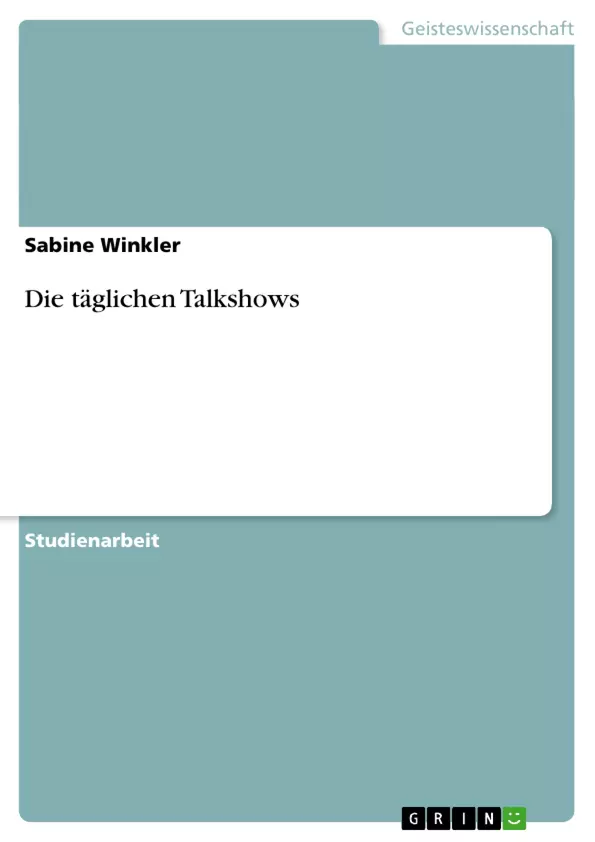Inhaltsverzeichnis
1. Die täglichen Talkshows:
1.1 Gliederung:
1.2 Einleitung
1.3 Begriffsbestimmung
1.4 Der Moderator
1.5 Das Studiopublikum
1.6 Themen und Themengestaltung
1.7 Die Gäste und deren Motivation zur Teilnahme
1.8 Die Rolle der Experten
1.9 Die Zuschauer
1.10 Freiwillige Verhaltensgrundsätze
1.2 Einleitung:
In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich mit den nachmittäglichen Talkshows. Ich werde die Rolle des Moderators, des Publikums, der Gäste, der Experten und schließlich die der Zuschauer betrachten. Weiterhin möchte ich mich mit den Themen und deren sprachlicher Aufmachung beschäftigen; zuletzt werde ich dann die freiwilligen Verhaltensgrundsätze von Talkshows aufzeigen und diese hinsichtlich der Frage nach Anspruch und Wirklichkeit in realen Bezug zueinander bringen.
Ich habe davon abgesehen, die Geschichte und auch die einzelnen Konzepte der deutschen Talkshows aufzuzeigen. Die Konzepte der von mir betrachteten Talkshows ähneln sich sehr, so daß ich eine allgemeine Darstellung für ausreichend halte. Auch hätte eine detailliertere Darstellung den inhaltlichen Rahmen meiner Arbeit gesprengt. Das Ziel dieser Arbeit ist zum einen die Gegenüberstellung von Anspruch und Wirklichkeit, zum anderen der Vergleich mit der Sendung DOMIAN.
In meiner Arbeit beziehe ich mich auf alle werktäglichen Mittags-Talkshows. Lediglich im Kapitel Anspruch und Wirklichkeit ist die Sendung „Jürgen Fliege“ nicht miteingeschlossen. Anmerken möchte ich noch, daß ich den Begriff „der Moderator“ gleichermaßen für weibliche und männliche Moderatoren benutze.
1.3 Begriffsbestimmung:
Der Begriff „Talkshow“ ist amerikanischen Ursprungs und bedeutet Gesprächssendung. In Deutschland gibt es viele verschiedene Gesprächssendungen. Eine einheitliche Definition ist deshalb schwierig. “Es gibt nicht die Talkshow. Vielmehr verbergen sich hinter dem Beg- riff „Talkshow“, der von Kritikern und Programmachern für verschiedene Programmangebote verwendet wird, ganz unterschiedliche Sendeformen, denen teilweise nur das Gesprächsele- ment gemeinsam ist“.1
Es ist aber trotzdem möglich, den täglichen Talkshows bestimmte Merkmale zuzuordnen, die sie als eigenes Genre klassifizieren.2
Nachfolgend werde ich diese Merkmale aufführen. Diese sind:
- werktägliche einstündige Ausstrahlung im Tagesprogramm
- Seriencharakter und lokale Einheitlichkeit
- die Sendung ist nach dem Moderator benannt
- der Moderator übernimmt die gesprächsleitende Funktion
- die Sendung ist monothematisch aufgebaut
- die Themen werden emotionalisiert und personalisiert behandelt
- ca. vier bis zehn nicht-prominente Gäste pro Sendung
- vorhandenes Studiopublikum, welches teilweise miteinbezogen wird
- die Sendung hat kaum sachlich-informative Funktion, ist rein unterhaltend, was durch
Showeffekte unterstützt werden kann
- Ausstrahlung im Fernsehen
- die Charakteristika des Affektfernsehens (Personalisierung, Authentizität, Intimisierung und Emotionalisierung)3 treffen auf die Talkshow zu.
Man kann außerdem zwischen „Portraittalk“ und „Konfrotalk“ unterscheiden. Der Portraittalk lebt von den Gästen mit ihren ungewöhnlichen Geschichten, wohingegen der „Konfrotalk“ eher auf Konfrontation ausgerichtet ist. Es wird ein kontroverses Thema in den Mittelpunkt gestellt. „Dabei kommt es weniger auf die argumentative Auseinandersetzung mit Inhalten, sondern vielmehr auf emotionale Streitgespräche vor einer angeheizten Kulisse an.“4 Die meisten Talkshows, so auch die, welche ich in dieser Arbeit untersuchen möchte, sind Mischformen aus Portrait- und Konfrotalk.
Diese Mischformen werden nach Bente/Fromm „Affekttalk“ genannt. Der Begriff „Affekttalk“ ist abgeleitet von Bentes und Fromms Affektfernsehen.
Die Charakteristika des Affektfernsehens5 sind:
1. Personalisierung
Das Einzelschicksal steht im Vordergrund, Individuelles steht über Allgemeinem.
2. Authentizit ä t.
Es werden „wahre“ Geschichten erzählt.
Der Livecharakter unterstreicht die Authentizität des Gezeigten.
3. Intimisierung:
Ehemals Privates wird öffentliches Thema: „Die öffentliche Bühne ist zum Ort privater Gespräche geworden.“6
4. Emotionalisierung.
Der emotionale Aspekt der Geschichten wird betont. Im Mittelpunkt steht das persönliche
Erleben und Empfinden. Dies kann durch die Kameraführung unterstrichen werden. Zum Beispiel durch Nahaufnahmen eines weinenden Gastes.
1.4 Der Moderator:
Allein die Tatsache, daß die Sendung den Namen des Moderators trägt, gibt Aufschluss darüber, dass er eine zentrale Rolle spielt. Nach Klaus Plake besteht jedoch Unsicherheit bei der Aufgabenbeschreibung des Moderators. Dies ist schon an der Begriffsverwirrung erkennbar: Talkmaster, Moderator, Gesprächs- bzw. Diskussionsleiter und Gastgeber. Diese Begriffe werden meistens parallel, jedoch undifferenziert gebraucht.
Der Begriff Gastgeber ist das amerikanische Pendant zu „host“, welcher den früheren Talk- master ersetzt. Für Sendungen mit politischen Inhalten wurde der Begriff des Moderators ein- geführt. Scheinbar ist bei politischen Themen Mäßigung in Form von Moderation notwendig: „ Seine Aufgabe besteht darin“, so Plake, „Gespräche in Gang zu setzen und nach den Krite- rien einer erfolgreichen Produktion zu führen. Im Unterschied jedoch zum sogenannten Gast- geber einer privaten Abendeinladung hat der Gastgeber einer Talkshow die Aufgabe, Konflik- te zu provozieren, Hemmschwellen abzubauen und Wahrheiten ans Licht zu bringen.“7
Harald Burger hat klarere Vorstellungen von den Aufgaben eines Moderators. Burger ver- gleicht den Moderator mit einem „Chamäleon“, denn er ist ständig verpflichtet, seine Rolle zu wechseln. Die Aufgaben des „Chamäleons“ lassen sich in fünf Rollen einteilen:
1. Der Moderator übernimmt die Gesprächsführung. Er ist bevorrechtigter Sprecher. Er eröffnet, lenkt und beendet Gesprächsbeiträge.
2. Der Moderator ist Gastgeber. Diese Rolle verpflichtet ihn, höflich zu seinen Gästen zu sein. Als Gesprächsführer und Gastgeber ist es seine Aufgabe, den Studiogästen mög- lichst viel Informationen, also Privates, zu entlocken.
3. Selbstdarstellung: Der Moderator muß, um Erfolg mit seiner Show zu haben, sympa- thisch wirken. Es entsteht eine emotionale Bindung des Publikums an den Moderator. 4. Er ist Anwalt der Interessen und Probleme des Rezipienten. Er stellt die Fragen so, daß dem Rezipienten Identifizierung erleichtert wird. 5. Der Moderator kann Gesprächsteilnehmer sein.
In diesen fünf Rollen hat der Moderator die Aufgabe, eine nahe und freundliche Beziehung zwischen Gästen und Studiopublikum herzustellen und notfalls zwischen ihnen zu vermit- teln8.
Nach Bettina Fromm besteht die Aufgabe des Moderators darin, die wechselnden Protagonis- ten und ihre Geschichten zu präsentieren. Wie die nicht-prominenten Protagonisten dient auch er dem Rezipienten als Identifikationsobjekt, aber in einem anderen Sinne. „Der Moderator garantiert den Wiedererkennungseffekt und damit die Bindung des Publikums an die Sen- dung.“9
Man kann sagen, daß der Moderator den Bezug zwischen Programm und Publikum herstellt. Desweiteren ist es die Aufgabe des Moderators, einen alltagsnahen und persönlichen Kommunikationsstil zu schaffen. Dies gelingt zum Beispiel durch gegenseitiges „duzen“: „Duzen schafft eine vertraute Beziehung zwischen Moderator und Gästen, eine persönliche Nähe, die einem ungezwungenen Umgangsstil entspricht.“10
1.5 Das Studiopublikum:
Jede tägliche Talkshow wird durch die Präsenz eines Studiopublikums vervollständigt. Meistens ist das Studiopublikum im Alter des angestrebten Zielpublikums zu Hause vor dem Fernseher. Dadurch soll es dem Zuschauer erleichtert werden, sich zu identifizieren. „In dem Publikum befinden sich dramaturgisch eingeplante Meinungsgeber, die in der Regel der Pola- risierung dienen und immer dann drankommen, wenn vorne etwas grundsätzliches gesagt worden ist.“11. Das Studiopublikum agiert stellvertretend für die Zuschauer zu Hause. Durch die Ablehnung oder auch Zustimmung des Publikums bekommt der Zuschauer das Gefühl dabei zu sein. Die Abläufe werden nachvollziehbarer und dadurch die Bindung des Zuschau- ers an die Sendung verstärkt.
„Das Präsenzpublikum verstärkt die positive und negative Reaktionen in der Interaktion von Moderator und Gästen. Es (das Präsenzpublikum) belohnt und bestraft, und zwar im Kollek- tiv, in Stellvertretung eines Millionenpublikums an den Bildschirmen.“12 Weiterhin, so Plake, kann das Publikum die Dynamik des Gesprächs beeinflussen; so zum Beispiel, wenn es einem der Gäste gelingt die, „Lacher auf seine Seite zu bringen“.
Insofern ist das Publikum auch Sensorium für Stimmungen, für Anspannung und Langeweile, vor allem aber für Ergriffenheit. Das Publikum ist also sozusagen Gradmesser der Gefühle, die den Zuschauern übermittelt werden. Auch Subtilität oder Zweideutigkeit wird durch Reaktionen des Publikums sichtbar.
Allerdings sind die Publikumsreaktionen nicht so spontan wie sie wirken. Ein „Warm-Upper“ sorgt dafür, dass im richtigen Moment geklatscht und „gejohlt“ wird.
1.6 Themenformulierung:
In Talkshows werden sehr viele unterschiedliche Themen behandelt. Das Spektrum der The- men reicht von alternativen Heilmethoden, spirituellen oder religiösen Themen bis hin zu Lebensweisen, Beziehungsproblemen und Sex. Aber auch ernste Themen wie Tod, Straftaten, Politik und psychologische Problemen werden in Talkshows diskutiert. Auch Familienstrei- tigkeiten, Gesundheits- und Modetrends sowie gesellschaftliche Probleme finden in Talk- shows Beachtung.
Mir persönlich würde kein Thema einfallen, daß noch nie in einer Talkshow diskutiert wurde. Allerdings wird nicht jedes Thema gleichermaßen häufig zur Sprache gebracht. Die am häufigsten diskutierten Themen sind folgende:
- Beziehungen, Sex, Charakter/ Lebensart, Familie, Gesellschaft und Mode.
- Im folgenden möchte ich einige Beispiele für die sogenannten Lieblingsthemen aufzählen:
- „Ich bin scharf auf deinen Freund“ (Sonja, 13.7.98)
- „Ich hasse meine Mutter“(Andreas Türck, 9.7.98)
- „Ich liebe nur mich“(Andreas Türck, 30.6.98)
- „Wer schön sein will muss leiden“(Sonja, 26.5.98)
- „Du bist dick und verfressen“(Sonja, 9.7.98)
- „Baby, glaub mir, so ist Sex am schönsten“(Sonja, 19.5.98)
- „Mit dem Kredit in die Gosse“(Hans Meiser, 1.7.98)
- „Mein Bruder ist schwul, ich will das nicht“(Andreas Türck, 19.6.98)
Zumeist ist die Themenformulierung sehr „reißerisch“ gestaltet. Dies geschieht, so denke ich, um die Zuschauer neugierig zu machen und deren Interesse zu wecken.
Es gibt sprachliche Auffälligkeiten in der Themenformulierung, die typisch für das Genre Talkshow sind. Diese möchte ich nachfolgend aufzeigen:
1. Personalisierung (Ich-Botschaften)
Themen, die ein Personalpronomen im Titel haben und jemanden ansprechen sollen oder
aus Sicht eines Gastes formuliert sind. Beispiel: „Du hast Schläge verdient“ oder „Wegen dir habe ich Aids“.
2. Affektivit ä t (Verwendung von Emotionsbegriffen):
Beispiel: „Bei Anruf Angst“
3. Sprachliche Auff ä lligkeiten (Reimform, Redewendungen, Umgangssprache):
Diese dienen der Erhöhung der Aufmerksamkeit des Zuschauers und suggerieren Vertrautheit. Beispiel: „Wer schön sein will muss leiden“.
4. Wertende Formulierungen:
Sie dienen der Provokation und enthalten gängige Vorurteile. Beispiel: „Kleine Männer bringen’s nicht“.
1.7 Die Gäste und ihre Motivation zur Teilnahme an einer Talkshow:
Pro Jahr treten ca.30 000 nicht-prominente Menschen in Gesprächssendungen auf. Grund
hierfür ist nicht nur der kommerzielle Gedanke des Senders, sondern ebenso die persönlichen Motive der Gäste. Bente und Fromm haben in ihrer Studie über Affektfernsehen diese persönlichen Beweggründe näher untersucht.
In „Privatgesprächen vor Millionen“13 werden acht Motivtypen unterschieden:
1. Der Fernsehstar:
Der Fernsehstar „lechzt“ nach Anerkennung. Er möchte im Mittelpunkt stehen und sich selbst inszenieren.
2. Der Patient:
Der Patient möchte ein psychisches oder physisches Leiden bewältigen. Er erhofft sich von seinem Auftritt Hilfe von Experten zu bekommen, die er sonst nicht bezahlen könnte.
3. Der Verehrer bzw. der Kontaktanbahner:
Der Auftritt dieses Typs dient der Herstellung beziehungsweise der Festigung einer Bezie- hung.
4. Der R ä cher:
Der Rächer benutzt seinen Auftritt, um sich an jemandem zu rächen.
5. Der Anwalt in eigener Sache:
Der Anwalt in eigener Sache nutzt seinen Fernsehauftritt um ein subjektiv als ungerecht empfundenes Urteil anzufechten
6. Der Ideologe:
Der Ideologe möchte durch seinen Auftritt seine persönliche Ideologie verbreiten.
7. Der Propagandist:
Der Propagandist möchte mit seinem Auftritt Eigenwerbung betreiben. Er erhofft sich finanzielle Vorteile durch seinen Auftritt.
8. Der Zaungast:
Der Zaungast möchte einen Einblick in die Fernsehwelt gewinnen.
Meistens ist es mehr als nur eine dieser Motivationen, die einen Gast bewegen, im Fernsehen aufzutreten.
1.8 Die Rolle der Experten:
Oft laden Moderatoren neben den vier bis zehn nicht-prominenten Gästen zusätzlich einen
Experten ein. Diese Experten können aus den verschiedensten Berufssparten kommen, so zum Beispiel: Ärzte/innen, Jurist/innen, Psychologe/innen, Heilpraktiker/innen, Astrologen etc. Die Experten sitzen als Nebengäste im Publikum, ihre Aufgabe ist es das Sendungsthema von der wissenschaftlichen Seite zu beurteilen und aufkommende Fragen zu beantworten. Der Einsatz von Experten hat, so denke ich, aus Sicht der Programmacher noch zwei weitere Gründe. Zum einen, dient der Experte als „Lockvogel“ für den Gästetyp „Patient“. Der Hilfe- suchende zuhause sieht, daß man in einer solchen Sendung professionelle Hilfe bekommt, die sonst unbezahlbar wäre. Zum anderen vermute ich, daß der Experte den Rezipienten Seriosität suggerieren soll.
1.9 Die Zuschauer:
Trotz heftiger Medienkritik scheint ein großes Interesse seitens der Zuschauer an Talkshows zu bestehen. Allein die Quantität der Sendungen bescheinigen einen hohen Rezeptionsbedarf. Diese Tatsache läßt vermuten, daß Talkshows individuelle Bedürfnisse befriedigen. Meiner Meinung nach ist der beachtlich hohe Bedarf an Talkshows mit der zunehmenden Vereinsamung der Menschen zu begründen.Talkshows kompensieren den Mangel an fehlenden realen Beziehungen. Sie überbrücken die Einsamkeit und bieten Ersatz für Auseinandersetzungen. Der Zuschauer hat einen realen Bezug zum Studiogast und kann sich mit dem Gezeigten identifizieren. „Der da im Fernsehen hat Krebs, wie ich.“
Andere Zuschauer rezipieren Talkshows, um sich von eigenen Problemen abzulenken.
Ein weiteres Rezeptionsmotiv ist die Aufwertung der eigenen Person oder auch das „sichlustig-machen“ über die Schwächen derer, die sich öffentlich zur Schau stellen. Nach Ansicht der Programmacher der Sendung „Hans Meiser“ bieten Talkshows neben Unterhaltung auch ein Stückchen Lebenshilfe.
1.10. Freiwillige Verhaltensgrundsätze:
Talkshows nehmen seit vielen Jahren im deutschen Fernsehen einen hohen Stellenwert ein. Auch Kinder und Jugendliche, die sich nach Stand der gegenwärtigen Jugendpsychologie stark an den Vorbildern im familiären und gesellschaftlichen Umfeld orientieren, rezipieren Talkshows. Deshalb ist es angezeigt, die Sozialverträglichkeit von Talkshows, die einen Gesamtbeitrag zur Wertebildung in der Gesellschaft leisten, sicherzustellen. „Zu den ethischen Grundlagen einer verantwortlichen Programmpolitik gehören Meinungs- freiheit, Wertepluralismus, Diskriminierungsverbot und das Toleranzprinzip, deren Umset- zung in der Programmpraxis von der Achtung der Menschenwürde, der Persönlichkeitsrechte, der Achtung religiöser Gefühle und des Jungendschutzes getragen sein müssen.“14 Aus die- sem Grunde wurde von dem Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e.V. (VPRT) in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) ein Verhal- tenskodex zur inhaltlichen Ausgestaltung von Talkshows im Tagesprogramm erarbeitet. Dieser Verhaltenskodex stellt „Leitlinien“ dar, zu deren Einhaltung sich private Fernsehanbieter verpflichtet haben. Im folgenden möchte ich die wichtigsten Leitlinien zusammenfassen und darstellen.
Laut Leitlinien muß gewährleistet sein, daß sich der Rezipient frei entscheiden kann. Deshalb sollen unterschiedliche Meinungen (Pro und Contra) möglichst breitgefächert aufgezeigt wer- den.
Extremen Anschauungen, sowie kriminellen Verhaltensweisen soll kein Forum unwidersprochener Selbstdarstellung geboten werden. „Im übrigen dürfen Meinungen deren sozial fragwürdiger Charakter offenkundig ist bzw. außerhalb des Wertepluralismus des Grundgesetzes stehen, nur in dem Maße präsentiert werden, in dem der Moderator in der Lage ist, die Problematik der Meinungen deutlich zu machen. Je fragwürdiger die Meinung ist, desto stärker muß das Sendungsganze ein Gegengewicht schaffen, damit sozialethisch desorientierende Wirkungen bei Kindern und Jugendlichen verhindert werden.“15
Themen wie Sex, Gewalt, Umgang mit Minderheiten und extrem belastende Beziehungskonflikte sind zum Schutze der Kinder und Jugendlichen äußerst sensibel zu behandeln und gegebenenfalls mit der Abteilung Jugendschutz abzustimmen.
Im Umgang mit zwischenmenschlichen Konflikten sollte nicht nur der Konflikt selbst, sondern auch dessen Lösung bzw. Lösungsstrategie aufgezeigt werden. „ Insgesamt soll neben der Thematisierung von negativen Aspekten und Problemen auch Positives Berücksichtigung finden, um sicherzustellen, daß bei Heranwachsenden kein pessimistisches Weltbild entsteht.“16 Weiterhin ist, laut Leitlinien, darauf zu achten, daß „Abweichendes“ nicht als „normal“ und Durchschnittliches nicht als Abweichendes darzustellen ist.
Grundsätzlich sollten vulgäre Ausdrucksweisen vermieden werden. Gelingt es dem Moderator nicht, diese zu unterbinden, so muß die betreffende Passage in der Nachbearbeitung „über- piepst“ werden.
Desweiteren beschreibt der Verhaltenskodex die Aufgaben und die Rolle des Moderators wie folgt: der Moderator ist die zentrale Identifikationsfigur, welche die Gesprächsführung über- nimmt. Er soll sich von Positionen, die im eklatanten Widerspruch zum gesellschaftlichen Konsens stehen, distanzieren. Außerdem ist er verantwortlich für die Einhaltung von Regeln, die einen Meinungsstreit ermöglichen sollen, der von Achtung der Diskussions- teilnehmer/innen untereinander geprägt ist.“17 Er soll Eskalationen, die einen Gesprächsteil-nehmer in seiner Menschenwürde oder seinen Persönlichkeitsrechten herabsetzen, unterbin- den und sich notfalls schützend vor die angegriffene Person stellen.
3. Anspruch und Wirklichkeit von Talkshows:
Nachdem ich mich im Zuge dieser Arbeit eingehend mit den täglichen Talkshows befaßt habe, möchte ich im folgenden untersuchen, inwiefern der Anspruch und die Wirklichkeit von Talkshows zu vereinen sind. Zuvor möchte ich noch anmerken, daß ich mich dabei vor allem auf meine eigenen Beobachtungen und Erfahrungen, die ich durch bewußtes Konsumieren von Talkshows ansammeln konnte, berufen werde.
Die Aufgabe des Moderators besteht, laut Verhaltenskodex, darin, ein Gespräch so zu leiten, daß ein Meinungsstreit entstehen kann, der von gegenseitiger Achtung der Gesprächsteilnehmer untereinander geprägt ist.
Dem würde ich widersprechen, denn im Gegensatz zu der im Verhaltenskodex beschriebenen Aufgabenstellung gibt der Moderator sich die allergrößte Mühe, Konflikte nicht zu verhin- dern, sondern sie stattdessen absichtlich zu provozieren. Diese Provokation kann durch einfa- che sprachliche Mittel erreicht werden. Der Moderator kann seinen Gästen unangenehme Fra- gen stellen: “Wer trägt die Schuld“ oder ironische Bemerkungen machen. Auch kann er den Gast mit falschen Behauptungen oder Vorurteilen konfrontieren, um ihn „anzustacheln“. Wei- terhin besteht für den Moderator die Möglichkeit, dem Gast zu widersprechen oder seine
Antwort einfach nicht zu akzeptieren: „Im Vorgespräch hast du aber gesagt, daß...“
Ein weiteres Mittel der Konfliktinszenierung durch den Moderator sehe ich darin, daß er die Gegnerschaft seiner Gäste oft schon vor deren Auftritt ankündigt:
„Als nächstes kommt Susanne, die sagt, alles was Wolfgang sagt, sei totaler Quatsch“.
Laut Verhaltenskodex ist es die Aufgabe des Moderators, Verantwortung für seine Gäste zu übernehmen und sich notfalls schützend vor sie zu stellen. Allerdings entspricht diese Ideal- vorstellung eines Moderators nicht der Realität. Die Gäste werden von anderen Gästen, vom Publikum und manchmal sogar vom Moderator selbst bloßgestellt. Sie beschimpfen sich ge- genseitig oder werden vom Publikum beschimpft. Durch das zumeist und höchstwahrschein- lich absichtlich stark verzögerte Eingreifen des Moderators wird ein faires Streitgespräch, das 11 auf sachlichen Argumenten beruht, beinahe unmöglich. Stattdessen wird eine Streitkultur for- ciert, bei der die lautesten und unsachlichsten Argumente die Oberhand gewinnen.
An dieser Stelle möchte ich noch anmerken, daß ich noch nie beobachten konnte, daß ein Stu- diogast seine am Anfang der Sendung verkündete These im Laufe der Sendung relativiert hätte.
Ein weiterer Punkt des Verhaltenskodexes besagt, daß möglichst breitgefächerte Meinungen in einer Talkshow vertreten sein sollen, um dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, sich frei für eine der Meinungen zu entscheiden. Auch an diesem Punkt stelle ich fest, daß die Wirklichkeit anders ist.
Nach meinen Beobachtungen besteht fast immer ein auffälliges Ungleichgewicht der Meinungen, so daß die Gäste mit der unterlegenen Meinung verbal angegriffen und „untergebuttert“ werden. Aus diesem Grund glaube ich nicht, daß sich der Zuschauer zu Hause frei entscheiden kann. Weiterhin wird der Rezipient durch Einblendungen, die den Gast noch vor seiner eigenen Stellungnahme mit oft diffamierenden Statements vorstellen, beeinflusst. Beispiel: „Wolfgang, 25, Sozialhilfeempfänger, Schmarotzer aus Überzeugung“.
Diese Einblendungen bleiben meiner Beobachtung nach vom Gast selbst immer unkommentiert, so daß die Frage unbeantwortet bleibt, ob der Gast dieses Statement im Vorgespräch oder vielleicht sogar niemals geäußert hat.
Um zu verhindern, daß Jugendliche ein zu negatives Weltbild bekommen, soll, laut Verhaltenskodex, in Talkshows nicht nur der Konflikt selbst, sondern auch Lösungen bzw. Lösungsstrategien desselben aufgezeigt werden.
Auch diese Leitlinie halte ich in der Realität für kaum berücksichtigt. Meiner Meinung nach eskalieren Konflikte in Talkshows derartig, daß es nahezu unmöglich wird, diese zu schlich- ten. Durch ständige Diffamierungen durch andere Gäste und durch das Publikum, sowie durch das Auftreten von Überraschungsgästen, die intimste Details zu erzählen wissen, wird der Gast derartig in die Enge getrieben und bloßgestellt, daß ein Einlenken völligen „Gesichtsver- lust“ bedeuten würde.
Eine Frage, die in der Diskussion über Talkshows immer wieder auftaucht, ist die, ob die Talkshow eine Schule der Toleranz sei.. Klaus Plake18 bejaht diese Frage, indem er aufzeigt, daß es dem „Normalbürger“, durch die Teilnahme eines Randgruppenangehörigen an einer Talkshow, ermöglicht wird, sich mit dessen Gefühlen, Ängsten, etc. zu identifizieren. Dies halte ich ebenfalls für möglich; ich kann mir sehr gut vorstellen, daß sich ein schnarchender
Heterosexueller problemlos mit einem schnarchenden Homosexuellen identifizieren kann. Allerdings bin ich nicht der Meinung, daß dieser Identifikationsprozess automatisch zu mehr Toleranz führen wird. Außerdem glaube ich, daß diese Identifikation nur bei allgemeinen Themen stattfindet; zum Beispiel Eifersucht, Schnarchen, Ängste.
Beinhaltet das Thema der Sendung aber bereits ein Vorurteil Beispie; “Ihr Lesben seid doch keine richtigen Frauen“, so bin ich mir sicher, daß diese Sendung nicht zu Toleranz führen wird. Meistens sind die Gäste einer solchen Sendung so gewählt, daß das im Titel enthaltene Vorurteil sogar bestätigt wird. In der von mir bereits erwähnten Sendung waren alle eingela- denen Lesben ausgesprochen männlich wirkende Frauen, so daß der Zuschauer den Eindruck bekommen mußte, daß alle Lesben „Mannsweiber“ sind, die ein gestörtes Verhältnis zu ihrer Weiblichkeit haben.
Ich würde die Frage, ob Talkshows zur Toleranzschulung beitragen, also im Gesamtzusammenhang verneinen.
Abschließend und in Hinsicht auf meine Fragestellung nach Anspruch und Wirklichkeit, komme ich zu dem Ergebnis, daß die Wirklichkeit einer Talkshow sehr weit von dem an sie gestelltem Anspruch entfernt ist.
Mir stellt sich die Frage, welchen Zweck der von mir so oft zitierte Verhaltenskodex erfüllen soll, dessen Leitlinien von nahezu allen Talkshows ignoriert werden. Ist er vielleicht nur eine Farce?
Literatur:
- Bente, G., Fromm, B. 1997: Affektfernsehen. Motive. Angesbotsweisen und Wirkung; Leske + Budrich, Opladen
- Braun, Benjamin u.a. 2000: Domian - Der Nachtfalke im Galgengespräch, mal nicht hin- ter der Kamera; Der Galgen - Schülerzeitung der Freien Waldorfschule Bonn; Ausgabe 35; aus: http://www.fws-bonn.de/galgen/index.html?/galgen / ausgaben/35/domian.htm
- Burger, Harald 1991: Das Gespräch mit den Massenmedien; Walter de Gruyter Verlag; Berlin/ New York
- Domian, Jürgen 1999: Extreme Leben - Protokolle und Kommentare; 7. Auflage; vgs Verlagsgesellschaft; Köln
- Freiwillige Verhaltensgrundsätze der im VPRT zusammengeschlossenen privaten Fern- sehveranstalter zu Talkshows im Tagesprogramm; aus: http://www.vprt.de
- Fromm, Bettina 1999: Privatgespräche vor Millionen; UVK Medien
- Hiddemann, Frank1996: Talk als säkuläre Beichte - Jürgen Domian mit EinsLive Talk
Radio in WDR 3; Medien praktisch, Heft 4/96; 29-32; aus:
http://www.gep.de/medienpraktisch/amedienp/mp4-96/4-96/hidd.htm
- Löffler, Udo 2001: „...nur keine solchen Jammergeschichten in meiner Sendung“ - Inter- view mit Jürgen Domian; Online-Radaktion Forum Bildung; aus: http://www.forum- bildung.de/themen/tpl_t36.php3
- Plake, Klaus 1999: Die Industrialisierung der Kommunikation; Primus Verlag; Darmstadt
- Rieger, Tilman 1999: Zwischen Verehrung und Ablehnung - Zur Aneignung der Telefon-
Talkshow DOMIAN unter dem Aspekt der parasozialen Beziehung des Stammpublikums zum Moderator; Fachbereich Erziehungswissenschaften der Philipps-Universität Marburg; aus: http://stud-www.uni-marburg.de/~Rieger/
- von Sinnen, Hella und Domian, Jürgen 1998: Jenseits der Scham; vgs Verlagsgesellschaft; Köln
- Steinbrecher, M., Weiske, M. 1993: Die Talkshow. 20 Jahre zwischen Klatsch und News; München
- Thielmann, Kai 1999: Talkshows - Analyse von Konflikten oder sprachliche Inszenierung
- Voß, Christine 2000: Die täglichen Talkshows - Ein Angebot des Alltages mit Einfluß auf die Gefühlswelt und Identifikation des Rezipienten?; Fachhochschule für Sozialwesen, Kiel; aus: http://www.hausarbeiten.de
- Zbikowski, Wolfram 2000: Domian; vgs Verlagsgesellschaft; Köln
[...]
1 Steinbrecher/Weiske (1993): S.19 ff
2 Vergleich: Christine Voß
3 Vergleich: Bente/Fromm (1997)
4 Steinbrecher/Weiske(1993): S. 21
5 Bente/Fromm (1997): S. 20
6 Bettina Fromm (1999): S. 19
7 Klaus Plake (1999): S. 29
8 Vergleich Harald Burger (1991)
9 Bettina Fromm.(1999): S. 31
10 Bettina Fromm.(1999): S. 35
11 Mundzeck in Frankfurter Rundschau vom 24.07.98
12 Klaus Plake. (1999): S. 30
13 Vergleich Bettina Fromm (1999)
14 VPRT-Homepage:www.vprt.de
15 VPRT-Homepage:www.vprt.de
16 VPRT-Homepage:www.vprt.de
17 VPRT-Homepage:www.vprt.de
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit über Talkshows?
Diese Arbeit beschäftigt sich mit nachmittäglichen Talkshows im deutschen Fernsehen. Sie untersucht die Rollen des Moderators, des Publikums, der Gäste und der Experten. Außerdem werden die Themen, deren sprachliche Gestaltung sowie die freiwilligen Verhaltensgrundsätze von Talkshows analysiert.
Welche Talkshows werden in dieser Arbeit betrachtet?
Die Arbeit bezieht sich auf alle werktäglichen Mittags-Talkshows im deutschen Fernsehen. Die Sendung „Jürgen Fliege“ wird im Kapitel "Anspruch und Wirklichkeit" nicht miteingeschlossen.
Wie definiert die Arbeit den Begriff "Talkshow"?
Die Arbeit definiert Talkshows als Gesprächssendungen amerikanischen Ursprungs, die bestimmte Merkmale aufweisen, darunter werktägliche Ausstrahlung im Tagesprogramm, Seriencharakter, Benennung nach dem Moderator, monothematischer Aufbau, Emotionalisierung der Themen, Anwesenheit eines Studiopublikums und rein unterhaltender Charakter.
Welche Rollen nimmt der Moderator in einer Talkshow ein?
Der Moderator nimmt verschiedene Rollen ein, darunter Gesprächsführer, Gastgeber, Selbstdarsteller, Anwalt der Interessen des Rezipienten und Gesprächsteilnehmer. Seine Aufgabe ist es, eine Beziehung zwischen Gästen und Publikum herzustellen und zu vermitteln.
Welche Funktion hat das Studiopublikum in einer Talkshow?
Das Studiopublikum agiert stellvertretend für die Zuschauer zu Hause und verstärkt positive und negative Reaktionen. Es beeinflusst die Dynamik des Gesprächs und dient als Gradmesser der Gefühle, die den Zuschauern übermittelt werden. Durch einen Warm-Upper werden die Publikumsreaktionen gezielt gesteuert.
Welche Themen werden in Talkshows behandelt?
In Talkshows werden vielfältige Themen behandelt, darunter Beziehungen, Sex, Familie, Gesellschaft, Mode, alternative Heilmethoden, spirituelle Themen, Tod, Straftaten, Politik und psychologische Probleme. Die Themenformulierung ist oft reißerisch und personalisiert.
Welche Motivationen haben Gäste, an einer Talkshow teilzunehmen?
Die Gäste haben unterschiedliche Motivationen, darunter das Streben nach Anerkennung, der Wunsch nach Hilfe bei psychischen oder physischen Leiden, der Wunsch nach Kontaktanbahnung, der Wunsch nach Rache, die Anfechtung eines Urteils, die Verbreitung einer Ideologie, das Betreiben von Eigenwerbung und der Wunsch nach einem Einblick in die Fernsehwelt.
Welche Rolle spielen Experten in Talkshows?
Experten werden eingeladen, um das Sendungsthema von der wissenschaftlichen Seite zu beurteilen und Fragen zu beantworten. Sie dienen auch als "Lockvögel" für hilfesuchende Gäste und sollen Seriosität suggerieren.
Warum sind Talkshows so beliebt beim Publikum?
Talkshows befriedigen individuelle Bedürfnisse und kompensieren den Mangel an realen Beziehungen. Sie überbrücken die Einsamkeit, bieten Ersatz für Auseinandersetzungen und ermöglichen es den Zuschauern, sich mit den Studiogästen zu identifizieren.
Welche freiwilligen Verhaltensgrundsätze gelten für Talkshows?
Freiwillige Verhaltensgrundsätze, die vom VPRT und der FSF erarbeitet wurden, sollen die Sozialverträglichkeit von Talkshows sicherstellen. Sie umfassen Meinungsfreiheit, Wertepluralismus, Diskriminierungsverbot, Achtung der Menschenwürde, Schutz der Persönlichkeitsrechte, Achtung religiöser Gefühle und Jugendschutz. Extreme Anschauungen und kriminelle Verhaltensweisen sollen nicht unwidersprochen dargestellt werden.
Inwiefern weicht die Realität von Talkshows von ihrem Anspruch ab?
Die Realität von Talkshows weicht in vielen Punkten von ihrem Anspruch ab. Konflikte werden oft absichtlich provoziert, Gäste werden bloßgestellt, Meinungen sind oft unausgewogen vertreten, und es werden selten Lösungen für Konflikte aufgezeigt. Die Frage, ob Talkshows zur Toleranzschulung beitragen, wird verneint.
- Arbeit zitieren
- Sabine Winkler (Autor:in), 2001, Die täglichen Talkshows, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/105353