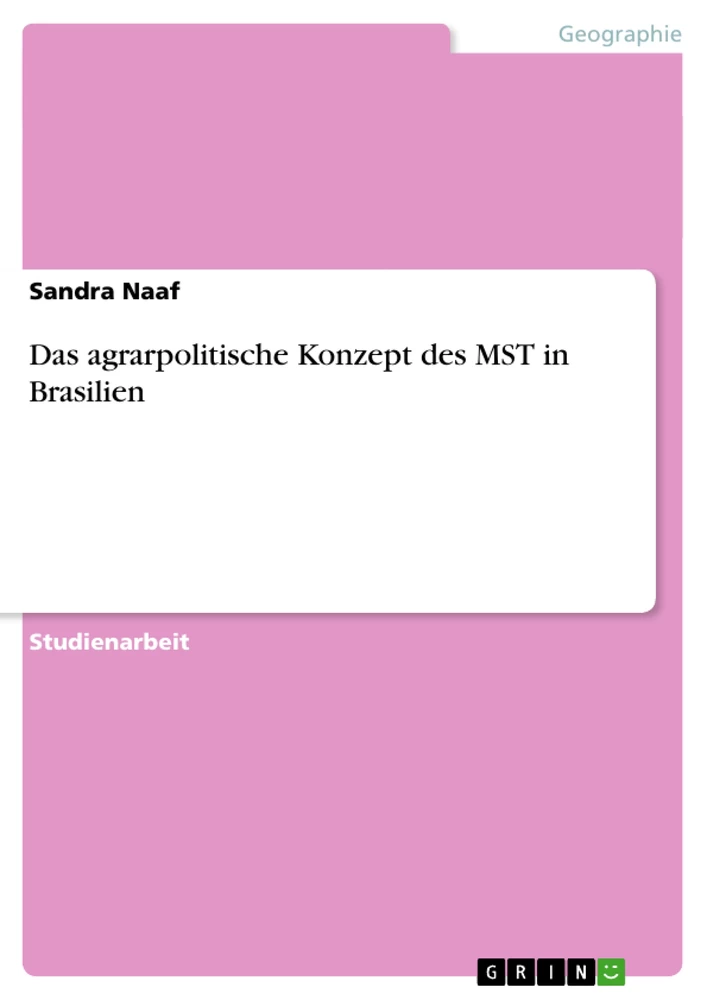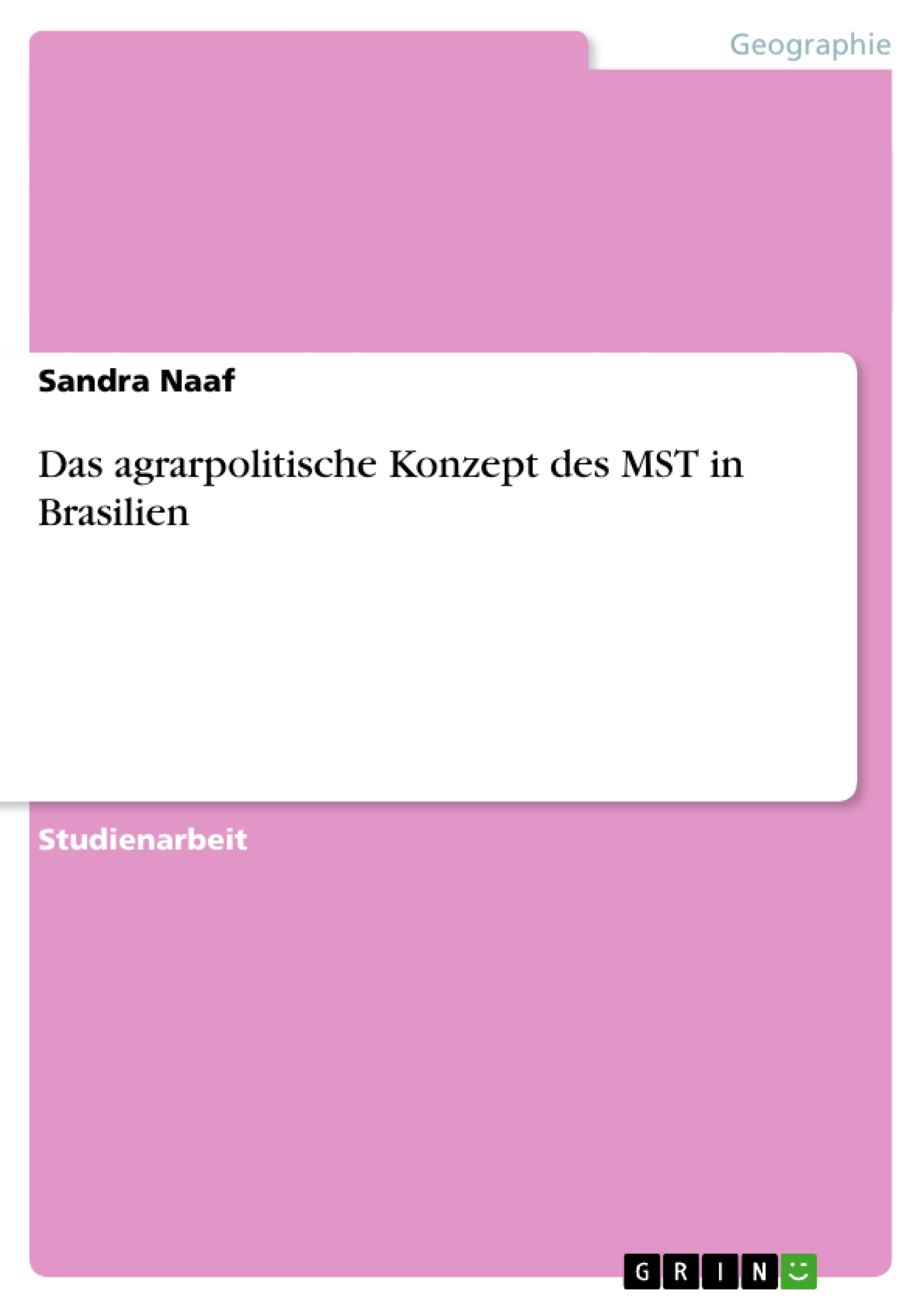INHALTSVERZEICHNIS
I. EINLEITUNG
II. DER BRASILIANISCHE AGRARSEKTOR
2.1 Bedeutung der Landwirtschaft im nationalen Kontext
2.2 Bedeutung der Kleinbetriebe für die ländliche Bevölkerung
2.3 Subsistenz- und kleinbäuerliche Wirtschaft
III. DAS AGRARPOLITISCHE KONZEPT DES MST
3.1 Ausgangsbedingungen
3.2 Theoretische Modelle der Gemeinwirtschaft
3.3 Die Kooperative beim MST
3.4 Einbindung der Mitglieder
3.5 Scheitern des Modells?
IV. SCHLUß
V. LITERATUR
I. Einleitung
Brasilien ist ein Land, daß geprägt ist von starken sozialen Gegensätzen und großen sozialen Spannungen. Die ländliche Situation ist von einer ungerechten Bodenverteilung gekennzeichnet, die sich in einem Nebeneinander von wenigen großen Latifundien und vielen Minifundien äußert, die die brasilianische Gesellschaft vor großen Schwierigkeiten stellt. Besonders deutlich wird dies in der großen Armut auf dem Land und der anhaltenden Migration der ländlichen Bevölkerung in die Städte.
Die Modernisierung der brasilianischen Landwirtschaft in den 60er/70er Jahren sollte für wirtschaftliche Wachstumsimpulse bringen, ohne daß die mit der Landfrage verknüpfte Verteilung der politischen Macht in Frage gestellt wurde. Vielmehr wurde durch staatliche Intervention die Mechanisierung vorangetrieben und die Produktionssteigerung durch Ausweitung der Flächen erreicht. Die Modernisierung führte zur Verschärfung der sozialen Konflikte auf dem Land, die in den 80er Jahren zur Bildung des „Movimento sem Terra“ (MST) gipfelte, die heute als eine der bedeutendsten sozialen Bewegungen in Lateinamerika gilt. Seit mehr als 20 Jahren kämpfen die Bauern innerhalb dieser Bewegung um die Verbesserung ihrer Lebenssituation und der Durchsetzung der Landreform.
In dieser Arbeit soll untersucht werden, welches Konzept der MST vertritt und ob es unter den gegebenen Umständen als durchsetzbar gilt. Dabei wird im ersten Teil die Ausgangssituation der brasilianischen Landwirtschaft aufgezeigt und eine Definition der Kleinbauern gegeben. Im zweiten Teil wird das Konzept vom MST und das von ihnen bevorzugte Genossenschaftsmodell vorgestellt.
Zum Schluß wird eine Bewertung vorgenommen, warum die Durchsetzung des kooperativen Modells bisher gescheitert ist, es aber als solc hes nicht grundsätzlich abzulehnen ist, sondern, wie vom MST verlangt eine grundsätzliche Umstrukturierung der Landwirtschaft notwendig macht.
II. Der brasilianische Agrarsektor
2.1 Bedeutung der Landwirtschaft im nationalen Kontext
In Brasilien leben 37 Mio. Menschen (25% der Bev.) auf dem Land. In der Landwirtschaft waren 1990 23,3% der Bevölkerung tätig, im Industriesektor 22,5%. Der Beitrag des Industriesektors am BIP liegt um ein vierfaches höher als der Anteil der Landwirtschaft, trotzdem hat der Agrarsektor eine wesentliche ökonomische Bedeutung für die brasilianische Wirtschaft, da von ihm die Versorgung des Landes mit Nahrungsmitteln abhängt und die Agrarexportgüter einen wichtigen Anteil bei der Devisenerwirtschaftung des Landes spielen. Die hohe Verschuldung hat zu einer starken Exportorientierung der Produktion im landwirtschaftlichen Sektor geführt, was zu negativen Konsequenzen bei der internen Versorgung mit Lebensmitteln geführt hat. Die starke Ausweitung von Produktionsflächen zugunsten von Exportprodukten (z.b. Soja), geht zu Lasten der Grundnahrungsmittelproduktion und führt gleichzeitig zu einer zunehmenden Verdrängung der Kleinbauern, denen die freien Flächen nicht mehr zur Subsistenzproduktion zur Verfügung stehen. Bei der gleichzeitig anwachsenden Bevölkerungszahl führt diese Entwicklung zu einer Unterversorgung der inländischen Bevölkerung. Die Erzeugung von Grundnahrungsmittel ist seit 1977 jährlich um 1,4% gefallen, während die Produktion für den Export und Industriepflanzungen um 2,53 % bzw. 7,84% gestiegen ist. Gleichzeitig wurden 1980 Nahrungsmittel im Gesamtwert von 2-3 Milliarden US-Dollar importiert.1
Problematisch bleibt die hohe Besitzkonzentration, die als eine der höchsten auf der Welt gilt -während 5% der größten Betriebe etwa 70 % der registrierten Landfläche besitzen, bewirtschaften 50% der kleinsten Betriebe nur 2,2% der Fläche.2Trotzdem ist der Anteil der kleinbäuerlichen Produktion, trotz geringerer Förderung und geringerem Flächenanteil ähnlich hoch wie die der Großgrundbesitzer, und spielt v.a. für die Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmittel eine entscheidende Bedeutung. Kleinbetriebe unter 100 ha hatten 1980 einen Anteil von 50 % am Gesamtwert der agrarischen Produktion, Großgrundbetriebe (über 1.000 ha) hatten trotz der zur Verfügung stehenden Fläche einen
Anteil von 16 %.3Ein Großteil der Fläche (84%) von Latifundien (über 10.000 ha) wird nicht genutzt und dient der Landspekulation. Eine Untersuchung von 1978 (Evaluierung der Agrarstruktur) vom INCRA belegt, daß 38% der potentiell nutzbaren Agrarfläche landwirtschaftlich nicht genutzt wird. Diese gehören zu 90% Großgrundbesitzern.4 Die Produktivität von Großbetrieben beruht in erster Linie auf dem kapitalintensiven Einsatz von Maschinen, (importierten) Hochertragssorten, intensiver Mineraldüngung und dem Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln. Einer Untersuchung der Weltbank hat dennoch gezeigt, daß Großbetriebe oft mit einer geringeren Flächenproduktivität arbeiten als Kleinbetriebe, die 3-14mal höhere Erträge pro Flächeneinheit erzielen, und somit einen wichtigen Beitrag für die Ernährungssicherheit der Bevölkerung leisten.5
2.2 Bedeutung der Kleinbetriebe für die ländliche Bevölkerung
Klein- und Kleinstbetriebe haben eine wichtige Bedeutung für die ländliche Beschäftigungssituation, da deren Produktionssysteme einen höheren Arbeitskräfteeinsatz als große mechanisierte Agrarunternehmen aufweisen. 80 % der in Landwirtschaft Beschäftigten arbeiten in Betrieben bis 100 ha. Der Erhalt der Subsistenzproduktion ist für viele Menschen auf dem Land von entscheidender Bedeutung, da sie das Überleben sichert und als einzige Alternative zum Abwandern in die Städte und zur Verdrängung in Lohnarbeit gesehen wird. Die hohe Urbanisierungsrate von 75% und die anhaltenden Migrationsströme deutet aber darauf hin, das sich die Probleme auf dem Land verstärken. Inzwischen haben 7 Mio. Familien kein oder zu wenig Land, um ihr Auskommen zu finden. Die Zahl der hungernden Menschen wird in Brasilien auf 32-24 Mio. geschätzt, was 22% der gesamten Bevölkerung entspricht.
78% der in Landwirtschaft Tätigen sind ohne soziale Sicherung, nur 22% haben mit einer Carteira de Trabalho Asinada pelo Emregadoreine Mindestsicherung. Mehr als 50 % (= 6,7 Mio.) der ökonomisch aktiven Bevölkerung im Agrarsektor, v.a. Landarbeiter und
kleinbäuerliche Familienbetriebe mit mindestens 40 Std. Wochenarbeitszeit, erwirtschaften lediglich einen Mindestlohn oder weniger im Monat.6
2.3 Subsistenz- und kleinbäuerliche Wirtschaft
Eine Unterscheidung von Subsistenz- oder kleinbäuerliche Wirtschaft läßt sich nicht
eindeutig machen. Als wichtiges Kriterium kann die Marktintegration und die Größe des Landbesitzes angeführt werden. Landbesitz oder mindestens der Zugang zu Land ist entscheidend für die bäuerliche Existenz, da es Produktionsmittel und Produktionsbedingung ist. Als Kleinbauern werden agrarisch orientierte Landarbeiter, Kleinpächter, Tagelöhner, Landvertriebene sowie Bauern mit kleinem oder mittelgroßem Landbesitz verstanden. Dabei definieren sich sowohl Landbesitzende wie auch Landlose über den Status eines kleinbäuerlichen Produzenten. Als Landlos werden Kleinpächter und landwirtschaftliche Lohnarbeiter und Kleinbauern mit weniger als 5 ha Landbesitz verstanden.
Unter Subsistenzwirtschaft versteht man ein „autarkes, geschlossenes System, in dem nur für den unmittelbaren Eigenverbrauch der Familie oder Gruppe ohne Absatz nach außen, d.h. ohne Marktorientierung und Gewinn produziert wird“.7Subsistenzwirtschaft beschränkt sich auf den Anbau weniger Grundnahrungsmittel, der z.T. durch Viehhaltung ergänzt wird, und dient der unmittelbaren Überlebenssicherung. Nur in ganz abgelegenen Gebieten kann von einer reinen Subsistenzwirtschaft gesprochen werden. Subsistenz- bzw. bäuerliche Wirtschaft ist nicht arbeitsteilig organisiert und hat einen hohen Anteil an nicht entlohnter Familienarbeit, in der v.a. unbezahlte Frauenarbeit einen wichtigen Teil der Subsistenzproduktion ausmacht. Aufgrund der gering zur Verfügung stehenden Fläche gelingt es den meisten Bauern nicht, diese Bedürfnisse zu decken. Das hat zur Folge, daß die familiären Arbeitskräfte für Tätigkeiten außerhalb des landwirtschaftlichen Betriebes abgezogen werden, was zur Existenzsicherung des Familienbetriebs dient. Die Bewirtschaftung des eigenen Ackerlandes für die unmittelbare Überlebenssicherung verliert an Bedeutung, was aber nicht unbedingt die Auflösung der bäuerlichen Existenz bedeutet, da diese weiterhin als Identifikationsrahmen dient.
Ein wichtiges Kriterium für die bäuerliche Wirtschaft ist die zur Verfügung stehende Landfläche. Kleinstbauern und -pächter besitzen kleinere Flächen (unter 50 ha), die von der Familie bewirtschaftet werden, während kleinere Bauern (semi-empresarios) Flächen unter 100 ha Größe besitzen, ebenfalls familiär organisiert sind, jedoch über moderne Betriebsmittel (Maschinen und chemische Inputs) verfügen und stärker in den Markt integriert.8Die zur Verfügung stehende Nutzfläche, die meist ungünstigen Naturgrundlangen (schlechte Böden, mangelnder Wasserzugang), die unzureichende Nutzfläche, die geringe Kapitalausstattung und die mangelnde Verkehrsanbindung beeinflussen den Grad der Integration in den Markt. Diese Integration erfolgt beispielsweise über Vertragslandwirtschaft, die v.a. bei den Kleinbauern auf eine hohe Akzeptanz trifft.9
III. Das agrarpolitische Konzept des MST
3.1 Ausgangsbedingungen
Die brasilianische Landlosenorganisation Movimento sei Terra wurde 1985 als nationale Bewegung ins Leben gerufen und kann inzwischen als eine der bedeutendsten sozialen Bewegung in Lateinamerika verstanden werden. Inzwischen zählt sie 23 Millionen Mitglieder. Die Hauptentstehungsfaktoren liegen in der ökonomischen Situation auf dem Land, die durch eine starke Konzentrierung des Landbesitzes in Latifundien, einer starken exportorientierten landwirtschaftliche Produktion und einer hohen Unterbeschäftigung gekennzeichnet ist. Die ab 1950 einsetzende Strukturveränderung in der Landwirtschaft führte durch die verstärkte Mechanisierung und Ausweitung der Flächen im Zuge der Modernisierungsbestrebungen, zu einer wachsenden Zahl landloser Kleinbauern und zur Zunahme von Landkonflikten.
Der MST versteht sich als eine autonome Massenorganisation, deren Hauptziele der Kampf um Land, die Durchsetzung einer Agrarreform und die Verbesserung der Lebensbedingungen der ländlichen Bevölkerung sind. Die wichtigsten Aktionsformen sind
neben Protestmärschen die Landbesetzungen und der anschließende Aufbau von Dorfgemeinschaften, die eine landwirtschaftliche Produktion ermöglichen soll. Die Mithilfe des MST durchgeführten Landbesetzungen ermöglichten zwischen den Jahren 1985 bis 1991 den Aufbau von Hunderten von Agrarreformsiedlungen, mit einer Ansiedlung von 95.000 Bauernfamilien.
Mit den zunehmenden Landbesetzungen stellt sich für dem MST die Frage nach der Organisierung der neuangesiedelten Bauern und der kleinbäuerlichen Produktion, sowie ihre Re-Etablierung als Produzenten in den Markt. Das Bild des Landlosen soll in das eines produktiven Siedlungsbauern umgekehrt werden. Gleichzeitig sollen sie weiterhin als Mitglieder des MST zur Unterstützung der Bewegung beitragen und als Basis erhalten bleiben. Der MST möchte seine Präsenz auf dem besetzten Land unbedingt aufrechterhalten und beweisen, daß Agrarreformmaßnahmen erfolgreich sind.
Die Besetzung des Landes wird von Problemen begleitet, die die Kleinbauern v.a. in der Anfangszeit zur Aufgabe des besetzten Landes zwingt. Neben der Verteidigung des Landes gegen die reaktionäre und militante Demokratische Landunion UDR, eine Vereinigung der Großgrundbesitzer mit ausgerüsteten Privatarmeen, dauert die Anerkennung des assentamento durch Agrarreformbehörde MIRAD mindestens ein Jahr, d.h. die Besetzer müssen mindestens zwei bis drei Ernten ohne jegliche staatliche Unterstützung auskommen. Das Leben in den assentamentos gestaltet sich über Monate und Jahre ungewiß und provisorisch. Vor allen Dingen lassen finanzielle Schwierigkeiten viele Bauern nach kurzer Zeit aufgeben. Die landwirtschaftliche Produktion erfordert gerade in der Anfangszeit finanzielle Inputs, die viele der verschuldeten Bauern nicht aufbringen können. Die erste Ernte kann erst nach frühestens drei Monaten eingebracht werden und neu angelegten langfristigen Kulturen (Maniok, Bananen, Zuckerrohr) produzieren noch nicht. Vor allem aber müssen die Bauern für die Ländereien neue Technologien wiederentdecken oder entwickeln, die den Gegebenheiten angepaßt ist.
Zur Überwindung dieser Schwierigkeiten wird vom MST der Aufbau von Kooperativen vorgeschlagen, die sich aus der gemeinsamen Besetzung entwickelten kollektiven Erfahrung entwickelten und später in einen größeren politischen Zusammenhang gestellt wurden.
3.2 Theoretische Modelle der Gemeinwirtschaft
Dem genossenschaftlichen Modell sind theoretisch zwei Funktionen zugedacht:
Zum einen soll es ein Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der legalisierten assentados leisten, indem es die Rationalisierung der Arbeitskraft, eine Modernisierung und eine bessere Vermarktung ermöglichen soll. Zum anderen soll es durch Politisierung und Bewußtseinsbildung die Mitglieder zu einer Abkehr von der Subsistenzwirtschaft und zu einer Marktintegration bewegen. Genossenschaften sind ökonomische und soziale Vereinigungen, die die wirtschaftliche Förderung ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes bezweckt. Die Gewinne dienen dem persönlichen Einkommen. Durch Gewährung von Krediten, gemeinsamen Verkauf, Herstellung und Veräußerung von Waren, Errichten von Bauten usw. sollen die Mitglieder unterstützt werden. Das genossenschaftliche Konzept kann verstanden werden
a.) als gesellschaftspolitische Ideologie zur Durchsetzung eines „dritten Weges“ oder Sozialismus,
b.) als Instrument der Hilfe zur gemeinschaftlichen Selbsthilfe,
c.) als ideologiefreier, reiner Wirtschaftsbetrieb (Produktionsgenossenschaft),
d.) als Instrument staatlicher Entwicklungspolitik v.a. zur Durchsetzung einer Modernisierung der Landwirtschaft und ausreicheichender Nahrungsmittel- versorgung.
Dabei unterscheidet man zwischen Voll- und Hilfsgenossenschaft. Bei der Vollgenossenschaft sind alle ökonomischen Aktivitäten bis zum individuellen Konsum geregelt und die Integration kann bis zum Grade einer völligen Existenz- und Lebensgemeinschaft gehen. Die Träger und Beschäftigten sind weitgehend identisch. Bei einer Hilfsgenossenschaft sind nur einzelne ökonomische Funktionen eingebunden. Darunter fallen alle Formen von Produktionsgenossenschaften, die lediglich der Förderung der Produktion dienen.
Das Identitätsprinzip der Mitglieder und die aktive Teilnahme an Entscheidungsprozessen, die Freiwilligkeit und die Gleichberechtigung bei der Kooperation sind wichtige Vorraussetzungen für das Funktionieren der Genossenschaft.10
3.3 Die Kooperative beim MST
Der MST geht von einer mangelnden Konkurrenzfähigkeit des kleinbäuerlichen Wirtschaftens durch die Durchsetzung des Kapitals in der Landwirtschaft aus. Um das Überleben zu sichern, wird die Modernisierung der Produktionsstruktur und Aufgabe der rückständigen Familienwirtschaft propagiert. Die kleinbäuerlichen Produktion wird als kaum überlebensfähig gesehen, da sie durch die gegebenen Bedingungen des sie umgebenden kapitalistischen Marktes keine Möglichkeit hat, ihre Verhandlungsmacht zu stärken und der Agroindustrie etwas entgegenzustellen. Durch die kleinbäuerliche Wirtschaftsweise geraten sie wieder in eine marginalisierte Stellung, können nicht konkurrenzfähig werden und werden in Krisenzeiten schnell verdrängt.
Besonderer Schwerpunkt wird daher beim MST auf den Aufbau von Kooperativen gelegt, die den Grundstein für eine dauerhafte Bewirtschaftung legen und die Mitglieder in die Bewegung integrieren soll. Innerhalb der assentamentos werden verschiedene Wirtschaftsformen nebeneinander praktiziert. In den 797 Agrarreformsiedlungen (1993) waren 40% Produktivgenossenschaften und 48 Bauernvereinigungen mit 4.670 Familien dem Genossenschaftssystem des MST verbunden. Das entspricht lediglich 4,1% der angesiedelten Familien.11
Der größte Teil der Assentados bevorzugt weiterhin die individuelle familiäre Wirtschaftsweise oder ist über verschiedene Modelle der Gemeinwirtschaft mehr oder weniger miteinander verbunden. Die traditionelle Zusammenarbeit in den assentamentos umfaßt neben kleineren Nachbarschaftshilfen, den Austausch von Arbeitstagen oder einen Zusammenschluß individuell arbeitender Familien zu kleinen semikollektiven Gruppen, die lediglich in einigen wenigen Bereichen zusammenarbeiten.
Aufgrund der teilweisen geringen Akzeptanz der kollektiven Wirtschaftsform werden von der MST- Führung diese Formen der Kooperation anerkannt. Favorisie rt wird jedoch das Genossenschaftsmodell. Dieses wird als alternatives Gesellschaft- und Wirtschaftsmodell verstanden, das als einziges die Möglichkeit bietet, ein Überleben in kapitalistischen Marktstrukturen zu gewährleisten und gleichzeitig den Aufbau eines neuen Gesell- schaftsmodells möglich machen soll. Das Ziel ist die Modernisierung und die Durch- setzung des Kollektivs als neuer Wertegemeinschaft, die zur Absicherung und Förderung der assentados beitragen soll. Der MST bevorzugt die Produktivgenossenschaften im Sinne eines sozialen wirtschaftlichen Unternehmens, das eine höhere Stufe der Organisation der
Bauern darstellt. Der Bauer soll eine spezifische Arbeit haben und sich spezialisieren, und somit arbeitsteilig arbeiten. Mit einer mechanisierten Landwirtschaft und Anwendung einer verfügbaren und angepaßten Technologie soll ein Überschuß erzielt und gewinnbringend verkauft werden, womit die Produktivgenossenschaften als wirtschaftliches Unternehmen tätig wird. Investitionen sollen der Aufbau weiterverarbeitender Produktionsprozesse für eine industrielle Weiter-verarbeitung und Vermarktung möglich machen. Durch großflächige und zentral gesteuerte Produktion soll die Produktivität erhöht und regionale und nationale Vermarktungsstrukturen gefördert werden. Durch das Zusammenlegen individueller Kredite und einen besserer Zugang zu externen Mitteln (Fonds der PROCERA, einem Agrarkreditprogramm für Agrarreformsiedlungen) können größere Investitionsprojekte durchgeführt werden. Dabei wird angenommen, daß die Produktionsmenge durch konsequente Arbeitsteilung, den Einsatz von Maschinen und einer professionellen Verwaltung erhöht werden könne.12
3.4 Einbindung der Mitglieder
Innerhalb einer Kooperative wird die Homogenität der Mitglieder angestrebt. Bei der Gruppe der Landlosen, die sich aus Landarbeitern, Kleinpächtern, Tagelöhner und Landlosen zusammensetzt, wird versucht die Einigkeit der Mitglieder durch die Ausbildung einer politisch mobilisierenden Identität zu erreichen. Die Ideologie soll die Mitglieder in die Genossenschaften integrieren und zur Überwindung von Gegensätzen in der Gruppe beitragen. Auch spielt die Religion einigende Funktion eine wichtige Rolle, was durch maßgebliche Unterstützung der Kirche für die Bewegung gefördert wird.
Ebenso wichtig für das Funktionieren der Genossenschaften ist die Einsicht der Mitglieder in die Vorteile und den Ablauf des genossenschaftlichen Systems und Bereitschaft zur genossenschaftlichen Kooperation. Bei den Kleinbauern, als ehemals selbständige Individuen besteht eher eine geringe Bereitschaft zur Integration, da ihre persönlichen Entscheidungsprozesse verringert werden. Dies wird als Haupthindernis bei dem Aufbau von Kooperativen gesehen, da Kleinbauern eher an individueller Familienarbeit festhalten. Anders sieht es bei ehemals aus Abhängigkeitsverhältnissen stammenden ehemaligen agrarischen Lohnarbeitern aus, wo die Bereitschaft zur Zusammenarbeit wesentlich größer ist. 13 Beim MST soll diese Bereitschaft durch einen politischen Lernprozeß geschaffen werden. Das Erreichen einer Homogenität erfolgt durch politische Identitätsbildung in regionalen Bildungszentren, den laboratórios, die sich an Führungskräfte und an die Basis richten und den Aufbau neurer Organisationsformen zum Ziel haben. Hier sollen die Teilnehmer zur kollektiven Planung, arbeitsteiligem Vorgehen und unternehmerischem Handeln ausgebildet werden, um letztendlich die kleinbäuerliche Wirtschaftsweise durch bäuerliche Großproduktion zu ersetzen. Die Schulung erfolgt auf ökonomischem und organisatorischem Gebiet mit zum Teil autoritären Charakter, was bei den Bauern auf erheblichen Widerstand stößt.14 Der Aufbau einer Kooperative bedeutet für die Kleinbauern einen Eingriff in die traditionelle Lebensform und familiäre Alltags- organisierung. Die individuellen Verfügungsrechte über Land, Vieh, Maschinen und die eigene Arbeitszeit sind in einer Kooperative aufgehoben. Aber auch die traditionellen Streusiedlungen werden in den campamentos zugunsten eines zentralen Wohnbereiches mit Dienstleistungen und Infrastruktureinrichtungen ersetzt. Das entstehen von konzentrierten Wohnbereichen soll die gemeinschaftliche Versorgung mit Nahrungsmitteln ermöglichen, wodurch die Form der Subsistenzwirtschaft letztendlich abgeschafft, bzw. überflüssig gemacht werden soll.15
3.5 Scheitern des Modells?
Die kooperative Wirtschaftsform hat sich innerhalb der MST-Basis bisher als nicht mehrheitsfähig erwiesen. Die meisten neuangesiedelten Bauern bevorzugen noch immer die individuelle Wirtschaftsweise, da der Privatbesitz und die freie Verfügung über Land als elementar für die eigenständige bäuerliche Existenz angesehen wird. Die Einbindung in das Kollektiv würde die Aufgabe ihres Lebensziels nach eigenem Land bedeuten. Die Identifikation der Mitglieder mit dem Kollektiv ist nicht immer gegeben, da einige eine landwirtschaftliche Produktion für den Markt bevorzugen, andere lediglich an der minimalen Existenzsicherung interessiert sind. Es besteht z.T. eine Uneinigkeit mit der MST-Ideologie, die ein sozialistisches Gesellschaftsmodell anstrebt. Der Anspruch nach der völligen Gleichheit der Mitglieder widerstrebt den Vorstellungen der Bauern, die an der Bewahrung von Differenzen und der eigenen Identität interessiert sind. Die familiäre
Wirtschaftsweise wird gegenüber der arbeitsteiligen Produktion bevorzugt, was dem Streben nach Autonomie und Selbstversorgung gerechter wird. Der Arbeitseinsatz kann entsprechend den familiären Bedürfnissen flexibler gestaltet werden und die Produkte über Direktvermarktung abgesetzt werden. Weiterhin kommen Uneinigkeiten über agro- technische Fragen, unterschiedliche Arbeitserfahrungen und Qualifikation und Streit bei der Verteilung der Produktionsergebnisse hinzu, die den kooperativen Zusammenschluß erschweren.16
Trotzdem hat sich gezeigt, daß Kooperativen durchaus Vorteilhaft für die Mitglieder sind. Die landwirtschaftliche Produktion von Kleinbauern wird durch die Ausbeutung der familiären Arbeitkraft und extremen Anpassung an die Marktbedingungen gesichert. In einem kooperativen Zusammenschluß hingegen kann die Arbeit durch verbesserte Arbeitsbedingungen wie Arbeitsteilung, geregelter Arbeitszeiten und dem Einsatz von Maschinen produktiver eingesetzt und erleichtert werden. Die Arbeitsteilung und Spezialisierung ermöglicht in beschränkten Umfang für die Mitglieder Differenzierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, die durch gezielte Weiterbildung ergänzt werden. Diese umfaßt die Diskussion bei der Arbeit und Förderung der kollektiven Entscheidungsfindung, sowie die Qualifikation für die Arbeit im Kollektiv (neue Arbeitsweisen, Verwaltung der Kooperative).17Durch den Aufbau von Vermarktungsstrukturen, Kauf eines Maschinenparks und den Aufbau kleiner Weiterverarbeitungsindustrien kann eine Modernisierung stattfinden, die das Einkommen auf Dauer sichern könnte.
Bisher ist die Produktivität in den meisten Kooperativen hinter den Erwartungen geblieben. Die ökonomischen Leistungen liegen im Durchschnitt. Trotz der Schwierigkeiten und negativen Faktoren (Lage, Bodenverhältnisse und fehlende Infrastruktur) waren aber positive Erträge zu verzeichnen. Die wichtigen Errungenschaften liegen in nicht- ökonomischen Bereichen, die auf der Ebene der Werte und der qualitativen Verbesserungen liegen. Eine Untersuchung des Landwirtschaftsministeriums und der FAO (1991) zur wirtschaftlichen Situation in den Agrarreformsiedlungen „Prinzipais Indicadores Sócio-Econômicos dos Assentamentos de Reforma Agrária“, kommt zu dem Schluß, daß der Zusammenschluß in Genossenschaften für die Neuansiedlungen die beste Möglichkeit bietet, die Lebenssituation zu verbessern.18
IV. Schluß
In Brasilien hat die auf Export ausgerichtete Landwirtschaft erhebliche Nachteile für die ländliche (und städtische) brasilianische Bevölkerung. Die Vernachlässigung der inländischen Produktion und die Unterversorgung der Bevölkerung zeigen, daß eine auf Export orientierte landwirtschaftliche Produktion nicht das alleinige Ziel der Politik sein darf. Die Erfolge der Großgrundbesitzer gegenüber den Kooperativen und den Kleinbauern liegen weniger der Produktivität, als in der politischen Macht, die es anderen Formen von Bewirtschaftung schwer macht gegenüber der von staatlichen Politik geförderten monokulturellen Produktion zu bestehen.
Mit einer Umverteilung des Landes würden sowohl die bestehenden Machtkonstellationen aufgebrochen und neue Chancen für die Kleinbäuerliche Produktion entstehen. Da Kleinbauern oftmals mit einer einfachen Maschinenausstattung und einem dementsprechend niedrige Mechanisierungsgrad arbeiten, d.h. sehr arbeitsintensiv, würde die Durchführung einer umfassenden Agrarreform dem brasilianischen Staat die Möglichkeit bieten, die Abwanderung aus den ländlichen Gebieten zu verringern und gleichzeitig Arbeitsplätze zu schaffen, die durchaus produktiv und ökologisch sowie kulturell nachhaltiger sind als eine agroindustriell ausgerichtete Agrarpolitik. Die geringe ökologische Belastbarkeit tropischer Standorte führt gerade bei einseitig intensiver Nutzung zu den höchsten Raten der Umweltzerstörung in Form von Wüstenausbreitung, Versalzung der Böden, Waldvernichtung und damit einhergehend zu einer steigenden Erosion, die der landwirtschaftlichen Produktion auf Dauer schaden wird. Gerade auch ausländische Finanzierungshilfen der BRD legen einen besonderen Schwerpunkt auf schonende Landwirtschaft und Schutz der Umwelt. Die Vernachlässigung der Kleinbauern und deren Vertreibung in den Regenwald (und in die Städte) haben langfristige negative Folgen. So ist ein großer Teil der Vernichtung der Regenwälder auf die ungleiche Landverteilung und die fehlende Agrarreform zurückzuführen. Der MST geht mit der Forderung einer Landreform und Unterstützung der Kleinbauern in die richtige Richtung. Als Problematisch erscheint jedoch die einseitige Förderungen der Kooperativen, die von den Kleinbauern nicht ohne weiteres angenommen wird und nicht den Bedürfnissen dieser Gruppe entspricht. Jedoch können Kooperativen gegenüber der Großproduktion durchaus bestehen und mit vermehrter staatlicher Unterstützung könnte es Kleinbauern gelingen, Marktgüter hoher Qualität zu produzieren, was zu einer Absicherung der Produktion im Inland beitragen und den Bauern eine dauerhafte Marktintegration bieten würde.
Letztendlich ist es die Entscheidung der Kleinbauern für welche Produktionsform sie sich entscheiden. Die Unterstützung der Kleinbauern und eine radikale Veränderung der ländlichen Strukturen sind jedoch für die brasilianische Gesellschaft von entscheidender Bedeutung.
V. Literatur
Andrae, Silvio (1998): Land in Sicht? Ländliche Entwicklung und Agrarstrukturen unter dem Einfluß der Landlosenbewegung in Rio Grande do Sul, Mettingen. Barth, Detlef (1998): Brasiliens Verfassung und die Agrarreform, Agrarreform im Prozeß der Transformation und Verfassungsgebung von 1987/88, Mettingen. Bröckelmann-Simon, Martin (1994): Landlose in Brasilien. Entstehungsbedingungen, Dynamik und Demokratisierungspotential der brasilianischen Landlosenbewegung, Mettingen.
Dünckmann, Florian (1998): Die Landfrage in Brasilien. In: Geographische Rundschau, Nr.11, Braunschweig.
Harnecker, Marta (2000): Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra no Brasil. In: Cultura Vozes, Nr.1, Januar/Februar 2000.
Hees, Wolfgang (1994): Ökologischer Landbau, Element im Überlebenskampf brasilianischer Kleinbauern, Mettingen.
Hees, Walter (1996): Menschenrechtsverletzungen kennzeichnen die Situation im ländlichen Brasilien. In: Matices, Nr. 10, 1996, Berlin.
Johnson, Richard-John.(1994): Dictionary of Human Geography, Massachusets. Kohlhepp, Gerd (1996): Strukturprobleme des brasilianischen Agrarsektors. In: Briesemeister, Dietrich (Hrsg.): Brasilien heute: Politik, Wirtschaft, Kultur, Frankfurt a/M.
Müller, Jörg (1984): Brasilien, Stuttgart.
Sangmeister, Hartmut (1996): Probleme der brasilianischen Volkswirtschaft. In:
Briesemeister, Dietrich (Hrsg.): Brasilien heute: Politik, Wirtschaft, Kultur, Frankfurt a/M.
Schürger, Wolfgang: „Gottes Erde, Land für alle“ - Landprobleme in Brasilien und die Rolle der Kirchen. In: Schelsky, Detlef / Zoller, Rüdiger (1994): Die Unordnung des Fortschritts, Lateinamerika-Studien, Frankfurt a/M.
Sick, Wolfgang-Dieter (1993): Agrargeographie, Braunschweig.
Vogtmann, Hartmut (1985): Ökologischer Landbau, Landwirtschaft mit Zukunft, Bad Sonden.
[...]
1Hees, Wolfgang (1994): Ökologischer Landbau, Element im Überlebenskampf brasilianischer Kleinbauern, Mettingen, S. 62.
2Die landwirtschaftliche Tätigkeit konzentriert sich in Brasilien vornehmlich auf die Südregion, da dort die natürlichen Grundlagen günstiger sind als in der trockenen Nordregion. Im Süden entstanden durch die europäischen Einwanderung zusammenhängende, kleinbäuerlich geprägte Siedlungen, die aber durch die Ausweitung der Agrarflächen zunehmend unter Druck gerieten. Ebenfalls die in den 30er bis 50er Jahre geförderten genossenschaftlichen Zusammenschlüsse erhöhten den Druck auf die Kleinbauern, die zur Produktionssteigerung auf Modernisierung angewiesen waren, die sie aber aufgrund mangelnden Kapitals nicht erfüllen konnten, weshalb viele verdrängt wurden. Andrae, Silvio (1998): Land in Sicht? Ländliche Entwicklung und Agrarstrukturen unter dem Einfluß der Landlosenbewegung in Rio Grande do Sul/Brasilien, Mettingen, S.69.
3Der Produktionsanteil von Kleinbetreibe an der Gesamtproduktion liegt bei zahlreichen Gütern (Geflügel, Bohnen, Schweine, Maniok, Eier, Kartoffeln) bei rd. drei Viertel. Bei anderen Agrargütern (Milch, Mais, Kaffee, Weizen, Baumwolle, u.a.) bei annährend 50 %. Nur bei dem Produkten Soja, Orangen, Zuckerrohr und Kaffee erzielen Großgrundbetriebe einen höheren Ertrag je Ha als Kleinbetriebe. Barth, Detlef (1998): Brasiliens Verfassung und die Agrarreform. Agrarreform im Prozeß der Transformation und Verfassungsgebung von 1987/88, Mettingen, S. 98f.
4Barth, Detlef (1998): S. 86.
5 Vogtmann, Hartmut (1985): Ökologischer Landbau, Landwirtschaft mit Zukunft, Bad Soden, S.110. 5
6Barth, Detlef (1998): S.115.
7 Sick, Wolfgang-Dieter (1993): Agrargeographie, Braunschweig, S.80 6
8Man unterscheidet den lokalen Markt mit direkten Austauschbeziehungen und den abstrakten Markt, auf den der Bauer keinen Einfluß hat und wo die Austauschbeziehungen über eine dritte Person gehen (z.B. Zwischenhändler, Kollektive). Bröckelmann-Simon, Martin (1994): Landlose in Brasilien, Entstehungsbedingungen, Dynamik und Demokratisierungspotential der brasilianischen Landlosenbewegung, Mettingen, S. 114ff.
9 Die Vertragslandwirtschaft garantiert den Bauern eine Abnahme der Produkte durch die Agroindustrie. Sie stellt zwar eine Unterordnung des Bauern unter die Erfordernisse des agroindustriellen Kapitals dar, beraubt ihn aber nicht der bäuerlichen Identität. Andrae, Silvio (1998), S.52ff.
10Andrae, Silvio (1998): S.61f.
11Andrae, Silvio (1998): S.128.
12Andrae, Silvio (1998): S. 137.
13Andrae, Silvio (1998): S.63, 106.
14Andrae, Silvio (1998): S.139.
15Andrae, Silvio (1998): S.136.
16Andrae, Silvio (1998): S.163.
17Andrae, Silvio (1998): S.161.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kontext des brasilianischen Agrarsektors?
Brasilien ist von starken sozialen Gegensätzen und einer ungerechten Bodenverteilung geprägt, was zu Armut auf dem Land und Migration in die Städte führt. Die Modernisierung der Landwirtschaft in den 60er/70er Jahren hat die soziale Konflikte verschärft, was zur Bildung des Movimento sem Terra (MST) führte.
Was ist das Ziel dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Konzept des MST und dessen Durchsetzbarkeit, wobei die Ausgangssituation der brasilianischen Landwirtschaft und eine Definition der Kleinbauern gegeben werden. Das Konzept des MST und das bevorzugte Genossenschaftsmodell werden vorgestellt.
Welche Bedeutung hat die Landwirtschaft im nationalen Kontext Brasiliens?
Obwohl nur ein geringer Teil des BIP vom Agrarsektor kommt, ist er für die Versorgung mit Nahrungsmitteln und die Devisenerwirtschaftung wichtig. Die hohe Verschuldung führte zu Exportorientierung, was die interne Versorgung negativ beeinflusst.
Wie ist die Bodenbesitzkonzentration in Brasilien?
Die Besitzkonzentration ist sehr hoch, wobei 5% der größten Betriebe etwa 70% der Landfläche besitzen, während 50% der kleinsten Betriebe nur 2,2% bewirtschaften.
Welche Bedeutung haben Kleinbetriebe für die ländliche Bevölkerung?
Kleinbetriebe sind wichtig für die ländliche Beschäftigungssituation, da sie mehr Arbeitskräfte benötigen als große Agrarunternehmen. Sie tragen wesentlich zur Versorgung mit Grundnahrungsmitteln bei.
Was versteht man unter Subsistenz- und kleinbäuerlicher Wirtschaft?
Subsistenzwirtschaft ist ein autarkes System, das nur für den Eigenverbrauch produziert. Kleinbauern sind agrarisch orientierte Landarbeiter, Pächter, Tagelöhner und Bauern mit kleinem Landbesitz. Die Größe des Landbesitzes und die Marktintegration sind wichtige Kriterien.
Was sind die Ausgangsbedingungen des MST?
Der MST entstand aufgrund der ökonomischen Situation auf dem Land, gekennzeichnet durch Landkonzentration, exportorientierte Produktion und Unterbeschäftigung. Ziel ist der Kampf um Land, die Durchsetzung einer Agrarreform und die Verbesserung der Lebensbedingungen.
Welche theoretischen Modelle der Gemeinwirtschaft gibt es?
Theoretisch soll die Genossenschaft zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen, die Mitglieder politisieren und von der Subsistenzwirtschaft zur Marktintegration bewegen. Genossenschaften sind ökonomische und soziale Vereinigungen zur wirtschaftlichen Förderung der Mitglieder.
Wie sieht die Kooperative beim MST aus?
Der MST geht von einer mangelnden Konkurrenzfähigkeit des kleinbäuerlichen Wirtschaftens aus und propagiert die Modernisierung der Produktionsstruktur und Aufgabe der rückständigen Familienwirtschaft durch den Aufbau von Kooperativen.
Wie werden die Mitglieder in eine Kooperative eingebunden?
Es wird die Homogenität der Mitglieder angestrebt, indem eine politisch mobilisierende Identität ausgebildet wird. Die Religion spielt eine einigende Funktion. Die Mitglieder werden in regionalen Bildungszentren geschult.
Warum scheitert das Kooperativemodell oft?
Die meisten neuangesiedelten Bauern bevorzugen noch immer die individuelle Wirtschaftsweise. Die Einbindung in das Kollektiv würde die Aufgabe ihres Lebensziels nach eigenem Land bedeuten. Ebenso kommen Uneinigkeiten über agrotechnische Fragen, unterschiedliche Arbeitserfahrungen und Qualifikation und Streit bei der Verteilung der Produktionsergebnisse hinzu.
Was sind die Schlussfolgerungen?
Die auf Export ausgerichtete Landwirtschaft hat Nachteile für die Bevölkerung. Eine Umverteilung des Landes würde Machtkonstellationen aufbrechen und neue Chancen für die Kleinbauern schaffen. Der MST geht mit der Forderung einer Landreform und Unterstützung der Kleinbauern in die richtige Richtung, jedoch erscheint die einseitige Förderung der Kooperativen problematisch.
- Arbeit zitieren
- Sandra Naaf (Autor:in), 2001, Das agrarpolitische Konzept des MST in Brasilien, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/105253