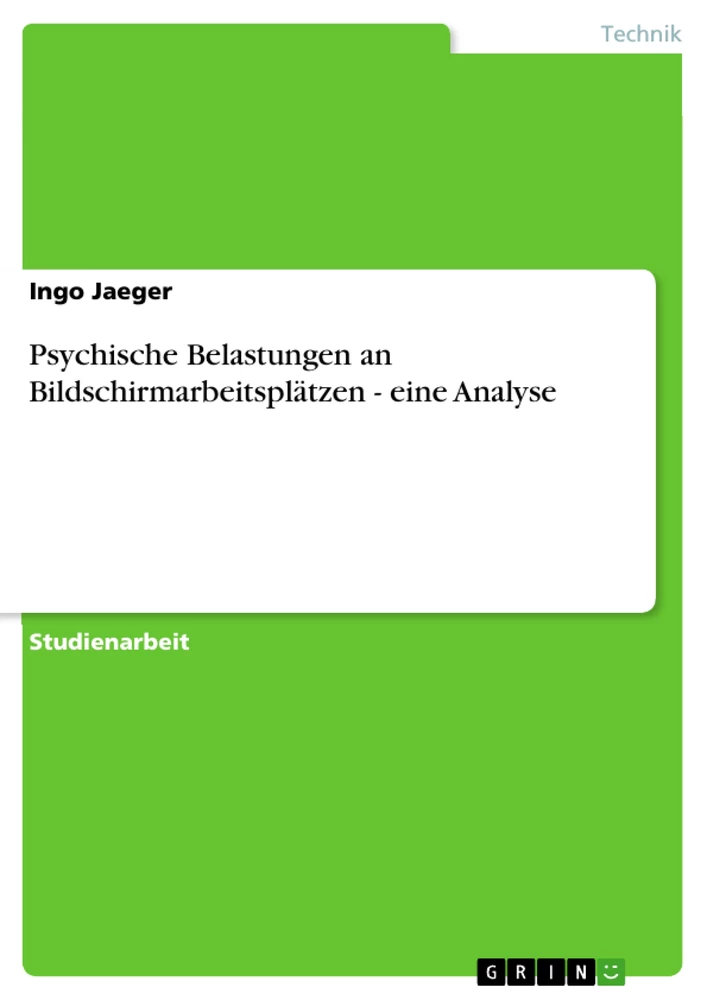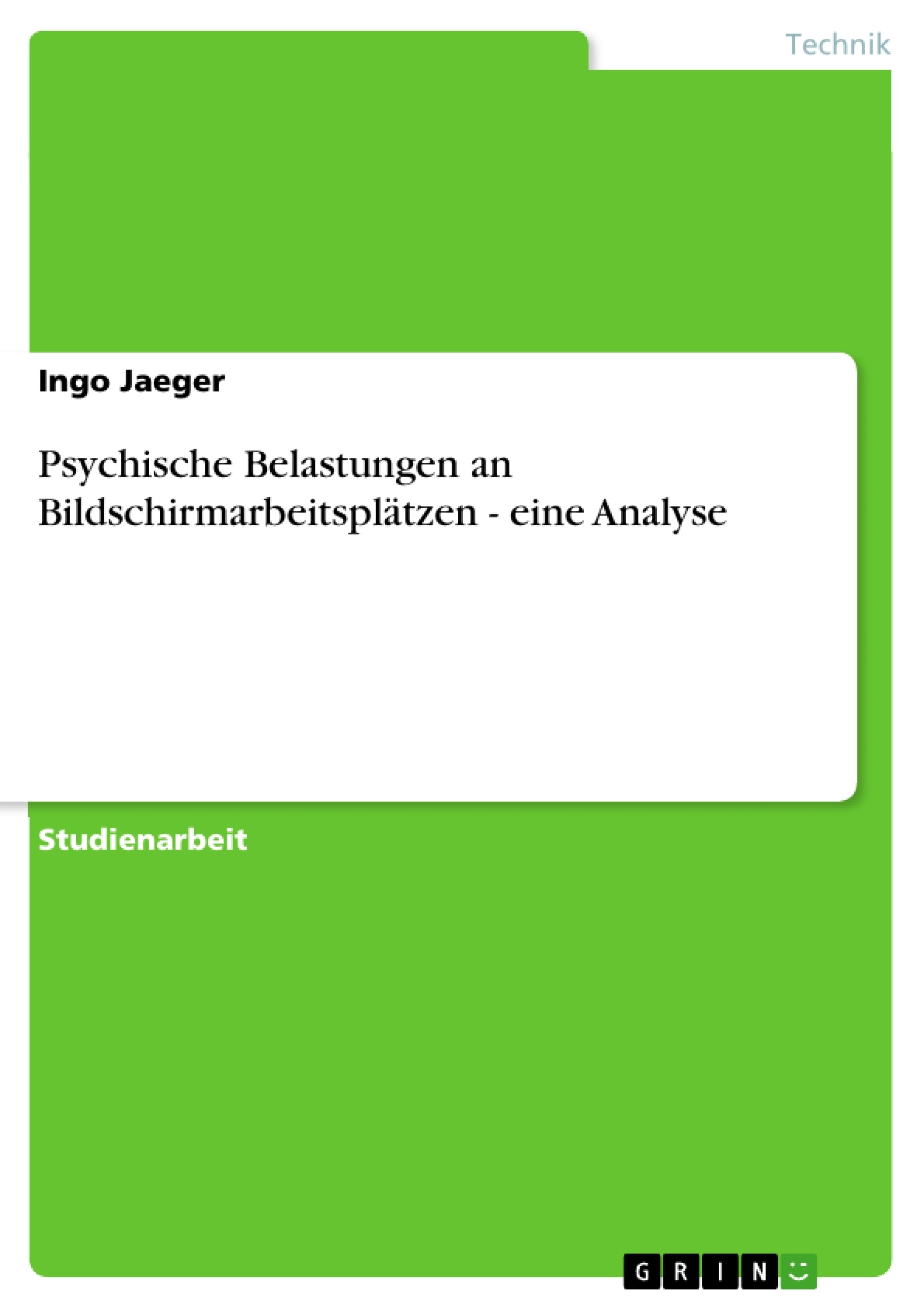Seit dem 20. Dezember 1996 ist die Bildschirmarbeitsverordnung in Kraft. Hiernach wurden Unternehmen verpflichtet, vorbeugende Arbeitschutzmaßnahmen auch für die Bildschirmarbeit zu ergreifen.
Mit dieser Studienarbeit soll versucht werden, einen Leitfaden zur Beurteilung psychischer Belastungen an Bildschirmarbeitsplätzen für den Praktiker zu erstellen, der zudem auf weiterführende Literatur verweist.
In Kapitel 2 wird der Frage nachgegangen, was unter psychischer Belastungen verstanden wird, warum diesen Belastungen am Bildschirmarbeitsplatz heute eine besondere Bedeutung zukommt und wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen aussehen. Dazu wird die Handlungsregulationstheorie und das Tätigkeitsbewertungssystem sowie neuere Untersuchungen vorgestellt.
Im folgenden Kapitel 3 werden gängige Verfahren zur Erhebung psychischer Belastungen an Bildschirmarbeitsplätzen vorgestellt und vergleichend bewertet. Es findet sich auch eine kleine Vorstellung von Kurzverfahren zur Bildschirmarbeitsplatzanalyse unter besonderer Berücksichtigung ihrer Analysefähigkeit von psychischen Belastungen. Daraufhin wird am Ende dieses Kapitels auch ein Instrument ausgewählt, welches in abgewandelter Form bei einem Projekt des Institut für Arbeitswissenschaften und Fachdidaktik des Maschinenbaus - IADM Anwendung fand.
Die Durchführung der Analyse und Auswertung der psychischen Belastung an Bildschirmarbeitsplätzen wird im 4. Kapitel dokumentiert. Die Ergebnisse aus der Untersuchung sollen in ein Modul einer IADM-Verfahrensentwicklung zur Analyse von Bildschirmarbeitsplätzen einfließen. Dieses Verfahren hat vier Schritte. Der in Kapitel 3 ausgewählte Fragebogen bildet für den zweiten Schritt die Grundlage einer detaillierten Analyse von Bildschirmarbeitsplätzen. Bei der Detailanalyse geht es, verkürzt gesagt, um ein stichprobenartiges Experteninterview, bei dem das Projektteam anhand des Leitfadens eines Fragebogens zusammen mit einigen Mitarbeitern die ersten Schwachstellen herausfinden soll. Für den vierten Schritt des IADM Verfahrensmodells soll hier als quantitatives Instrument einen Kurzfragebogen entwickelt werden, der schließlich von allen Mitarbeitern des untersuchten Unternehmens selbstständig beantwortet werden soll.
Dieser Fragebogen wird im fünften Kapitel dieser Arbeit auf der Grundlage einer ausführlichen, nachvollziehbaren Diskussion der Befunde der Detailanalyse entwickelt und vorgestellt.
Inhalt
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen
2.1. Psychische Belastung allgemein
2.2. Handlungsregulationstheorie
2.3. Tätigkeitsbewertungssystem – TBS
2.4. Psychische Belastung am Bildschirmarbeitsplatz
2.5. Gesetzliche Anforderungen
3. Verfahren zur Ermittlung psychischer Belastungen am Bildschirmarbeitsplatz
3.1. BEBA
3.1.1. Kurzbeschreibung
3.1.2. Vollständigkeit Arbeitsaufgabe
3.1.3. Bewertung
3.1.4. Differenzierungskriterien
3.2. SynBa-GA
3.2.1. Kurzbeschreibung
3.2.2. Beispielfrage aus SynBA – Fragebogen zur Belastungsanalyse
3.2.3. Bewertung
3.2.4. Differenzierungskriterien
3.3. RHIA/VERA-Büro
3.3.1. Kurzbeschreibung
3.3.2. Bewertung
3.3.3. Differenzierungskriterien
3.4. Kurzverfahren zur Bildschirmarbeitsplatzanalyse
3.4.1. BiFra - Bildschirmfragebogen
3.4.2. LASI - Kurzfragebogen des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik
3.4.3. EasyChecker - Version 1.2 rev2
3.5. Vergleich und Auswahl
4. Durchführung der Analyse von psychischen Belastungen an Bildschirmarbeitsplätzen .
4.1. Projektrahmen
4.2. Begehung
4.3. Die Auswertung
4.3.1. Zusammentragen und Übertragen der Erhebungsdaten
4.3.2. Gewichtung der Fragen und Oberpunkte
4.3.3. Erstellung der Ergebnisse im Bereich psychische Belastung
4.4. Beispielhafte Darstellung
4.5. Vergleichende Darstellung
4.6. Erfahrungen / Kritik
4.6.1. Gewichtungen
4.6.2. Kritischer Bereich
5. Konzept zur weiteren Durchführung
5.1. Detailanalyse
5.2. Screening aller BAP
5.2.1. Reduzierung der Anzahl der Fragen
5.2.2. Diskussion
6. Zusammenfassung
7. Literatur
8. Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1. : Die vier Grundthesen der Handlungsregulationstheorie
Abb. 2. : Sequentielle Vollständigkeit
Abb. 3. : Ursachen und Folgen arbeitsbedingter Fehlbeanspruchungen
Abb. 4. : „Nicht ohne meinen PC“
Abb. 5. : Charakteristika des Wandels zum Bildschirmarbeitsplatz
Abb. 6. : Beispielfrage aus BEBA-A
Abb. 7. : Beispiel aus BEBA-B
Abb. 8. : Beispiel aus BEBA-C
Abb. 9. : Ergebnisse der SynBA –GA Anwendung
Abb. 10. : Ablauf der RHIA/VERA-Analyse
Abb. 11. : Auswertung mit EasyChecker 1.2
Abb. 12. : Das vier Phasenmodell des IADM
Abb. 13. : Abb. : Kreissektordiagramm - KSD
Abb. 14. : Ablaufplan der Begehung
Abb. 15. : Die drei Schritte der Auswerung
Abb. 16. : Struktur der traditionellen Analysebereiche
Abb. 17. : Neue Säule der IADM Analyse
Abb. 18. : Beanspruchungsreaktionen
Abb. 19. : Ausschnitt aus dem Kriterienbaum
Abb. 20. : Unterpunkte der psychologischen Tätigkeitsanalyse
Abb. 21. : Ausschnitt des Unterpunktes „Arbeitsaufgabe“ aus der BEBA-A-Schablone zum Arbeitsblatt 1
Abb. 22. : Kriterienbaum mit Gewichtungen
Abb. 23. : Tabelle: Ergebnis der psychologischen Tätigkeitsanalyse basierend auf BEBA (ohne Gewichtung der Fragen)
Abb. 24. : Mittelwerte der psychologischen Tätigkeitsanalyse
Abb. 25. : Tabelle: Gewichtungen für den gesamten Bereich der psychologischen Tätigkeitsanalyse nach BEBA
Abb. 26. : Kreissektordiagramm (KSD) des Call-Center Teamleiters
Abb. 27. : Kreissektordiagramm (KSD) der Call-Center Mitarbeiterinnen.
Abb. 28. : Kreissektordiagramm (KSD) des Call-Center Gesamt
Abb. 29. : Tabelle: Typenvergleich psychologische Tätigkeitsanalyse
Abb. 30. : Folie des Typenvergleichs psychologische Tätigkeitsanalyse
Abb. 31. : KSD - Operativer Verkauf
Abb. 32. : KSD - Verkehrszentrale
Abb. 33. : Psychologische Tätigkeitsanalyse Bereich Arbeitstätigkeit
Abb. 34. : oben: Psychologische Tätigkeitsanalyse Bereich Arbeitsorganisation
Abb. 35. : unten: Psychologische Tätigkeitsanalyse Bereich Techniknutzung.
Abb. 36. : Die vier verschiedenen Ansätze zur Ermittlung der Gewichtungsfaktoren
Abb. 37. : Bewertungen und Farben
Abb. 38. : KSD Schablone für BEBA
Abb. 39. : Arbeitsgestaltungsmerkmale von SynBA-GA
Abb. 40. : Anzahl der Felder des kritischen Bereichs bei BEBA
Abb. 41. : Gegenüberstellung der Arbeitsmerkmale von SynBA-KF und von BEBA
Abb. 42. : Zusammenbringen von SynBA und BEBA
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
„Bildschirmarbeit bedeutet vielfach eine erhebliche Arbeitserleichterung. Eine einseitige, bewegungsarme Tätigkeit am Bildschirm kann aber auch besondere Gefährdungen und Belastungen hervorrufen. Viele der typischen gesundheitlichen Beschwerden der am Bildschirm tätigen Menschen lassen sich – oft schon durch einfache Maßnahmen – vermeiden.“1
Seit dem 20. Dezember 1996 ist die Bildschirmarbeitsverordnung in Kraft. Sie ist im wesentlichen die inhaltliche Umsetzung der Bildschirmrichtlinie 90/270/EWG der Europäischen Union. Hiernach wurden Unternehmen verpflichtet, vorbeugende Arbeitschutzmaßnahmen auch für die Bildschirmarbeit zu ergreifen.
In der Literatur finden sich häufig Schwerpunkte zur Beurteilung der unmittelbaren Arbeitsumgebung sowie der Arbeitsmittel. Hierfür gibt es klare Maßstäbe.
Weniger häufig finden sich Methoden und Instrumente zur Beurteilung der psychischen Belastung am Arbeitsplatz und der Arbeitsorganisation.
Mit dieser Studienarbeit soll deshalb versucht werden, einen Leitfaden zur Beurteilung psychischer Belastungen an Bildschirmarbeitsplätzen für den Praktiker zu erstellen, der zudem auf weiterführende Literatur verweist.
In Kapitel 2 wird der Frage nachgegangen, was unter psychischer Belastungen verstanden wird, warum diesen Belastungen am Bildschirmarbeitsplatz heute eine besondere Bedeutung zukommt und wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen aussehen. Dazu wird die Handlungsregulationstheorie und das Tätigkeitsbewertungssystem sowie neuere Untersuchungen vorgestellt.
Im folgenden Kapitel 3 werden gängige Verfahren zur Erhebung psychischer Belastungen an Bildschirmarbeitsplätzen vorgestellt und vergleichend bewertet. Es findet sich auch eine kleine Vorstellung von Kurzverfahren zur Bildschirmarbeitsplatzanalyse unter besonderer Berücksichtigung ihrer Analysefähigkeit von psychischen Belastungen.
Daraufhin wird am Ende dieses Kapitels auch ein Instrument ausgewählt, welches in abgewandelter Form bei einem Projekt des Institut für Arbeitswissenschaften und Fachdidaktik des Maschinenbaus - IADM Anwendung fand.
Die Durchführung der Analyse und Auswertung der psychischen Belastung an Bildschirmarbeitsplätzen wird im 4. Kapitel dokumentiert.
Die Ergebnisse aus der Untersuchung sollen in ein Modul einer IADM- Verfahrensentwicklung zur Analyse von Bildschirmarbeitsplätzen einfließen.
Dieses Verfahren hat vier Schritte. Der in Kapitel 3 ausgewählte Fragebogen bildet für den zweiten Schritt die Grundlage einer detaillierten Analyse von Bildschirmarbeitsplätzen im IADM Verfahren. Dazu muss Abschnitt der psychologischen Tätigkeitsanalyse in traditionelle Untersuchungsbereiche integriert werden.
Bei der Detailanalyse geht es, verkürzt gesagt, um ein stichprobenartiges Experteninterview, bei dem das Projektteam anhand des Leitfadens eines Fragebogens zusammen mit einigen Mitarbeitern die ersten Schwachstellen herausfinden soll.
Für den vierten Schritt des IADM Verfahrensmodells soll hier als quantitatives Instrument einen Kurzfragebogen zu entwickeln werden, der schließlich von allen Mitarbeitern des untersuchten Unternehmens selbstständig beantwortet werden soll.
Dieser Fragebogen wird im fünften Kapitel dieser Arbeit auf der Grundlage einer ausführlichen, nachvollziehbaren Diskussion der Befunde der Detailanalyse entwickelt und vorgestellt.
2. Grundlagen
2.1. Psychische Belastung allgemein
„Für kaum einen anderen Komplex gesundheitlicher Gefährdungen hat man sich stärkere Impulse im Arbeits- und Gesundheitsschutz versprochen, als für den Bereich der psychischen Belastungen. Bisher bestand für diesen Bereich weitgehend eine Regelungslücke. Dies steht im Kontrast zum vollzogenen technisch-organisatorischen Wandel in der Arbeitswelt zu mehr Technisierung und einem hohen Grad an Automation, sowie des wirtschaftlichen Strukturwandels hin zu einer Dienstleitungsgesellschaft.“ (Oppolzer, 12/99)
So ergab sich aus der Zunahme der psychischen Belastungen in den vergangenen Jahrzehnten eine Verschiebung im Belastungsprofil, wobei die klassischen Belastungsfaktoren weiterhin bestehen bzw. sogar zugenommen haben. (ebd.)
Oppolzer zeigt dies am Beispiel der 1996 in den EU Ländern von der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen (Dublin) durchgeführten Repräsentationsbefragung. Weiterhin kommt der Koordinator dieser Studie durch den Vergleich der Ergebnisse von 1991 und 96 zu dem Schluss, dass trotz geringer werdender Arbeitszeit das Arbeitstempo steigt.
Das höhere Arbeitstempo sowie der Verlust von Kontrolle über die eigenen Arbeitsergebnisse macht er für den zunehmenden Stress verantwortlich.
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) sieht den Stress am Arbeitsplatz als das zentrale gesundheitsbezogene Thema des 20. Jahrhunderts. So haben psychische Fehlanforderungen und Belastungen, die sich hauptsächlich aus der Arbeitsaufgabe ergeben, stetig zugenommen. (Hacker/Raum 1993)
Was sind also psychische Belastungen?
„Unter psychischer Beanspruchung ist das Inanspruchnehmen von psychischen Leistungsvoraussetzungen beim Ausführen von Arbeitstätigkeiten zum Erfüllen von übernommenen Arbeitsaufträgen unter gegebenen individuellen antriebs- und ausführungsregulatorischen sowie körperlichen Leistungsvoraussetzungen durch individuelle Arbeitsweisen zu verstehen“ (Richter/Hacker S. 32, 1998)
Die Unterscheidung zwischen Belastung und Beanspruchung wird heute in der ergonomischen Literatur folgendermaßen vorgenommen:
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] Psychische Belastung (engl. stress)
Die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken.
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] Psychische Beanspruchung (engl. strain)
Die zeitlich unmittelbare und nicht langfristige Auswirkung der psychischen Belastung auf die Einzelperson in Abhängigkeit von ihren eigenen habituellen und augenblicklichen Voraussetzungen einschließlich der individuellen Auseinandersetzungsstrategien.
(ebd.) Auch in der DIN 33 405 bzw. der neu überarbeiteten DIN EN ISO 10075-1 und DIN EN ISO 10075-2 werden psychische Belastungen und Beanspruchung beschrieben.
Psychische Belastungen sind demnach alle Einflüsse, die von außen auf den Menschen psychisch einwirken.
Eine Unter- oder Überforderung der psychischen Leistungsfähigkeit durch hohen Zeitdruck oder monotone abwechslungsarme Tätigkeiten kann psychische Ermüdung, Sättigung, Stress, Monotoniezustände oder ermüdungsähnliche Zustände hervorrufen. Dabei können sich psychosomatische Krankheitsbilder ergeben.
2.2. Handlungsregulationstheorie
Um die Integration der Psychologie des Handelns und seiner Regulation mit den Forschungsrichtungen der Sensomotorik und des Denkens in ein einheitliches Konzept wird sich seit Ende der 60er Jahre bemüht.
Diese Forschungsrichtung hat sich mit dem Begriff der Handlungsregulationstheorie (zuerst in Oesterreich, 1981) – HRT durch die Berliner Forschungsgruppe um Walter Volpert etabliert (Oesterreich, 1997). Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen durch ihr konkretes Tun Ziele anstreben und erreichen.
Die Handlungsregulationstheorie geht von vier Grundthesen aus, wie in Abbildung 1 dargestellt. Sie geht in der ersten These davon aus, dass Menschen zielgerichtet handeln. Daraus ergibt sich die Intention des Handelns. Weiterhin findet Handeln immer in gesellschaftlichen Zusammenhängen statt. Deshalb auch die These, dass für das Handeln immer eine gesellschaftliche Einbettung besteht.
Außerdem ist das Handeln auf äußere Gegenstände bezogen, welches die dritte These, die des konkreten Tun beinhaltet.
Schließlich ist Handeln auch als Prozess zu verstehen. Somit geht die letzte These von Prozessen in Handlungsgefügen aus.
Die vier Grundthesen der HRT
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1. : Die vier Grundthesen der Handlungsregulationstheorie
Aus diesen Thesen folgt, dass die gesellschaftlichen und organisatorischen Bedingungen als Handlungsforderungen zu verstehen sind, denen es durch geeignete Handlungen zu entsprechen gilt. Handlungsforderungen im Arbeitsprozess werden als Arbeitsaufgaben bezeichnet (Volpert 1993). Ungeklärt ist jedoch immer noch, wie Ziele psychisch entstehen und zwischen Alternativen entschieden wird.
Aus der Frage, warum außerhalb der Erwerbsarbeit die äußeren Bedingungen weniger Einfluss auf das Handeln und Arbeiten haben als während der Erwerbsarbeit, kommt Oesterreich zum Konzept des vollständigen Handeln. (Oesterreich, 1997)
2.3. Tätigkeitsbewertungssystem – TBS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das recht umfangreiche Konzept, das Tätigkeitsbewertungssystem – TBS, geht davon aus, dass die Vollständigkeit der Tätigkeit durch ihre zyklische bzw. sequentielle sowie ihre hierarchische Struktur bedingt ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2. : Sequentielle Vollständigkeit
Die hierarchische Vollständigkeit wird an dem Niveau und der Vielfalt kognitiver Anforderungen gemessen.(Hacker 1995)
Es gilt als Hilfsmittel für die Analyse, Bewertung und Gestaltung von Arbeitstätigkeiten. Ausgehend von entsprechenden ISO-Standards und Gesetzgebung versucht das TBS sowohl deren Einhaltung in der Arbeitsanalyse zu überprüfen, als auch Verbesserungsmöglichkeiten der Arbeitsgestaltung vorzuschlagen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3. : Ursachen und Folgen arbeitsbedingter Fehlbeanspruchungen
Das TBS hat zwei Untersuchungsmethoden, zum Einen das objektive Tätigkeitsbewertungssystem, TBS-O, welches die objektiven Möglichkeiten für die Förderung psychischer Gesundheit durch die Tätigkeit analysiert und das TBS-S (subjektives Tätigkeitsbewertungssystem), welches die subjektive Definition des Arbeitsauftrages untersucht (Redefinition nach Hackmann 1970)
2.4. Psychische Belastung am Bildschirmarbeitsplatz
„Jeder zweite Erwerbstätige in Deutschland benötig heute PC-Kenntnisse. Im Mai 2000 gaben 52 Prozent aller Erwerbstätigen an, bei ihrer beruflichen Haupttätigkeit einen Computer zu nutzen. Je qualifizierter die Arbeit beziehungsweise je mehr es sich um eine Bürotätigkeit handelt, desto häufiger wird der
PC eingesetzt. So gehört für etwa 90 Prozent der im Büro, in der EDV oder in der Forschung, im Marketing oder in der Werbung Tätigen die Arbeit am PC zum Berufsalltag. Wenig verbreitet ist der Computer im Baugewerbe, in der Landwirtschaft und im Bergbau (Anbauen, Gewinnen, Herstellen). Auch bei Transporttätigkeiten, Reinigung oder Überwachungs- und Sicherungsaufgaben (sonstige Dienstleistungen) spielt er eine geringe Rolle.“
Quelle: Statistisches Bundesamt
(zitiert nach SOZIALPOLITISCHE UMSCHAU, Ausgabe 19, 2001)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4. : „Nicht ohne meinen PC“
Da die Mehrheit der Erwerbstätigen also mit Tastatur und Bildschirm arbeiten, verändern sich auch die Herausforderungen an die Gesunderhaltung der Mitarbeiter. Gesundheit im positiven Sinne, als Fähigkeit der aktiven Lebensgestaltung verstanden..
Negative Auswirkungen der Bildschirmarbeit sind u.a. als Beeinträchtigung des Sehvermögens, Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates durch einseitige Haltungen und bewegungsarme Tätigkeit, psychischer Stress und nervöse Anspannung zu beobachten und dominieren die wissenschaftliche und öffentliche Diskussion. (Wieland-Eckelmann et al, 1996)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5. : Charakteristika des Wandels zum Bildschirmarbeitsplatz
So rückt der Bildschirmarbeitsplatz (BAP) immer mehr in den Mittelpunkt arbeitsgestalterischer und medizinischer Forschung, sowie den Gesetzgebern, um bestimmte Standards durchzusetzen.
2.5. Gesetzliche Anforderungen
Im Rahmen der Gefährdungsanalysen gemäß dem Arbeitsschutzgesetz vom August 1996 sind auch psychische Belastungen durch Arbeitstätigkeiten hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen des allgemeinen Wohlbefindens bzw. der Gesundheit einzuschätzen.
Wenn potentielle Gefährdungen vorliegen, hat der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen zur Veränderung des Ist-Zustandes einzuleiten.(Arbeitsschutzgesetz)
Durch den Erlass der Bildschirmrichtlinie 90/270/EWG durch den Rat der Europäischen Gemeinschaft 1990 wurde der wachsenden Zahl von Bildschirmarbeitsplätzen Rechnung getragen.
Sechs Jahre später wurde die Entscheidung der EU in der Bundesrepublik durch „Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutz-Richtlinien“ in nationales Recht umgesetzt. Es beinhaltet grundlegende Regelungen zum betrieblichen Arbeitsschutz. In diesem Gesetzgebungsrahmen wurde unter anderem die Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) erlassen, die am 20.12.1996 in Kraft trat.
3. Verfahren zur Ermittlung psychischer Belastungen am Bildschirmarbeitsplatz
Die theoretischen und gesetzlichen Grundlagen für die psychische Belastung am Bildschirmarbeitsplatz wurden im letzten Kapitel beleuchtet.
Um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu überprüfen, aber auch einfach die Situation im eigenen Betrieb zu analysieren, bedarf es entsprechender Instrumente und Methoden.
Das bundesweite Forschungsprojekt SANUS hat zu diesem Zweck ein Handbuch zusammengestellt (SANUS: Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmen auf der Basis internationaler Normen und Standards). Dabei werden hauptsächlich Instrumente vorgestellt, die eine Überprüfung von Bildschirmarbeitsplätzen nach EU- konforme Gestaltung zulassen.
Es werden einige Verfahren zur Analyse der Arbeitsorganisation empfohlen, die in diesem Kapitel genauer beschrieben werden.
Für die Grobanalyse empfiehlt die SANUS-Gruppe die Verfahren BEBA, SynBA-GA bzw. SynBA-KF, das ABETO-Verfahren und die subjektive Arbeitsanalyse, kurz SAA.
Zur Feinanalyse werden die drei Verfahren RHIA/VERA-Büro (Regulationshindernisse in der Arbeitstätigkeit / Verfahren zur Ermittlung von Regulationserfordernissen in der Arbeitstätigkeit) (Volpert), KABA (Kontrastive Aufgabenanalyse im Büro) (Volpert) und TBS (Tätigkeitsbewertungssystem)(Hacker) nahegelegt.
3.1. BEBA
Abkürzung: BEBA
Name: Analyse psychischer Belastungen bei Büroarbeit
Autoren: A. Pohlandt, P. Jordan, C. Maßloch, K. Ott - Projektleitung: W. Hacker c/o TU Dresden
Institut für allgemeine Psychologie und Methoden der Psychologioe 01062 Dresden
3.1.1. Kurzbeschreibung
3.1.1.1 Ziel
Mit BEBA sollen psychische Belastungen ermittelt werden, die durch eine ungenügende Gestaltung der Arbeitsaufgabe- und/oder Arbeitsorganisation bedingt sind.
Dabei werden wissenschaftliche Empfehlungen und Richtwerte zur optimalen Arbeits- und Organisationsgestaltung angegeben.
Dies soll zum Erhalt der Gesundheit, sowie zur Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der Mitarbeiter beitragen.
3.1.1.2 Vorgehensweise (Methodik)
BEBA beinhaltet vier Module:
- Information
- Selbstanalyse (BEBA – A)
- Gestaltungsorientierte Analyse (BEBA – B)
- Auswertung und Organisationsdiagnose (BEBA – C)
Zusätzlich enthält BEBA ein Kapitel mit Empfehlungen zur Aufgaben- und Organisationsgestaltung.
3.1.1.3 Fragenstruktur und -umfang
Die Analyse besteht aus insgesamt 19 Fragen, die in drei Bereiche unterteilt werden
- Arbeitsaufgabe
- Arbeitsorganisation und
- Techniknutzung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Merkmale der Arbeitsaufgabe
Die Vollständigkeit der Arbeitsaufgabe ist der grundlegende Gestaltungsleitsatz jeder Arbeit. Jeder Mitarbeiter sollte möglichst vollständige Aufgaben bearbeiten.
Zu vollständigen Aufgaben gehören neben der reinen Aufgabenausführung auch das eigene Vor- und Nachbereiten der Arbeit mit der Möglichkeit zu selbstständigem Planen und Zielsetzen, das Organisieren (Koordinieren) als Abstimmen mit anderen Kollegen und das selbständige Kontrollieren der Güte der Arbeitsergebnisse.
Abzulehnen ist eine Aufgabengestaltung, bei der der Mitarbeiter nur Aufgaben ausführt, die ausschließlich andere Mitarbeiter vorgedacht, geplant, vorbereitet und angewiesen haben und die die Kontrolle der Arbeitsergebnisse stets von anderen Mitarbeitern erledigen lässt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
EINSCHÄTZUNG:
Meine Arbeit führe ich nicht nur aus, sondern plane, koordiniere und überprüfe ich auch selbst.
Antwortmöglichkeiten: trifft niemals zu
trifft überwiegend nicht zu
trifft manchmal zu
trifft überwiegend zu
trifft völlig zu
Abb. 6. : Beispielfrage aus BEBA-A
3.1.1.4 Ablaufplan und eingesetzte Instrumente
In BEBA-A sollen die Mitarbeiter die Fragen selbst beantworten, sowie einen Bogen über körperliche Beschwerden ausfüllen.
In der gestaltungsorientierten Analyse, BEBA-B, wird ein vom Unternehmen Beauftragter die Bildschirmarbeitsplätze bewerten. Dabei soll der Arbeitsplatzinhaber beobachtet und befragt werden.
Zu Beginn werden die Zeitanteile der Teilaufgaben; Vor- und Nachbereitung der eigenen Arbeit, Ausführen (Be- und Verarbeiten von Informationen), Kontrollieren der eigenen Arbeit und Organisieren (Koordinieren der Arbeit mit anderen Personen); ermittelt und später die Aufgaben in einer Tabelle klassifiziert.
Im zweiten Schritt werden die Merkmale der Analysebereiche eingeschätzt, also die Fragen beantwortet.
Merkmale der Arbeitsaufgabe
3.1.2. Vollständigkeit ArbeitsaufgabeDie Vollständigkeit der Arbeitsaufgabe ist der grundlegende Gestaltungsleitsatz jeder Arbeit. Jeder Mitarbeiter sollte möglichst vollständige Aufgaben bearbeiten.
Zu vollständigen Aufgaben gehören neben der reinen Aufgabenausführung auch das eigene Vor- und Nachbereiten der Arbeit mit der Möglichkeit zu selbstständigem Planen und Zielsetzen, das Organisieren (Koordinieren als Abstimmen mit anderen Kollegen und das selbständige Kontrollieren der Güte der Arbeitsergebnisse.
Abzulehnen ist eine Aufgabengestaltung, bei der der Mitarbeiter nur Aufgaben ausführt, die ausschließlich andere Mitarbeiter vorgedacht, geplant, vorbereitet und angewiesen haben und die die Kontrolle der Arbeitsergebnisse stets von anderen Mitarbeitern erledigen lässt.
BEWERTUNG:
Für die Bewertung nutzen Sie bitte die Klassifikation der Teilaufgaben in Vor- und Nachbereiten, Ausführen, Kontrollieren, Organisieren.
Bewertungsstufen:
0 Die Arbeit enthält ausschließlich ausführende Teilaufgaben
1 Die Arbeit enthält neben dem Ausführen eine weitere Klasse von Teilaufgaben (entweder Vor- und Nachbereiten, Kontrollieren oder Organisieren)
2 Die Arbeit enthält neben dem Ausführen zwei weitere Klassen von Teilaufgaben
3 Die Arbeit enthält vollständige Aufgaben, d.h. Vor- und Nachbereiten, Ausführen, Kontrollieren und Organisieren der eignen Arbeit
Abb. 7. : Beispiel aus BEBA-B
3.1.2.1 Generelle Auswertungsform
Die Auswertung und Organisationsdiagnose wird durchgeführt falls, die vorhergehenden Phasen kritische Belastungen aufzeigen. Die Mitarbeiter führen ihre Ergebnisse zusammen, indem sie gemeinsam den Auswertungsbogen BEBA-C ausfüllen.
Anhand von Schablonen für die Bereiche BEBA-A und -B werden die kritischen Bereiche identifiziert und in den Auswertungsbogen von BEBA-C eingetragen.
Anschließend soll das Ergebnis als Diskussionsgrundlage einer Arbeitsgruppe bzw. eines Projektteam dienen, welches Vorschläge zur Umgestaltung erarbeiten soll.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8. : Beispiel aus BEBA-C
3.1.3. Bewertung
3.1.3.1 Praktikabilität
Insgesamt erscheint BEBA als ein kompaktes Instrument, welches dem Praktiker eine konkrete Hilfe für die Durchführung von Analysen der psychischen Belastung am Bildschirmarbeitsplatz sein kann.
Der Aufbau ist übersichtlich, durch knappen Text und unterstützende Grafiken.
Die Fragebögen sind ebenso kopierfähig wie die Auswertungsblätter und Schablonen. Das Auswertungssystem ist schnell zu überschauen und durchzuführen.
Leider fehlt eine EDV Unterstützung.
Auch eine ungefähre Zeitangabe für die Durchführung wäre für die Planung schön gewesen. Immerhin umfasst BEBA-A 15 Seiten, inklusive der Arbeitsblätter, was eine detaillierte Analyse psychologischer Belastungen zulässt.
Die Sprache ist teilweise etwas komplex. Dies ist gerade im Fragebogenbereich von Nachteil, da es dort zu Verständnisschwierigkeiten bei den Mitarbeitern und folglich zu einer Verfälschung des Ergebnisses kommen kann.
3.1.3.2 Präventionsorientierung
Positiv hervorzuheben ist der Anhang mit Gestaltungsvorschlägen, der für alle 19 befragten Bereiche mehrere Problemvarianten bereitstellt mit entsprechenden Gestaltungshinweisen. Dies kann gar als Präventionsorientierung bei der Neueinrichtung von BAPs von Vorteil sein.
3.1.4. Differenzierungskriterien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2. SynBa-GA
Abkürzung: SynBA-GA
Name: Synthetische Beanspruchungs- und Arbeitsanalyse - Gesamtanalyse Autoren: Rainer Wieland-Eckelmann, Andreas Saßmannshausen, Marc Rose
Projektgruppe MenBIT
Bergische Universität – GHS Wuppertal
Gaußstr. 20, Gebäude S. 12
42097 Wuppertal
3.2.1. Kurzbeschreibung
3.2.1.1 Ziel
SynBA ist ein Messverfahren für psychische Belastung und Beanspruchung an Bildschirmarbeitsplätzen. Insbesondere die Konformität mit der EU Bildschirmrichtlinie soll überprüft werden.
Dies geschieht anhand der Analyse von Arbeitsmerkmalen, die für die psychische Belastung relevant sind.
Die Ergebnisse sollen dem Praktiker gezielt Hinweise auf Merkmale liefern, die den Beschäftigten negativ psychisch beanspruchen und somit die Arbeitsproduktivität mindern.
3.2.1.2 Vorgehensweise (Methodik)
Zentrales Bewertungskriterium des Verfahrens ist die Beanspruchungsoptimalität der Arbeit. SynBA-GA geht von positiven/funktionalen sowie negativen/dysfunktionalen Arbeitsbeanspruchungen aus.
16 Arbeitsgestaltungsmerkmale werden so in eine positiv-negativ Skala eingeordnet.
Das Verfahren gliedert sich in zwei Bereiche, den Analyseteil, der von den Beschäftigten zu beantworten ist und den Bewertungsteil, der anhand eines besonderen Auswertungsvorgehens vom verfahrenskundigen Anwender zu bearbeiten ist.
3.2.1.3 Fragestruktur und -umfang
Der Analyseteil beinhaltet den
- Erhebungsbogen zur Tätigkeitsbeschreibung und den
- Fragebogen zur Belastungsanalyse
Der Erhebungsbogen zur Tätigkeitsbeschreibung umfasst 4 Teilbereiche ET1 bis ET4. ET1 stellt zwei Felder zur Verfügung und dient zur Identifikation innerhalb des Betriebes.
In ET2 soll der eigene Arbeitsbereich eingeordnet werden, wobei 9 Auswahlmöglichkeiten bestehen und ein optionales Feld. Maximal drei Bereiche dürfen angekreuzt werden, wobei diese jeweils mit Noten von 1 bis 3 bewertet werden sollen.
ET3 fragt nach den prozentualen Anteilen der Arbeit ohne Nutzung des Computers, mit direkter Nutzung des Computers bzw. Bildschirms sowie nach dem Anteil organisatorischer Aufgaben.
Schließlich sollen in ET4 die Tätigkeiten am Bildschirm genauer spezifiziert werden. Es werden 9 Tätigkeiten angeboten, sowie zwei Optionsfelder auf die prozentuale Anteile verteilt werden sollen.
Im Fragebogen zur Belastungsanalyse werden insgesamt 16 Fragen gestellt. Diese unterteilen sich in fünf Untergruppen:
- Aufgabenanforderungen (4 Fragen)
- Tätigkeitsspielraum (3 Fragen)
- Regulationsbehinderungen (5 Fragen)
- Leistungskontrolle (2 Fragen)
- Kooperation/Kommunikation (2 Fragen)
Die Fragen bestehen aus einer Aussage, die vom Befragten anhand einer Skala von 0 – „trifft überhaupt nicht zu“ bis 4 – „trifft vollständig zu“ in den drei SynBA-Schnittstellen jeweils zu bewerten sind.
Die SynBA-Schnittstellen sind:
Organisations-System-Schnittstelle (OSS) – organisatorische, System-Aufgaben-Schnittstelle (SAS) – individuelle/persönliche und Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS) – interaktive Aufgaben.
3.2.2. Beispielfrage aus SynBA – Fragebogen zur Belastungsanalyse
R3) Die Arbeitsbedingungen sind schlecht, der Arbeitsablauf ist häufig gestört.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2.2.1 Ablaufplan und eingesetzte Instrumente:
SynBA-GA basiert auf Fragebögen die von den Mitarbeitern ausgefüllt werden. Anschließend werden diese vom verfahrenskundigen Anwender ausgewertet.
Das Verfahren untergliedert sich in zwei grobe Bereiche,
- den Analyse- sowie
- den Bewertungsteil. Der Analyseteil enthält den
Erhebungsbogen zur Tätigkeitsanalyse und den
Fragebogen zur Belastungsanalyse.
Der Bewertungsteil enthält die
Auswertungshandbuch mit entsprechenden Vorschriften und Kriterien wie den
Auswertungsbogen.
3.2.2.2 Generelle Auswertungsform
Die ermittelten Kennwerte des SynBA-GA Verfahrens werden auf mehrere Ebenen bezogen. Die Tätigkeitsbeschreibung dient zur Klassifizierung durch eine vom SynBA-Team gewonnene „Typologie von Bildschirmarbeitsplätzen“. Diese basiert auf Untersuchungsdaten von 400 Bildschirmarbeitsplätzen.
Die Ergebnisse des Fragebogens zur Belastungsanalyse werden in den Auswertungsbogen in eine Bewertungsskala von 0 bis 2 übertragen. Hier werden insgesamt 9 Kennwerte errechnet; 5 für die Gestaltungsbereiche, 3 für die Schnittstellen und ein Gesamtkennwert.
Der Gesamtkennwert ist der erste Maßstab für einzuleitende Gestaltungsmaßnahmen. Die Orientierung erfolgt über eine angegebene Tabelle.
Weiterhin soll er einen Vergleich mit anderen Untersuchungen ermöglichen -> Benchmarking Im zweiten Schritt werden die drei Kennwerte für die Schnittstellen genauer betrachtet.
Hierüber lässt sich feststellen in welchen Aufgabenbereichen dringlichen Gestaltungsbedarf besteht.
Die Kennwerte für die Gestaltungsbereiche werden im dritten Schritt analysiert. Sie geben Hinweise auf die zu verbessernden inhaltlichen Bereiche.
Schließlich werden im vierten Schritt die Einzelmerkmale betrachtet, wenn in den vorherigen Schritten mindestens eine Schnittstelle, wie auch mindestens ein Gestaltungsbereich als gestaltungsbedürftig identifiziert wurde.
Es wird noch darauf verwiesen, dass bei einer Umsetzung von Verbesserungen, die angrenzenden Bereiche auch zu berücksichtigen sind. Die durch den Organisationsablauf oder -aufbau eng miteinander verknüpften Arbeitsplätze sollen dabei im Zusammenhang betrachtet werden.
Das weitere Vorgehen orientiert sich am SANUS-Vorgehensmodell. Zusammen mit den Beschäftigten soll entschieden werden, ob eine Feinanalyse nötig ist oder konkrete Gestaltungsmaßnahmen erarbeitet werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 9. : Ergebnisse der SynBA –GA Anwendung
3.2.3. Bewertung
3.2.3.1 Praktikabilität
SynBA-GA ist für den fachkundigen Praktiker gedacht.
Der Erhebungsbogen zur Tätigkeitsbeschreibung ist ausführlich und gibt Optionen für eigene Antworten.
Die Fragebögen sind ebenso kopierfähig wie das Auswertungsmanual.
Der Fragebogen zur Belastungsanalyse ist mit 16 Fragen nicht gerade umfangreich, erhält seine Komplexität aber durch die jeweils drei Antwortebenen.
Dem Befragten werden im Fragebogen keine zusätzlichen Erläuterungen zum Thema zur Verfügung gestellt.
Unpersönlich wirken die Antwortmöglichkeiten, da sie in der dritten Person gehalten sind. Durch einfaches Ankreuzen ist ein schnelles beantworten möglich.
Der Auswertungsbogen hingegen besteht aus relativ kleinen Feldern, in den die 48 Antworten zu übertragen sind. Dennoch ist ein Vorteil, dass auf nur einer Seite das gesamte Ergebnis Platz findet.
Die Bewertungsskala für Teil 1 ist übersichtlich in einer Tabelle untergebracht, dies fehlt leider für die Schritte 2 und 3, die im Text etwas untergehen.
In Punkto Gestaltungsvorschläge ist das Verfahren recht dürftig. Hier wird auf das SANUS Vorgehensmodell verwiesen. Die konkreten Gestaltungsmaßnahmen sollen zusammen mit den Mitarbeitern entwickelt werden, was auf der einen Seite sehr offen wirkt, aber eine Orientierungshilfe vermissen lässt.
Hier wäre eine kurze Zusammenfassung der unternommenen Gestaltungsmaßnahmen der schon durchgeführten Analysen hilfreich.
Die Suche nach entsprechender Hilfe im angegebenen Anwendungsbeispiel: Referenzarbeitsplatz war leider erfolglos.
Folglich kann die Bewertung des SynBA-GA Ergebnisses nur erfolgreich in Begleitung eines Experten durchgeführt werden, der mit den „bewährten arbeitspsychologischen Kriterien zur beanspruchungsoptimalen und produktivitätsförderlichen Gestaltung von Bildschirmarbeit“ ausgestattet ist.
Eine EDV Unterstützung ist leider nicht vorhanden
3.2.3.2 Präventionsorientierung
Ein spezielles Kapitel ist der Präventionsorientierung nicht gewidmet.
Dennoch können die Erfahrungswerte der 400 analysierten Arbeitsplätze auf besondere Bereiche aufmerksam machen, wo wahrscheinlicher Gestaltungsbedarf auftreten wird. Die Typologie von Bildschirmarbeitsplätzen sowie die Tabelle mit der Übersicht der Gesamtkennwerte bezogen auf Arbeitsbereiche helfen hierbei.
3.2.4. Differenzierungskriterien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
Häufig gestellte Fragen: Language Preview
Was ist das Ziel dieser Language Preview?
Diese Language Preview bietet eine umfassende Vorschau auf ein Dokument zum Thema psychische Belastungen am Bildschirmarbeitsplatz. Sie beinhaltet das Inhaltsverzeichnis, die Ziele, Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Was sind die Hauptthemen, die in dieser Language Preview behandelt werden?
Die Hauptthemen umfassen die Grundlagen psychischer Belastung, die Handlungsregulationstheorie, das Tätigkeitsbewertungssystem (TBS), psychische Belastung am Bildschirmarbeitsplatz und die relevanten gesetzlichen Anforderungen.
Welche Verfahren zur Ermittlung psychischer Belastungen am Bildschirmarbeitsplatz werden in dieser Language Preview vorgestellt?
Die Language Preview stellt verschiedene Verfahren vor, darunter BEBA (Analyse psychischer Belastungen bei Büroarbeit), SynBA-GA (Synthetische Beanspruchungs- und Arbeitsanalyse - Gesamtanalyse), RHIA/VERA-Büro (Regulationshindernisse in der Arbeitstätigkeit / Verfahren zur Ermittlung von Regulationserfordernissen in der Arbeitstätigkeit) sowie Kurzverfahren wie BiFra, LASI und EasyChecker.
Was ist BEBA und wie funktioniert es?
BEBA ist ein Verfahren zur Ermittlung psychischer Belastungen, die durch eine ungenügende Gestaltung der Arbeitsaufgabe und/oder Arbeitsorganisation bedingt sind. Es besteht aus vier Modulen: Information, Selbstanalyse (BEBA – A), gestaltungsorientierte Analyse (BEBA – B) und Auswertung und Organisationsdiagnose (BEBA – C).
Was ist SynBA-GA und wie wird es angewendet?
SynBA-GA ist ein Messverfahren für psychische Belastung und Beanspruchung an Bildschirmarbeitsplätzen. Es analysiert Arbeitsmerkmale, die für die psychische Belastung relevant sind, und besteht aus einem Analyseteil (Fragebögen) und einem Bewertungsteil (Auswertungshandbuch).
Was ist die Handlungsregulationstheorie (HRT) und welche Bedeutung hat sie im Kontext der psychischen Belastung?
Die Handlungsregulationstheorie beschäftigt sich damit, wie Menschen durch ihr konkretes Tun Ziele anstreben und erreichen. Sie geht von vier Grundthesen aus: zielgerichtetes Handeln, gesellschaftliche Einbettung, konkretes Tun und Prozesse in Handlungsgefügen. Sie hilft, die gesellschaftlichen und organisatorischen Bedingungen als Handlungsforderungen zu verstehen.
Was ist das Tätigkeitsbewertungssystem (TBS) und wozu dient es?
Das Tätigkeitsbewertungssystem (TBS) ist ein Konzept zur Analyse, Bewertung und Gestaltung von Arbeitstätigkeiten. Es untersucht die Vollständigkeit der Tätigkeit in Bezug auf ihre zyklische/sequentielle und hierarchische Struktur. Es gibt zwei Untersuchungsmethoden: TBS-O (objektiv) und TBS-S (subjektiv).
Welche gesetzlichen Anforderungen sind im Zusammenhang mit psychischer Belastung am Bildschirmarbeitsplatz zu beachten?
Im Rahmen der Gefährdungsanalysen gemäß dem Arbeitsschutzgesetz sind auch psychische Belastungen durch Arbeitstätigkeiten hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen des allgemeinen Wohlbefindens bzw. der Gesundheit einzuschätzen. Die Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) setzt die EU-Bildschirmrichtlinie 90/270/EWG in nationales Recht um.
Was beinhaltet das Projektrahmen im Kapitel 4?
Das Projektrahmen im Kapitel 4 beschreibt die Durchführung der Analyse und Auswertung der psychischen Belastung an Bildschirmarbeitsplätzen, einschließlich der Begehung, Auswertung der Erhebungsdaten, Gewichtung der Fragen, Erstellung der Ergebnisse und vergleichende Darstellung.
Welche Kritikpunkte werden im Kapitel 4 bezüglich der Analyse und Auswertung psychischer Belastungen genannt?
Im Kapitel 4 werden Kritikpunkte bezüglich der Gewichtungen der Fragen und des "kritischen Bereichs" der Analyse angesprochen.
Was beinhaltet das Konzept zur weiteren Durchführung im Kapitel 5?
Das Konzept zur weiteren Durchführung umfasst eine Detailanalyse und ein Screening aller Bildschirmarbeitsplätze (BAP), einschließlich der Reduzierung der Anzahl der Fragen und anschließender Diskussion.
- Quote paper
- Ingo Jaeger (Author), 2001, Psychische Belastungen an Bildschirmarbeitsplätzen - eine Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/105140