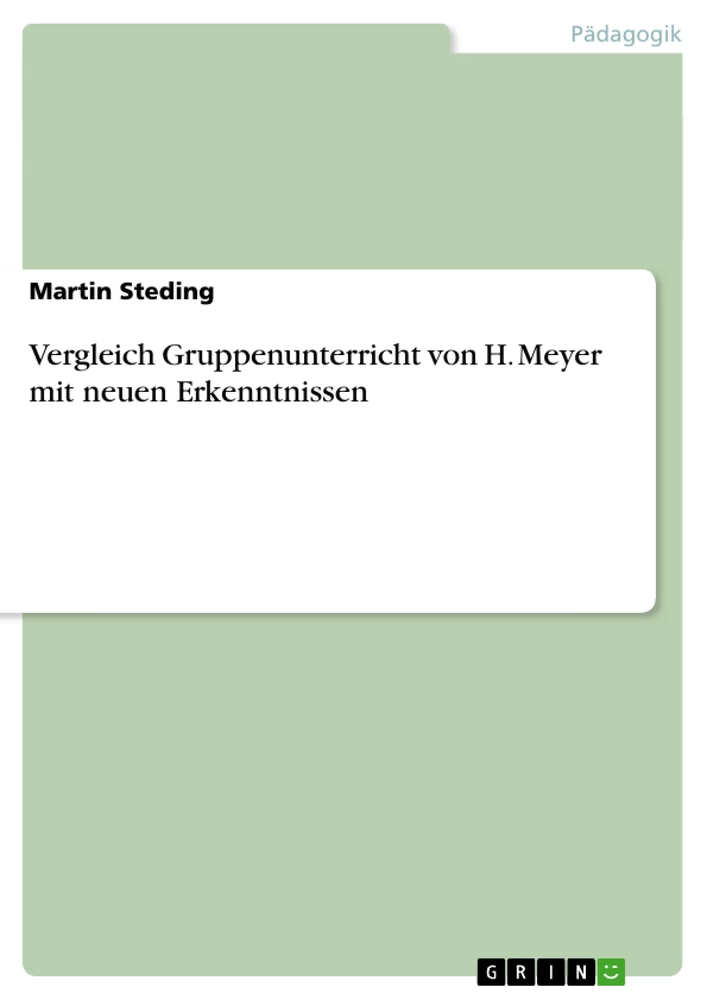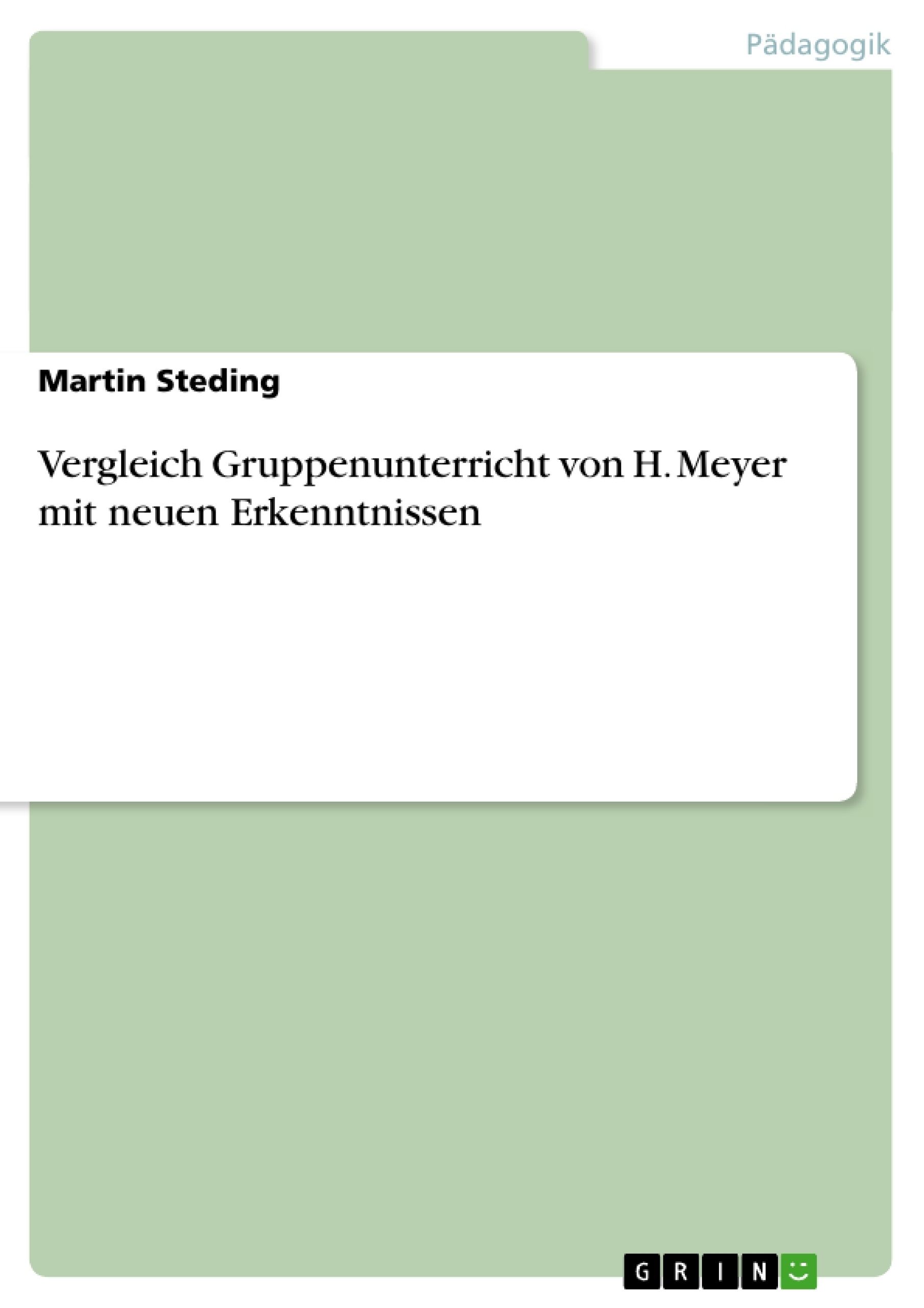Vergleich Gruppenunterricht von H. Meyer mit neuen Erkenntnissen
1. Einleitung
In diesem Teil des Referates möchte ich auf die Erkenntnisse von Karl Fürst bezogen auf den „traditionellen“1 Gruppenunterricht (GU) von Hilbert Meyer eingehen. Welche Punkte können bestätigt, welche Punkte können ergänzt werden bei Gruppenunterricht2 mit der Arbeitsform Gruppenarbeit (GA)3.
2 Ratschläge zum Gruppenunterricht nach Hilbert Meyer
Folgende acht Punkte4 sollten bei der Planung von GU berücksichtigt werden:
I. Ist das Thema für GU geeignet?
II. Haben die Schüler die entsprechenden Lernvoraussetzungen?
III. Themengleiche o. Themendifferenzierte Aufgabenstellung für die Gruppen?
IV. Wie soll der Arbeitsauftrag formuliert werden? Geschlossene, offene, oder freie Arbeitsaufträge
IVa Verständnissicherung
V. Kriterien für Gruppenbildung
VI. Art der Gruppenbildung
VII. Räumliche Voraussetzungen
VIII. Spielregeln der Gruppenarbeit einüben
IX. Den Ablauf der Gruppenarbeit besprechen/ Einübung von Arbeitstechniken
I Eignung des Themas für den GU
Um einen hohen Aufforderungscharakter für den GU zu haben, sollte das Thema aus dem Erfahrungsbereich der Schüler kommen und ihre Interessenlage ansprechen.5 (Thema von Innen). Themen von Außen kommen von der Lehrkraft (m. E. in den meisten Fällen), von Dritten und dem Umfeld der Schule.
Zur Themenfindung gibt es mehrere Möglichkeiten
- Themenfindung durch Widerspruch bzw. Konflikt.
- Themen mit unzureichenden Angaben.
- Themen mit überflüssigen Angaben.
- Themen mit mehreren Lösungsmöglichkeiten.
Anmerkung
Je erfahrener eine Lehrkraft mit verschiedenen Unterrichtsmethoden ist, desto fun- dierter kann eine Entscheidung für oder gegen sinnvollen Einsatz von GU erfolgen.
II Lernvoraussetzung der Schülerinnen und Schüler
X. Hierbei stellt sich die Frage nach bereits vorhandenen Vorkenntnissen und Methodenkompetenz der Schülerinnen und Schüler über Gruppenarbeit. Ein Zusammenhang besteht weiterhin mit den Punkten VIII (Spielregeln der Grup- penarbeit einüben) und IX (Den Ablauf der Gruppenarbeit besprechen/ Ein- übung von Arbeitstechniken).
Anmerkung
Ebenso kann man die Frage stellen „Hat die Lehrkraft die entsprechenden Lehrvor- aussetzungen?“ Entsprechend der Typisierung6 von Lehmann-Grube ist meine Ein- schätzung, dass die Mehrheit der Lehrkräfte von den Typen 1 und 2 repräsentiert werden7.
III Themengleiche o. themendifferenzierte Aufgabenstellung für die Gruppen
Themengleich z. B. eine Collage, ein Rollenspiel.
- Es sollten mindestens drei Schüler das Thema bearbeiten können.
- Erarbeitung in Kleingruppen mit Vergleich der Ergebnisse im Plenum.
Themendifferenziert z. B. Pro-Contra-Diskussionen.
- Es werden verschiedene Aspekte in Kleingruppen erarbeitet und dann im Plenum gemeinsam ausgewertet.
Anmerkung
Ein Vergleich der Gruppenleistungen und -fortschritte ist aufgrund der unterschiedlichen Aufgabenstellung während des GU nicht möglich.
Bereits bei der Aufgabenstellung hat die Lehrkraft wesentliche Lenkungsmöglichkeiten in bezug auf den Verlauf und das Ergebnis des Gruppenunterrichts.
IV Formulierung des Arbeitsauftrages
H. Meyer stellt folgende Arten vor:
Geschlossene Arbeitsaufträge
Was wann wie erfolgen soll. ➙ Zur Heranführung an GU geeignet. Offene Arbeitsaufträge
Z.B. Den Schülern den Auftrag geben , aus vorhandenen Zeitschriften eine Collage zu erstellen.
Nicht gleichzusetzen mit unverbindlichen o. schwammigen Aufträgen Freie Arbeitsaufträge
Eher verbindliche Vereinbarungen als Arbeitsaufträge
Z.B. „Bereitet Euch in der Gruppe für die Klassenarbeit vor! Entscheidet selbst was Ihr üben wollt!“.8 Freie Aufträge sollten aber erst bei Schülern eingesetzt werden die bereits GU erfahren sind.
Anmerkung
Ein Arbeitsauftrag der unklar formuliert ist, führt in den meisten Fällen zu einem eher unerwünschten Ergebnis. Das „nicht erreichen“ eines Zieles bestätigt sich bei der Untersuchung von Fürst. Seine Pfadanalyse zeigt auf, dass präzise und verständli- che Arbeitsaufträge bei der „Gruppenarbeit9 entscheidend dazu beitragen, ge- wünschte Arbeitsergebnisse zu erreichen. Dabei verringert sich die Desorientierung der Schülerinnen und Schüler sowie Interventionen der Lehrkräfte10. Ergebnisse von Fürst zeigen, dass Arbeitsaufträge, mit einem mittleren Offenheits- grad von 2,1 (1,0 geschlossen 5,0 offen), eine deutliche Ausprägung zu geschlos- senen Arbeitsaufträgen haben11.
Die geschlossene Form ist sicherlich bei den Lehrkräften des Typ 1und 212 anzutreffen. Ermöglicht diese Form den zeitlichen Unterrichtsverlauf besser zu planen.
Als Ergänzung zu H. Meyer sollten die Arbeitsaufträge mindestens schriftlich13 erfolgen. Eine dazu passende mündliche Form erleichtert das Aufnehmen14 der Angaben für die Schülerinnen und Schüler.
IVa Verständnissicherung
Im „Pfadanalytischen Modell“ zeigt sich ein direkter Zusammenhang zwischen dem Verständnis der Aufgabenstellung der Schülerinnen und Schüler und dem Arbeitser- gebnis15. Als Folge von unzureichenden Arbeitsaufträgen kann es zu Desorientie- rung, inhaltliche Progression und Lehrkraftintervention16 kommen. Hier sind die Lehr- kräfte aufgefordert, vor dem Beginn der Gruppenarbeit diesen Punkt abzuarbeiten.
V Kriterien für Gruppenbildung
Eine Gruppenbildung sollte folgende teilweise konkurrierende Kriterien berücksichti- gen:
- Kleingruppen
- Gruppengröße hinsichtlich Auswertbarkeit der Ergebnisse im Plenum
- Freundschaftsgruppen (informelle Gruppen)
- homogene Gruppen
Anm.: Ermöglicht eine Binnendifferenzierung. Positiv gesehen können schwächere Schülerinnen und Schüler z. B. in der Phase der Verständnissicherung besser unterstützt werden.
- Heterogene Gruppen
Integration von Außenseitern und schwierigen Schülern
Anm.: Förderung von schwächeren Schülerinnen und Schülern intern durch i- leistungsstärkere Schüler möglich.
Anmerkung
Weitere mögliche Kriterien, die zur Eingrenzung des Referates nur angegeben aber nicht vertieft werden, sind:
- Gruppenstatus der Gruppenmitglieder ➙ niedrig/hoch
- Führungsstil
- Prozessregelung und Beziehungsentwicklung
VII Räumliche Voraussetzungen
Umgestaltung von U- oder Linienform z. B. zu Vierertischen. Jeder Schüler sollte einen festen Platz beim GU haben.
Anmerkung
Die beschriebene Umgestaltung im Grundschulbereich ist inzwischen Realität. Allerdings m. E. in den Bereichen Sek I, SEK II und Berufsschulen sind Gruppenunterrichtsräume seltener.
VIII Spielregeln der Gruppenarbeit einüben
Neben der sachlichen Arbeitsebene gibt es noch eine Gefühlsebene der Schülerin- nen und Schüler sich selbst und den Mitschülern gegenüber. Eine Missachtung die- ser Gefühlsdimension führt zur Zerstörung der Arbeitsfähigkeit der Gruppe. H. Meyer rät, dieses den Schülerinnen und Schüler mitzuteilen und „themenzentriert“ zu arbei- ten. Auf den TZI-Ansatz von Kohn möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen.
IX Den Ablauf der Gruppenarbeit besprechen/ Einübung von Arbeitstechniken
Vor der eigentlichen Gruppenarbeit sollen die Arbeitsabläufe, Arbeitstechniken besprochen und eingeübt werden. Idealerweise bereits als Gruppenarbeit. Im Normalfall erfolgt dieses aber in Form des Frontalunterrichtes.
3 Resümee
Für ein mögliches Ziel, dass sich alle Lehrkräfte von Typ 1 zum Typ 3, weiterentwi- ckeln sind die Ratschläge von Hilbert Meyer eine gute Basis, die aber um die Punkte
- Präzision/Verständlichkeit bei dem Punkt Arbeitsauftrag und Aufgabenstellung
- Verständnissicherung
- sowie um weitere Kriterien zur Gruppenbildung ergänzt werden sollten.
Der Weg von der Lehrkraft mit der reinen Unterrichtsform Frontalunterricht zum Gruppenunterricht ist schwierig aber in kleinen Schritten möglich.
Er bedeutet, dass Schüler für ihr Lernen eigene Verantwortung übernehmen sollen - zunächst einmal die Lehrkraft Impulse setzt - und die Schülerinnen und Schüler kri- tisch-beratend begleitet - sie aber los lässt, damit sie ihre eigenen Wege gehen kön- nen.
4 Literatur:
1. Meyer, H. (1987). Unterrichtsmethoden, Bd. 11 Frankfurt: Scriptor (11. Gruppenunterricht).
2. Fürst, C. (1999). Die Außensicht des Gruppenunterrichts. Wie handeln Lehrkräfte und SchülerIn-nen aus der Sicht des außenstehenden Betrachters? in H.-D. Dann, T. Diegritz & H.S. Rosenbusch (Hrsg.), Gruppenunterricht im Schulalltag: Realität und Chancen. erlangen: Universitätsbund Erlangen-Nürnberg e.V. (Kap. 3 und 4, Die Rolle der Lehrkraft im GU).
3. Lehmann-Grube, S.K. (2000). Wenn alle Gruppen arbeiten, dann ziehe ich mich zurück. Elemente Sozialer Repräsentation in Subjektiven Theorien von Lehrkräften über ihren eigenen Gruppenun- terricht. Lengerich: Pabst. (Kap. 5.2 - 5.5 und 6.2.2 - 6.3)
4. Jank, W. (1992) Didaktische Modelle, Frankfurt am Main: Cornelsen Scriptor, 2. Aufl. (8. Lektion: Unterrichtskonzepte, 10. Lektion: Ratschläge für Stundenentwürfe)
5. Tümmers, J. (1980) (Hrsg)., Problemlösendes Denken in der Berufserziehung, Fachdidaktische Grundlagen und praktische Unterrichtsbeispiele, Wirtschafts- und Berufspädagogik in Forschung und Praxis Bd. 1, Kassel, Köln Wien: Böhlau Verlag.
[...]
1 Vgl. S.K. Lehmann Grube S. 17
2 H. Meyer S. 242
3 Gruppenarbeit ist eine geleistete zielgerichtete Arbeit, die soziale Interaktion und die sprachliche Verständigung zwischen den Schülern und der Lehrkraft.
4 f nach H. Meyer S. 254 ff. kommt II „Lernvoraussetzungen“ erst nach III „Unterscheidung themen-gleich/themendifferenziert“. Ich sehe allerdings in der von mir gewählten Reihenfolge eine schlüssigere Anbindung an den Punkt IV „Formulierung des Arbeitsauftrages“
5 in Anlehnung an J. Tümmers; Problemlösendes Denken in der Berufserziehung S. 8 f
6 Lehmann-Grube S. 163 sowie Erklärung im Coreferat von Markus Klemmt
7 Weiterhin kann man die Frage nach einem Typ 0 (nur Frontalunterricht?) stellen
8 H.Meyer S. 258
9 bei Fürst S.118 liegt sicherlich eine Verwechslung der Begriffe Gruppenarbeit und Gruppenunter- richt vor
10 Fürst S. 121
11 Fürst S. 116
12 Lehmann-Grube S. 163 sowie Erklärung im Coreferat von Markus Klemmt
13 führt zu einer größeren Klarheit der gestellten Aufgabe Fürst S. 119
14 Neben dem Eingangskanal Auge (sehen) kommt weiterhin das Ohr (hören) für die Schülerinnen und Schüler dazu
15 Fürst S. 118
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus des Textes "Vergleich Gruppenunterricht von H. Meyer mit neuen Erkenntnissen"?
Der Text vergleicht die Erkenntnisse von Hilbert Meyer zum "traditionellen" Gruppenunterricht (GU) mit neueren Erkenntnissen, insbesondere im Hinblick auf Gruppenarbeit (GA). Es werden Punkte hervorgehoben, die bestätigt oder ergänzt werden können.
Welche Ratschläge von Hilbert Meyer zum Gruppenunterricht werden behandelt?
Die folgenden acht Punkte von H. Meyer werden im Text besprochen:
- Eignung des Themas für GU
- Lernvoraussetzungen der Schüler
- Themengleiche oder themendifferenzierte Aufgabenstellung
- Formulierung des Arbeitsauftrages
- Verständnissicherung
- Kriterien für Gruppenbildung
- Art der Gruppenbildung
- Räumliche Voraussetzungen
- Spielregeln der Gruppenarbeit einüben
- Ablauf der Gruppenarbeit besprechen/Einübung von Arbeitstechniken
Was sind die Kriterien für die Eignung eines Themas für Gruppenunterricht?
Ein Thema für GU sollte aus dem Erfahrungsbereich der Schüler stammen und ihre Interessenlage ansprechen (Thema von Innen). Themen können auch von der Lehrkraft kommen (m. E. in den meisten Fällen), von Dritten oder dem Umfeld der Schule (Themen von Außen). Verschiedene Ansätze zur Themenfindung werden erwähnt, z.B. durch Widerspruch, unzureichende Angaben, überflüssige Angaben oder mehrere Lösungsmöglichkeiten.
Welche Bedeutung haben die Lernvoraussetzungen der Schüler für den Gruppenunterricht?
Die bereits vorhandenen Vorkenntnisse und die Methodenkompetenz der Schüler in Bezug auf Gruppenarbeit sind entscheidend. Es besteht ein Zusammenhang mit dem Einüben von Spielregeln und Arbeitstechniken. Der Text wirft auch die Frage auf, ob die Lehrkraft die entsprechenden Lehrvoraussetzungen hat.
Was sind themengleiche und themendifferenzierte Aufgabenstellungen im Gruppenunterricht?
Themengleiche Aufgabenstellungen (z. B. eine Collage, ein Rollenspiel) ermöglichen es mehreren Schülern, das gleiche Thema zu bearbeiten und die Ergebnisse im Plenum zu vergleichen. Themendifferenzierte Aufgabenstellungen (z. B. Pro-Contra-Diskussionen) beinhalten die Erarbeitung verschiedener Aspekte in Kleingruppen und eine gemeinsame Auswertung im Plenum.
Welche Arten von Arbeitsaufträgen werden nach Hilbert Meyer unterschieden?
H. Meyer unterscheidet geschlossene, offene und freie Arbeitsaufträge. Geschlossene Aufträge geben genau vor, was wann wie erfolgen soll. Offene Aufträge lassen mehr Spielraum (z. B. die Erstellung einer Collage aus Zeitschriften). Freie Aufträge sind eher verbindliche Vereinbarungen (z. B. Vorbereitung auf eine Klassenarbeit). Der Text betont, dass unklare Arbeitsaufträge unerwünschte Ergebnisse zur Folge haben können.
Welche Bedeutung hat die Verständnissicherung im Gruppenunterricht?
Das Verständnis der Aufgabenstellung durch die Schüler hat einen direkten Einfluss auf das Arbeitsergebnis. Unzureichende Arbeitsaufträge können zu Desorientierung und Lehrkraftintervention führen. Die Lehrkräfte sollten vor Beginn der Gruppenarbeit sicherstellen, dass die Aufgabenstellung verstanden wurde.
Welche Kriterien sollten bei der Gruppenbildung berücksichtigt werden?
Kriterien für die Gruppenbildung sind u.a. Kleingruppen, Gruppengröße (hinsichtlich Auswertbarkeit der Ergebnisse), Freundschaftsgruppen, homogene Gruppen (für Binnendifferenzierung) und heterogene Gruppen (zur Integration). Weitere mögliche Kriterien (die aber nicht vertieft werden) sind Gruppenstatus, Führungsstil und Prozessregelung.
Welche Rolle spielen die räumlichen Voraussetzungen im Gruppenunterricht?
Die Umgestaltung von U- oder Linienformen zu Vierertischen wird empfohlen. Jeder Schüler sollte einen festen Platz haben. Gruppenunterrichtsräume sind, dem Text zufolge, in Sekundarstufe I, SEK II und Berufsschulen seltener.
Wie wichtig ist das Einüben von Spielregeln und Arbeitstechniken im Gruppenunterricht?
Neben der sachlichen Arbeitsebene gibt es eine Gefühlsebene. Eine Missachtung dieser Gefühlsebene kann die Arbeitsfähigkeit der Gruppe zerstören. Arbeitsabläufe und Arbeitstechniken sollten vor der eigentlichen Gruppenarbeit besprochen und eingeübt werden.
Was ist das Resümee des Textes?
Die Ratschläge von Hilbert Meyer bilden eine gute Basis für die Weiterentwicklung von Lehrkräften vom Typ 1 zum Typ 3 (nach Lehmann-Grube). Allerdings sollten sie um die Präzision und Verständlichkeit bei Arbeitsaufträgen, die Verständnissicherung und weitere Kriterien zur Gruppenbildung ergänzt werden. Der Weg vom Frontalunterricht zum Gruppenunterricht ist schwierig, aber in kleinen Schritten möglich.
- Quote paper
- Martin Steding (Author), 2001, Vergleich Gruppenunterricht von H. Meyer mit neuen Erkenntnissen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/104746