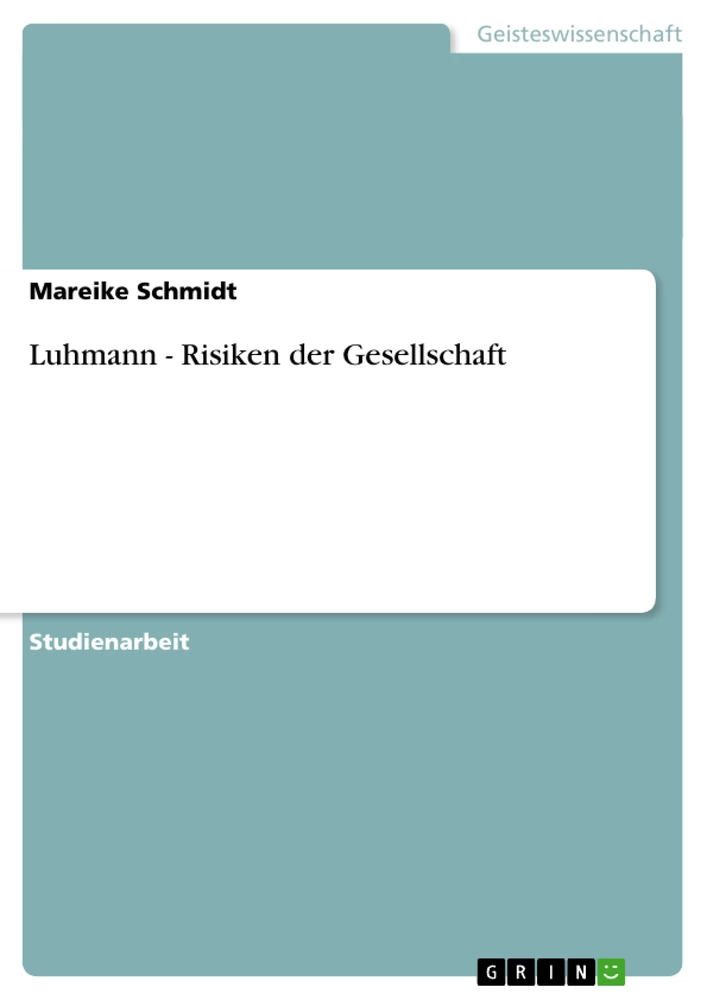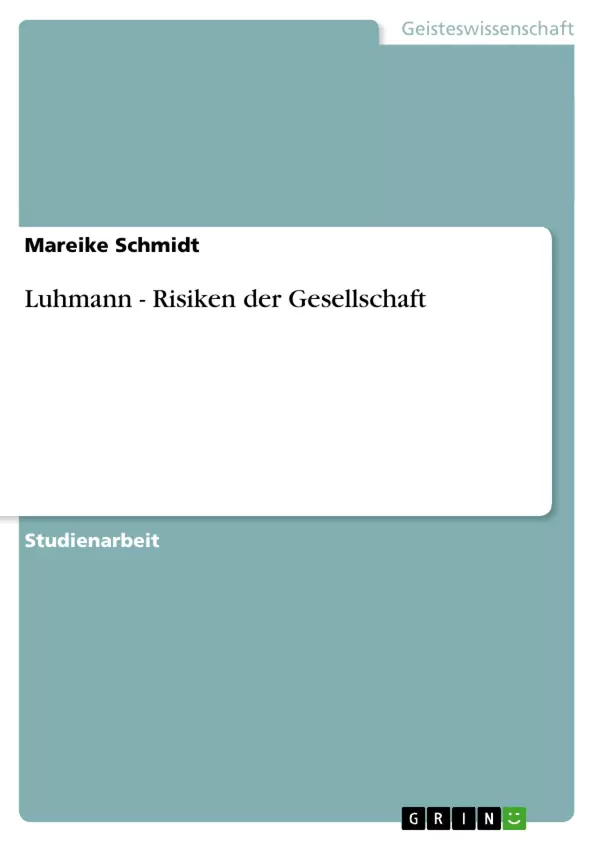Thema 11: Luhmann - Risiken
Aufgabenstellung:
(1) Wodurch gefährdet sich die moderne Gesellschaft? Diskutieren Sie, inwiefern die gesellschaftlichen Funktionssyteme Anteil einerseits an der Erzeugung und andererseits an der Lösung dieser Problem haben und gehen Sie dabei auf zwei Funktionssysteme detailliert ein. (Greifen Sie in Ihren Erläuterungen insbesondere den Begriff der Resonanz auf.)
Die moderne Gesellschaft ist gekennzeichnet durch einen hohen Grad von Differenzierung des Systems in funktionale Subsysteme. Diese Funktionssysteme sind eine geschlossene, in sich funktionierende Einheit, die in Kooperation mit den anderen Funktionssystemen zum Funktionieren der modernen Gesellschaft beitragen. Funktionssysteme sind Systeme, die sich selbst reproduzieren können und in sich Komplexität aufweisen.
Aber die Komplexität der Systeme beinhaltet eine Problematik: kein System kann eine so hohe Komplexität ausbilden, dass es seine Umwelt kontrollieren kann. Auch ist für jedes System die Umwelt komplexer als das System an sich. Komplexe Systeme sind fähig, Beziehung zur Umwelt aufzunehmen, zum Beispiel Inputs und Outputs unterscheiden; es ist dem System also möglich, auf seine Umwelt zu reagieren. Systeme, auch wenn sie eigenständige, komplexe sich selbst reproduzierende Systeme sind, brauchen als Bedingung der Möglichkeit und Beschränkung der Existenz, die Umwelt. Das System wird von der Umwelt nicht zur Anpassung gezwungen, jedoch gehalten und gestört. Damit ist die regulierende Umwelt eines jeden Systems die Grundlage für die Zusammenarbeit der Subsysteme. Wenn jedoch ein System auf Irritationen von seitens der Umwelt reagiert, bildet das System eigene Strukturen aus um seine Reproduktion zu gewährleisten. Es bildet sich dann die Vorstellung, das die Umwelt sich dem System anzupassen hat. Auf diese Weise können dann sehr komplexe Systeme entstehen. Diese Systeme können dann offen sein und sehr sensibel auf wechselnde Umweltbedingungen reagieren. So können dann unter Umständen auch Systeme erzeugt werden, die nur noch aus Ereignissen bestehen, deren ständiges Aufhören notwendige Mitursache der Autopoiesis des Systems ist. Die ökologische Selbstgefährdung liegt im Rahmen der evolutionären Möglichkeiten. Ein hoher Grad an Spezialisierung innerhalb der Systeme, also ein hoher Grad an Differenzierung, kann sich bei ändernden Umweltbedingungen als Fehlspezialisierung erweisen. Auch kann es so weit kommen, dass Systeme aufhören zu existieren, weil sie durch ihr Wirken die Umwelt verändert haben und diese Veränderung auf das System zurückschlägt. Das Ziel von Systemen ist immer die „Fortsetzung ihrer Autopoiesis ohne Rücksicht auf die Zukunft, die ja gar nicht erreichbar ist wenn die Autopoiesis nicht fort gesetzt wird..“1 Also wird die systeminterne Autopoiesis , die eine Zukunft erst gewährleistet, zu ihrem Verhängnis, indem sie die Zukunft des Systems gefährdet.
Die Evolution wird langfristig aber dafür sorgen, dass ein ökologisches Gleichgewicht gewährleistet ist. Es werden dabei Systeme beseitigt, die zur ökologischen Selbstgefährdung führen bzw. führen könnten. Luhmann meint mit diesen Systemen, die zur ökologischen Selbstgefährdung führen können unter anderen technische Errungenschaften, die dem Fortschritt der modernen Gesellschaft gewährleisten, die aber auch zu ökologischen Problemen werden können. Es darf in der Zukunft laut Luhmann nicht mehr nur um die Beherrschung der Natur gehen. Es wird mehr um die Entwicklung von Eingriffskompetenzen gehen müssen; diese Eingriffskompetenzen werden aber unter Kriterien praktiziert werden müssen, die die eigene Rückbetroffenheit einschließen.
Es darf nicht weiterhin so sein, dass die Gesellschaft die Natur mit technischen Errungenschaften verändert, denn diese erschaffenen Veränderungen können schwerwiegende Folgeprobleme für die Gesellschaft aufwerfen. Man darf demzufolge nur so weit mit den technischen Errungenschaften in die Natur eingreifen, dass sie die damit erzeugten Veränderungen nicht negativ auf gesellschaftlichen Systeme auswirken. Zum Beispiel ist eine der höchsten technischen Errungenschaften die Mobilität. Aber hier kann die Entsorgung ein Problem werden. Schon aus einer achtlos in die Natur geworfenen Autobatterie kann Batteriesäure auslaufen und in den Boden einsickern. Das dann verseuchte Grundwasser kann zur Gefährdung vieler Arten werden, die wichtig für den natürlichen Lebenskreislauf sind.
Das eindruckvollste Beispiel für einen Eingriff in die Natur ist die Verwendung von
Nuklearwaffen. Allein der Gedankengang von Albert Einstein macht dies klar, sinngemäß meinte er, dass er nicht wüßte, womit der 3.Weltkrieg geführt wird, er wüßte aber, dass ein möglicher 4. Weltkrieg dann mit Steinschleudern geführt werden würde. diese Überlegung macht die Veränderungen in der Natur deutlich, welche durch den Abwurf einer Atombombe hervorgerufen werden. Nach der Detonation wird der Grund und Boden verseucht, da allein die Halbwertzeit von nuklearen Material bezogen auf ein Menschenleben eine Ewigkeit beträgt. Damit wird die Bevölkerung dieses Stückes „Natur“ praktisch nie mehr möglich sein und die Menschheit wäre langzeitig geschädigt.
Die ökologische Selbstgefährdung der Systeme kann nur beseitigt werden, wenn die psychischen Systeme ihre Aufgabe nicht mehr in der Beherrschung der Natur sehen, sondern ihre Aufgabe darin sehen, eine Kompetenz zu entwickeln, die auf Dauer ein ökologisches Gleichgewicht gewährleistet.
Die Frage jedoch ist, ob die technischen Systeme kompetent genug sind, sich selektiv zugunsten des ökologischen Gleichgewichts zu verhalten und ob auch ihre kommunikative Kompetenz ausreicht, sich selektiv zu verhalten.
Luhmann greift in seinem Werk „Ökologische Kommunikation“ auch den Begriff der Resonanz auf. Im Nachfolgendem werde ich versuchen zu erläutern, was der Begriff der Resonanz meint.
Das Verhältnis von System und Umwelt wird von Luhmann als Resonanz beschrieben. Dabei setzt er jedoch voraus, dass die moderne Gesellschaft von hoher Komplexität ist. Das System schließt seine intern ablaufende Reproduktion gegen die Umwelt ab, aber es kann durch äußere Faktoren, also von der Umwelt, in eine Art Schwingung versetzt werden. Diesen Fall bezeichnet Luhmann als Resonanz. Er macht dies an einem Beispiel deutlich: ein Lexikon definiert zumeist alle Begriffe, selbst welche es zur Erklärung von Begriffen benötigt, selbst. Nur ausnahmsweise läßt es Referenzen auf undefinierbare Begriffe zurück. Ein für das Lexikon gebildetes Redaktionsteam (also die Umwelt zum System „Lexikon“) überwacht, ob die Sprache den Sinn jener undefinierbarer Begriffe ändert oder durch Neubildung von Begriffen die Geschlossenheit des lexikalen Universums stört, ohne mit dieser Störung festzulegen, wie Änderungen der Einträge zu behandeln sind. Je reichhaltiger ein Lexikon ist, desto mehr wird es durch die fortschreitende Sprachentwicklung in Bewegung gehalten und desto mehr Resonanz kann es aufbringen. Also desto mehr Reaktionen kann es gegenüber der Sprachentwicklung zeigen.
Die ökologischen Gefährdungen des gesellschaftlichen Lebens müssten in der Gesellschaft Resonanz finden. Aber laut der sozio-kulturellen Evolution muß die Gesellschaft nicht auf ihre Umwelt reagieren. Da die Gesellschaft als System nur mit Sprache kommunizieren bzw. handeln kann, ist ihre Resonanz durch Selektion geprägt. Die Gesellschaft kann nicht auf alle Einflüsse gleichzeitig reagieren, sondern demnach muß sie selektieren.
Noch einmal zurück zur Beschreibung der funktionalen Teilsysteme. Diese Teilsysteme sind immer wechselseitig Umwelt füreinander. Sie bedingen und stören sich daher auch wechselseitig. Wird ein System durch äußere Einflüsse gestört, kommt es zur Veränderung dieses Systems. Dies kann Auswirkungen auf die anderen Systeme haben, da das veränderte System die jeweilige Umwelt jener darstellt. Beispielsweise werden bei der Verknappung der Ressourcen nicht nur ökonomische Probleme wie Preissteigerungen hervorgerufen, sondern auch politische Probleme. Auch können der Wirtschaft zusätzliche Kosten aufgebürdet werden, was dann Arbeitsplätze kosten kann, dies wiederum wird sich dann in der Politik niederschlagen, bzw. in den Wählerstimmen der Wähler.
Die Gesellschaft ist also nur so stark wie sein schwächstes Glied (System). Kurzum, wenn ein System aus der „Reihe tanzt“, kommt es sofort zu gravierenden Veränderungen und Irritationen unterhalb der anderen Systeme.
Durch den hohen Grad der Differenzierung in modernen Gesellschaften ist das System der Teilsysteme sehr anfällig. Dies ist so gefährlich, da die Subsysteme voneinander abhängen und nur durch eine Zusammenarbeit („organische Solidarität“) das Funktionieren im sinne von Ordnung gewährleistet sein kann.
Nun aber zum System beim Umgang mit ökologischen Problemen der Politik. Bei diesem System ist es ,laut Luhmann, wenig sinnvoll, ihm eine Führungsrolle zuzuweisen, die laut Luhmann eines der größten Risiken der modernen Gesellschaft wäre. Auch die Politik kann nicht außerhalb ihrer Grenzen arbeiten. Jedes System kann nur im Rahmen seiner Grenzen operieren damit eine Lösung entsteht. Auch das System der Politik selektiert seine Informationen, die es aus der Umwelt aufnimmt. Das System der Politik operiert zumeist mit _Macht. Es fehlt dennoch eine wirksame völkerrechtliche Regulierung zur Umsetzung ökologischer Probleme in Staatspolitik. Auch kann die Lösung ökologischer Probleme durch Einschränkung der Macht auf bestimmte räumliche Gebiete verhindert werden. Die Auswirkungen der Gesellschaft auf ihre Umwelt wird nicht sich nicht regional binden lassen. Zum Beispiel hat die USA einen überproportional hohen Energieverbrauch weil sie es sich leisten können. Hier scheinen demnach andere Probleme in den Vordergrund und in den Input der Politik zu geraten. Solange die Gesellschaft glücklich ist und sie es sich leisten kann, wird man ja wohl kaum ab 19 Uhr den Strom abstellen.
Auch die Endlagerung von atomaren Müll wird meist an die Landesgrenze, wennmöglich auch ins Ausland, verlagert. Hauptsache das Problem ist aus dem eigenen territorial abgesteckten Einflußbereich der eigenen Macht verschwunden.
Ein weiteres Problem ist auch, dass die Politik auf einen kurzzeitigen Wechsel durch Wahlen gefaßt sein muß. Es muß ganz einfach eine langfristige ökologische Politik gefordert werden.
Das System der Wirtschaft hat einerseits großen Anteil an der Erzeugung der Risiken für eine moderne Gesellschaft, andererseits kann es aber auch zur Lösung beitragen. Das Problem liegt im zentralem Medium: Geld. Alle Handlungen im Wirtschaftssystem laufen über Geld ab. Das Ziel ist es, gewinnmaximierend zu handeln. Dies wird meist ohne Blick auf die Zukunft getan. Dann werden eben Gifte im Hochofen durch die Essen freigesetzt- wenn stört das schon Sicher, auch Atomkraftwerke sind von relativ hohem Nutzen - muß doch nun nicht mehr durch Kohle-Verbrennung Strom erzeugt werden. Doch wohin mit den verbrauchten nutzlosen nuklearen (gefährlichem) Material?
Dabei wäre es so einfach: Energie aus Wind, Energie aus Wasser. Doch um diese Energien zu gewinnen, sind zuersteinmal große Investitionen in entsprechende Anlagen notwendig. Alles Kosten, die das Ziel der Gewinnmaximierung gefährden.
Im Großen und Ganzen wäre es von großem Gewinn für die moderne Gesellschaft, würden die Teilsysteme (u.a. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft) zukunftsorientiert zusammenarbeiten, denn das Potential zur Verhinderung einer ökologischen Katastrophe ist durchaus vorhanden. Ein alleiniges Agieren des System zur Verhinderung der ökologischen Selbstgefährdung ist nicht möglich, dazu ist die moderne Gesellschaft zu ausdifferenziert. Die Differenzierung der modernen Gesellschaft wird ihr zum Verhängnis, kann aber auch zur Lösung ihrer Probleme werden.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wodurch gefährdet sich die moderne Gesellschaft laut Luhmann?
Die moderne Gesellschaft gefährdet sich durch ihre hohe Differenzierung in funktionale Subsysteme. Diese Systeme, obwohl in sich geschlossen und selbst-reproduzierend, können eine Komplexität entwickeln, die sie daran hindert, ihre Umwelt vollständig zu kontrollieren. Die Systeme reagieren auf Irritationen der Umwelt und bilden eigene Strukturen aus, um ihre Reproduktion zu gewährleisten, was dazu führen kann, dass sie die Umwelt verändern und sich somit selbst gefährden. Eine hohe Spezialisierung kann sich bei ändernden Umweltbedingungen als Fehlspezialisierung erweisen. Ziel der Systeme ist die Fortsetzung ihrer Autopoiesis, auch wenn diese die Zukunft des Systems gefährdet.
Welche Rolle spielt die ökologische Selbstgefährdung?
Die ökologische Selbstgefährdung liegt im Rahmen der evolutionären Möglichkeiten und kann dazu führen, dass Systeme aufhören zu existieren, weil sie durch ihr Wirken die Umwelt verändert haben und diese Veränderung auf das System zurückschlägt. Luhmann sieht hierin auch technische Errungenschaften, die dem Fortschritt dienen, aber zu ökologischen Problemen werden können.
Was sind die geforderten Eingriffskompetenzen?
Es wird eine Entwicklung von Eingriffskompetenzen gefordert, die unter Kriterien praktiziert werden müssen, die die eigene Rückbetroffenheit einschließen. Es darf nicht weiterhin so sein, dass die Gesellschaft die Natur mit technischen Errungenschaften verändert, denn diese Veränderungen können schwerwiegende Folgeprobleme für die Gesellschaft aufwerfen.
Was versteht Luhmann unter Resonanz im Verhältnis von System und Umwelt?
Das Verhältnis von System und Umwelt wird von Luhmann als Resonanz beschrieben. Das System schließt seine intern ablaufende Reproduktion gegen die Umwelt ab, kann aber durch äußere Faktoren in eine Art Schwingung versetzt werden. Die ökologischen Gefährdungen des gesellschaftlichen Lebens müssten in der Gesellschaft Resonanz finden, aber da die Gesellschaft als System nur mit Sprache kommunizieren kann, ist ihre Resonanz durch Selektion geprägt.
Wie wirken sich Störungen in einem System auf andere Systeme aus?
Die funktionalen Teilsysteme sind immer wechselseitig Umwelt füreinander. Wird ein System durch äußere Einflüsse gestört, kann dies Auswirkungen auf die anderen Systeme haben, da das veränderte System die jeweilige Umwelt jener darstellt. Die Gesellschaft ist nur so stark wie sein schwächstes Glied, und wenn ein System aus der "Reihe tanzt", kommt es zu gravierenden Veränderungen und Irritationen unterhalb der anderen Systeme.
Welche Rolle spielt die Politik beim Umgang mit ökologischen Problemen?
Luhmann hält es für wenig sinnvoll, der Politik eine Führungsrolle zuzuweisen, da dies eines der größten Risiken der modernen Gesellschaft wäre. Jedes System kann nur im Rahmen seiner Grenzen operieren, und auch die Politik selektiert ihre Informationen. Es fehlt eine wirksame völkerrechtliche Regulierung zur Umsetzung ökologischer Probleme in Staatspolitik.
Wie trägt die Wirtschaft zur Erzeugung und Lösung von Risiken bei?
Das Wirtschaftssystem trägt einerseits zur Erzeugung der Risiken bei, kann aber andererseits auch zur Lösung beitragen. Das Problem liegt im zentralem Medium: Geld. Alle Handlungen laufen über Geld ab, und das Ziel ist es, gewinnmaximierend zu handeln, oft ohne Blick auf die Zukunft. Investitionen in umweltfreundliche Energien werden oft vermieden, da sie das Ziel der Gewinnmaximierung gefährden.
Wie kann eine ökologische Katastrophe verhindert werden?
Es wäre von großem Gewinn für die moderne Gesellschaft, würden die Teilsysteme (u.a. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft) zukunftsorientiert zusammenarbeiten, denn das Potential zur Verhinderung einer ökologischen Katastrophe ist durchaus vorhanden. Ein alleiniges Agieren des Systems ist nicht möglich, dazu ist die moderne Gesellschaft zu ausdifferenziert. Die Differenzierung wird ihr zum Verhängnis, kann aber auch zur Lösung ihrer Probleme werden.
- Quote paper
- Mareike Schmidt (Author), 2001, Luhmann - Risiken der Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/104441