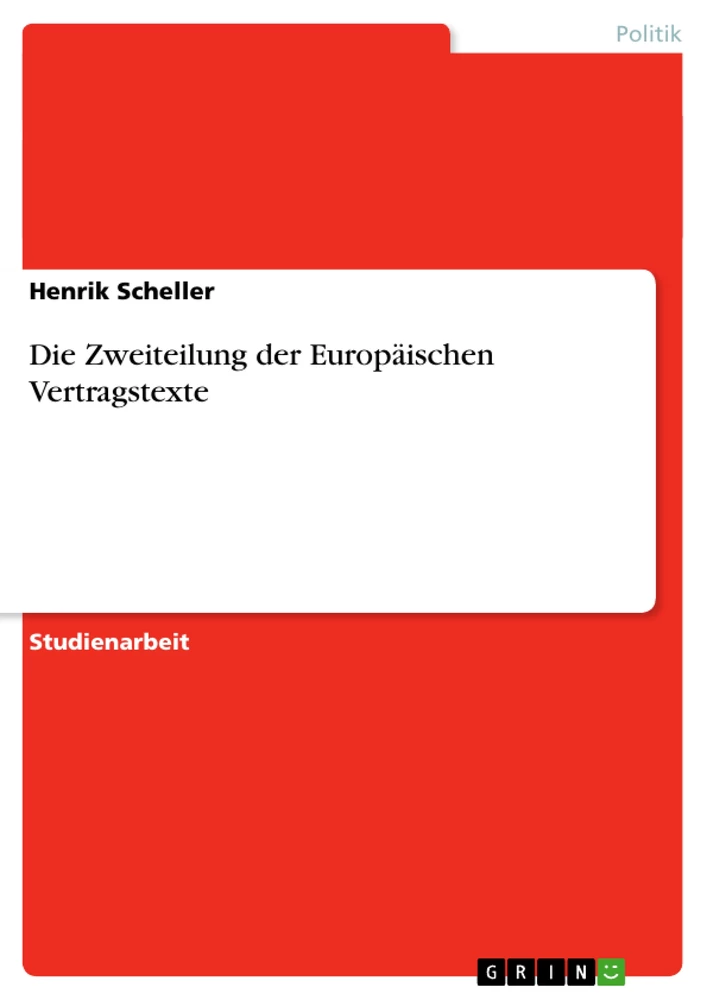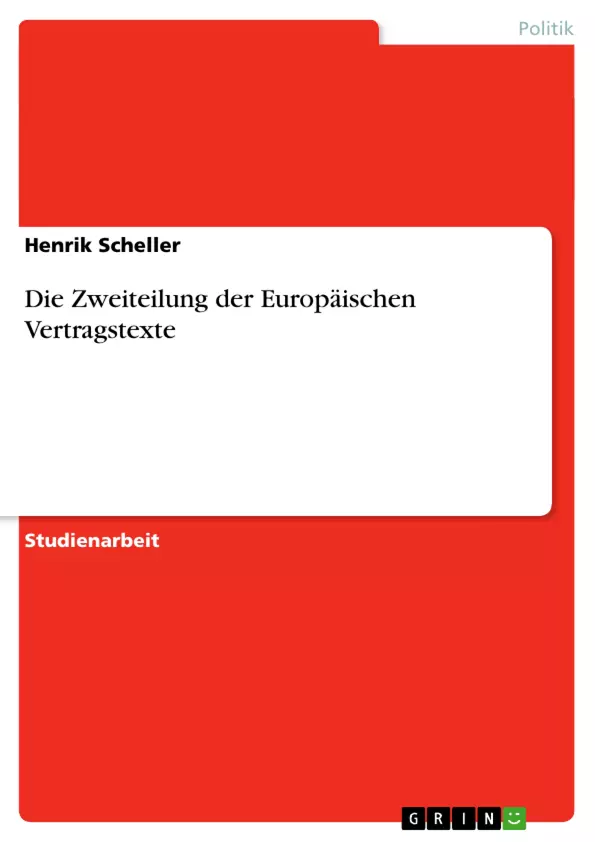Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung und Fragestellung
2 Anforderungen an eine zukünftige europäische Verfassung
3 Die Zweiteilung der europäischen Vertragstexte
4 Ausblick
5 Abkürzungsverzeichnis
6 Literaturverzeichnis
1 Einleitung und Fragestellung
Die Frage nach einer zukünftigen europäischen Verfassung bzw. der „Verfasstheit Europas“ hat Politiker und Wissenschaftler seit Gründung der Europäischen Gemeinschaften (EG) durch die Römischen Verträge von 1957 immer wieder beschäftigt. In den letzten 50 Jahren wurden etliche Entwürfe zu einer europäischen Verfassung ausgearbeitet und diskutiert.1 Gemeinsam blieb all diesen Papieren und Bemühungen, daß ihnen über eine Würdigung durch die europäischen Institutionen hinaus kaum Aufmerksamkeit und Interesse geschenkt wurde. Eine neue Dimension - insbesondere auch in der öffentlichen Wahrnehmung - hat diese Frage u. a. durch den Regierungswechsel in der Bundesrepublik im Oktober 1998 erhalten. Denn der neue deutsche Außenminister Fischer sprach bereits bei seiner Antrittsrede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg am 12. Januar 1999 erstmals von einer europäischen Verfassung. Eine weitaus dynamisierendere Wirkung in dieser Frage erzielte allerdings ein Reigen von Grundsatzreden, der im Mai d. J. durch die Rede „Vom Staatenverbund zur Föderation - Gedanken über die Finalität der europäischen Integration“ von Joschka Fischer in der Berliner Humboldt Universität eröffnet wurde.2 Diesen Überlegungen folgte eine Rede des französischen Staatspräsidenten Chiracs vor dem Deutschen Bundestag am 27. Juni d. J..3 Inzwischen haben sich der belgische Premierminister Verhofstadt und der britische Premierminister Blair ebenfalls zu diesen europäischen Grundsatzfragen geäußert.4
Die zur Zeit auf politischer Ebene geführte Diskussion der Frage nach einer wie auch immer gearteten zukünftigen europäischen Verfassung wird durch eine Debatte der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen begleitet und theoretisch unterfüttert. Nicht erst seit der jüngsten Debatte der europäischen Verfassungsfrage bedienen sich die europäischen Institutionen und deren Politiker dazu der externen Beratung durch wissenschaftliche Einrichtungen und Experten. Dazu gehören u. a. das Europäische Hochschulinstitut in Florenz und die eigens von Kommissionspräsident Prodi eingesetzte Kommission der „Drei Weisen“ um Jean-Luc Dehaene, Richard von Weizsäcker und Lord Simon.5
Die vorliegende Arbeit will die Frage einer potentiellen zukünftigen europäischen Verfassung unter dem besonderen Aspekt der „Zweiteilung“ der europäischen Vertragstexte beleuchten. Dieser Vorschlag wurde von den oben genannten „Drei Weisen“ in einem Bericht an die Europäische Kommission vom 18. Oktober 1999 unterbreitet und bestimmt seither immer wieder die (wissenschaftlichen) Diskussionen.6 Im begrenzten Rahmen dieser Arbeit wird zunächst erörtert,welche Fragen eine zukünftige europäische Verfassung grundsätzlich erfüllen sollte (Kapitel 2). In einem zweiten Schritt (Kapitel 3) soll dann der Vorschlag der Zweiteilung der Verträge diskutiert werden. Was verbirgt sich hinter diesem Vorschlag und was sind die Vor- und Nachteile einer möglichen Zweiteilung der Verträge? Dabei sollen die Betrachtungen in Abschnitt 3 von der Fragestellung geleitet werden, ob diese spezifische Form der zukünftigen EU-Vertragsstruktur den erörterten Fragen und Anforderungen aus Kapitel 1gerecht werden kann. Im vierten Kapitel soll dann abschließend ein Ausblick auf die potentiellen Erfolgsaussichten einer europäischen Verfassung gewagt werden. Dies erfolgt vor dem Eindruck der zur Zeit nur schleppend vorankommenden Regierungskonferenz, die mit dem Vertrag von Nizza abgeschlossen werden soll.
Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit soll sein, ob die Europäische Union die Kraft aufbringen wird, in der Frage der zukünftigen europäischen Verfassung einen „großen Wurf“ bzw. einen Quanten- sprung zu vollführen. Oder wird die EU in dieser Frage auch in Zukunft weiterhin nach der „Methode Monnet“ vorgehen, trotz dem Bekenntnis vieler Europapolitiker, daß sich diese Methode überholt habe?7
Die vorliegende Arbeit kann in ihrem bescheidenen Umfang nur peripher auf die Vielzahl diffiziler juristischer Fragen eingehen, die insbesondere auch von Vertretern der deutschen Staatsrechtslehre in die Diskussion eingebracht werden. Dazu gehört u. a. die Frage nach dem Begriff der Verfassung an sich und dessen Anwendbarkeit auf die EU; das Problem der bisher kaum existenten europäischen Öffentlichkeit8 ; dem Geltungsbereich einer zukünftigen europäischen Verfassung sowie die komplexen juristischen Fragen im Zusammenhang mit den Änderungsmodi der Verträge.9 Vielmehr sollen in der vorliegenden Arbeit aus politologischer Sicht die Realisierungschancen einer europäischen Verfassung unter Berücksichtigung der gegenwärtig vorherrschenden Meinungs- strömungen abgeklopft werden.
2 Anforderungen an eine zukünftige europäische Verfassung
Die (völker)rechtliche Grundlage der Europäischen Union umfaßt elf Verträge. Diese Verträge bilden das sog. Primärrecht der EU. Zu diesen Verträgen gehören u. a. die Vertragstexte von Rom, Maas- tricht, Amsterdam sowie die Einheitliche Europäische Akte (EEA), die Verträge über die EG, die EURATOM und die EGKS.10 Hinzu kommt eine Fülle von Protokollen und Erklärungen zu den jeweiligen Verträgen. In der Definition durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) handelt es sich bei den europäischen Verträgen, also dem EU-Primärrecht, um eine Art Verfassung der EU.11 Unbestreitbar ist wohl, daß die Summe dieser Texte in ihrer Komplexität fast nur noch von Experten verstanden und anzuwenden ist. Die im Dezember d. J. mit dem Vertrag von Nizza aller Voraussicht nach dritte Novellierung, Ergänzung und Neunummerierung des EWGVertrages innerhalb von nicht einmal zehn Jahren, wird wohl zu neuen Verwirrungen - auch in Fachkreisen - beitragen. Von einem Bewußtsein oder gar von Identifizierung breiter Schichten der europäischen Unionsbürger mit den bereits bestehenden EU-Verträgen als einer Art europäischer Verfassung, womöglich im Sinne eines Sternbergerschen „Verfassungspatriotismus“, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszugehen.12
Eine zukünftige europäische Verfassung sollte also zwei Aspekte berücksichtigen: Zum einen sollte sie resistent gegen komplette Novellierungen, Umstrukturierungen und vor allen Dingen Neunummer- ierungen sein. In der Vergangenheit haben sich die Abstände der Vertragsänderungen immer weiter verkürzt, da der europäische Integrationsprozeß seit dem Fall der Berliner Mauer und der kommunistischen Regime in Mittel-Osteuropa eine ganz neue Dynamik und Verdichtung erfahren hat. Das bestehende Vertragsänderungsverfahren, was nur Komplettrevisionen der EU-Verträge erlaubt, wird dieser neuen Dynamik nicht mehr gerecht. Dies wird durch die zur Zeit u. a. von der deutschen Bundesregierung erhobene Forderung dokumentiert, daß bereits möglichst auf dem Gipfel von Nizza die nächste Regierungskonferenz eingesetzt werden möge. Und dies, obwohl der Vertrag von Nizza noch nicht einmal paraphiert, geschweige denn ratifiziert worden ist. In Zukunft sollte im Zusammenhang mit dem Aspekt Vertragsänderungen verstärkt die Relation zwischen Aufwand und Ergebnis berücksichtigt werden. So hat eine komplette Umstrukturierung und Neunummerierung im Zuge einer Vertragsnovellierung, die in der Sache nur wenig am Wesensgehalt der Verträge ändert, nur geringen Wert, wenn sie durch eine Vielzahl von Ausnahmebestimmungen in den Protokollen konterkariert wird. Dieses Problem steht beispielsweise auch für die drei „left-overs“ von Amsterdam zu befürchten, die auf der zur Zeit laufenden Regierungskonferenz verhandelt werden. So gehen Beobachter derzeit davon aus, daß nur ein Teil dieser Regelungsmaterien gelöst werden wird. Dies wäre nicht nur für den Fortgang des europäischen Integrationsprozesses und die bevorstehenden Erweiterungsrunden der EU von Nachteil.13 Die Notwendigkeit eines neuen eigenen Vertrages (von Nizza) wäre bei einem Ergebnis in Form von Minimallösungen dieser Fragen angesichts des Aufwandes der seit über einem Jahr laufenden Regierungskonferenz, nur schwer zu rechtfertigen. Es stellt sich also die Frage, ob angesichts solcher Erwartungen eine komplette Novellierung des 1999 in Kraft getretenen Amsterdamer EU-Vertrages notwendig ist. Eine zukünftige europäische Verfassung sollte also ein Vertragsänderungsverfahren bereithalten, das auch kleinen Reformen und Anpassungen gerecht wird. Ein solches Verfahren sollte zur Behebung des vielfach beklagten Demokratiedefizits in der Union das Europäische Parlament stärker berücksichtigen. Dies könnte über eine Ausweitung des Mitentscheidungs- und Zustimmungsverfahrens erfolgen.
Eine zweite Anforderung an eine zukünftige europäische Verfassung besteht in der Forderung nach Transparenz und Übersichtlichkeit. Der zukünftige Verfassungstext sollte überschaubar, sinnvoll strukturiert und möglichst auch für Laien verständlich sein. Dies gilt z. B. für die Ziele und Grundsätze der Union wie die Verwirklichung des Binnenmarktes mit seinen Implikationen sowie das Subsidaritäts-, das Kohäsion- und das Solidaritätsgebot. Diese Ziele und Gebote finden sich derzeit verstreut in den bestehenden Verträgen. Sie könnten beispielsweise gesammelt am Anfang eines neu zu schaffenden Grundlagenvertrages stehen.14 Zur Schaffung von Transparenz und Übersichtlichkeit einer zukünftigen europäischen Verfassung wären zwei Schritte erforderlich. Zum einen sollten die bestehenden elf Verträge möglichst in einen einheitlichen EU-Vertrag integriert und kompiliert werden. Dies würde z. B. bedeuten, daß die Verträge über die EGKS und die EURATOM in den EU- Vertrag überführt würden. Damit würden diese beiden Europäischen Gemeinschaften in der EU aufgehen. Zweitens sollte durch einen europäischen Verfassungstext die „Drei-Säulen-Struktur“ der Europäischen Union aus EG (1. Säule), Gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik (2. Säule) und verstärkter Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz- und Innenpolitik (3. Säule) abgeschafft werden. Die Begründung für diesen Umstand liegt darin, daß in den vergangenen Jahren immer mehr Politikbereiche aus der zweiten und dritten Säule vergemeinschaftet wurden, d. h. in die erste Säule überführt wurden.15 Dabei handelt es sich um einen Prozeß, der sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird, gerade z. B. in Bereichen wie Europol oder der gemeinsamen Verteidigungspolitik. Mit einer weiteren Vergemeinschaftung dieser Politikfelder wird die spezifische „Drei-Säulen- Struktur“ untergraben und damit überflüssig.
Die Transparenz- und Übersichtlichkeits-Anforderung an einen zukünftigen europäischen Verfassungsvertrag sollte man nicht mit einer schnellen Steigerung der Identität der Unionsbürger mit der EU gleichsetzen, da ein solcher Prozeß Zeit erfordert. Trotzdem sollte der identitätsstiftende Mehrwert einer transparenten und überschaubaren europäischen Verfassung - gerade auch im Zusammenhang mit der in diesem Jahr ausgearbeiteten EU-Grundrechtscharta - auch nicht unterschätzt werden. Die Grundrechtscharta sollte an möglichst exponierter Stelle Eingang in die zukünftige europäische Verfassung finden. Mit dieser Aussage verbindet sich die Forderung nach Rechtsverbindlichkeit der Charta. Diese Frage steht zwar in Kreisen der nationalen und europäischen Parlamentarier sowie der Wissenschaft fast außer Frage, bei einzelnen Mitgliedern des Europäischen Rates (wie z. B. Großbritannien, Schweden und Dänemark) stößt sie aber auf Ablehnung. So ist zur Zeit der endgültige Rechtsstatus der Charta kaum vorhersehbar.16
Die Abschaffung der „Drei-Säulen-Struktur“ kann nur in Verbindung mit der Aufnahme eines Kompetenzkataloges in die zukünftige Verfassung erfolgen. Diese dritte Anforderung an eine europäische Verfassung wurde in jüngster Zeit von unterschiedlichen Seiten erhoben. Mit dieser Kompetenzabgrenzung sollen die Rechte, Pflichten und Aufgaben der einzelnen Ebenen (Europäische Union, Mitgliedsstaaten und nachgeordnete Gebietskörperschaften) vertraglich eindeutig fest- geschrieben werden. In diesem Punkt üben insbesondere die deutschen Bundesländer Druck auf die Bundesregierung und damit auch indirekt auf die EU-Kommission und den Rat aus.17
Eine vierte Anforderung an eine zukünftige europäische Verfassung sollte die vertragliche Festschreibung der Rechtspersönlichkeit der Europäischen Union sein. Einen solchen Rechtsstatus besitzt die Union derzeit nicht.18 Diese Problematik umschließt die Frage, ob die EU eine völkerrechtliche Organisation wie UNO oder OSZE ist? Oder ein „Staaten(ver)bund“ bzw. „Verfassungsverbund“?19 Zwei Beispiele verdeutlichen die negativen Auswirkungen der ungeklärten Rechtspersönlichkeit der EU: Im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der EU-Grundrechtscharta zeigte sich, daß die EU ohne eine Änderung ihres Vertrages nicht geschlossen als Einheit der EMRK beitreten kann.20 Daneben wäre es der EU zur Zeit ebenfalls nicht erlaubt, nur einen Vertreter im UN-Sicherheitsrat zu stellen, der alle fünfzehn Mitgliedsstaaten zusammen vertritt.
Es steht außer Frage, daß eine wie auch immer geartete zukünftige europäische Verfassung möglichst detaillierte Aussagen zu den derzeitigen drei left-overs von Amsterdam machen sollte. Dabei handelt es sich um die Fragen der Stimmengewichtung und der Mehrheitsentscheidungen im Rat sowie der Zusammensetzung der EU-Kommission (Anzahl der Kommissare). Über diese drei Sachverhalte hinaus sollte der Verfassungstext Aussagen zu einer effektiveren und effizienteren Funktionsweise der „verstärkten Zusammenarbeit“, zur Zusammensetzung und Funktionsweise der anderen Organe und Institutionen der EU sowie der finalen Gestalt der Europäischen Union machen.21 Der bloße Verweis auf die Reformnotwendigkeiten der vorstehenden Sachverhalte, die im Kontext dieser Arbeit nicht weiter diskutiert werden können, impliziert zwei weitere grundsätzliche Anforderungen an eine zukünftige europäische Verfassung. Erstens sollte eine numerische Limitation der Sitz- und Ämterzahl z. B. des Europäischen Parlaments, der EU-Kommission, des EuGHs, des AdRs und des WSAs so determinieren, daß diese Höchstzahlen nicht mit jeder Erweiterung der Union wieder neu berechnet, angepaßt und vertraglich festgeschrieben werden müssen. Zweitens sollte ein zukünftiger Ver- fassungstext die demokratische Legitimation der Organe, Institutionen und Funktionsmechanismen der Europäischen Union deutlich erhöhen. Dazu gehörte eine weitere Aufwertung des Europäischen Parlaments samt Ausweitung des Mitentscheidungs- und Mehrheitsprinzips. Außerdem ließe sich in diesem Zusammenhang über einen Ausbau zu einem Zwei-Kammer-System sowie über ein europaweites Referendum und einen einheitlichen Wahlmodus zum Europäischen Parlament diskutieren.22
Die zentrale Intention, die all diese Anforderungen an eine zukünftige europäische Verfassung gemeinsam haben, ist, mit einem einheitlichen Text, das Verständnis und damit die Identität sowohl der Unionsbürger als auch derjenigen, die tagtäglich mit dem europäischen Primärrecht zu tun haben, zu erhöhen und zu stärken. Durch den ausschließlich nationalstaatlich geprägten Terminus der „Verfassung“ soll - ähnlich wie mit der EU-Grundrechtscharta - der Charakter der „Wertegemeinschaft“ der EU unterstrichen werden, die sich durch ein möglichst hohes Maß an Bürgernähe und demokratische Legitimation auszeichnet.
3 Die Zweiteilung der europäischen Vertragstexte
Wurden im vorhergehenden Kapitel die Anforderungen an eine wie auch immer geartete zukünftige europäische Verfassung diskutiert, so sollen im folgenden die Vor- und Nachteile des Vorschlages der Zweiteilung der europäischen Vertragstexte unter Berücksichtigung der oben erarbeiteten Anfor- derungen erörtert werden. Handelt es sich bei den Anforderungen an eine europäische Verfassung eher um Inhaltliches, so hat der Vorschlag der Zweiteilung der europäischen Verträge eine dominante strukturelle Komponente. Zunächst soll erläutert werden, was sich hinter diesem Vorschlag verbirgt.
Die prominentesten Verfechter des Vorschlages der Zweiteilung der europäischen Verträge sind die drei „elder statesmen“ Richard von Weizsäcker, Jean-Luc Dehaene und Lord David Simon. Die eigentlichen Erfinder des sog. „Vertragssplittings“ sind aber wohl im Europäischen Hochschulinstitut in Florenz zu verorten. Nichts desto Trotz haben sich die drei den entsprechenden Vorschlag in ihrem Bericht „Die institutionellen Auswirkungen der Erweiterung“ an die Europäische Kommission zu eigen gemacht. Der neue Kommissionspräsident Prodi hatte diesen Bericht bei den drei Altpolitikern in Auftrag gegeben. Dieser Vorschlag hat wohl gerade durch die Prominenz seiner Verfechter wichtige Bedeutung in den Diskussionen um die Reform der Europäischen Union erlangt.
In ihrer Analyse bemängeln die drei Altpolitiker, daß die Europäische Union in den letzten fünfzehn Jahren „einen ständigen Prozeß von Vertragsänderungen“ durchlebt habe.23 Diese hätten in einigen Mitgliedsländern zu „Rechtsunsicherheit“, „Furcht vor kontinuierlichen Interventionen und progressiver Zentralisierung“ geführt.24 Vor diesem Hintergrund entwickelt die Weizsäcker- Kommission ein Szenario von zukünftigen Vertragsveränderungen, an denen aufgrund der Ost- Erweiterung 25 oder mehr Staaten mit ihren jeweiligen spezifischen parlamentarischen Systemen beteiligt wären. Dies führe zu „Verzögerungen, Frustrationen und Risiken einer kompletten Lähmung“.25
Um einer solchen Situation vorzubeugen, empfiehlt die Dreier-Kommission, „die vorhandenen Vertragstexte in zwei Teile aufzuspalten“.26 Auf diese Weise soll aus den bestehenden Vertragstexten - und dies ist wohl der wichtigste Punkt - ein Grundlagenvertrag und ein Ergänzungsvertrag entstehen. Der Grundlagenvertrag soll „die Ziele, die Grundsätze, die allgemeinen politischen Leitlinien, die Bürgerrechte und den institutionellen Rahmen“27, also die Funktions- und Arbeitsweise sowie die Zusammensetzung der Organe bestimmen. Nach den Vorschlägen der drei Altpolitiker soll dieser Grundlagenvertrag -- ähnlich wie heute der EGV und der EUV nur mit Einstimmigkeit im Europäischen Rat geändert werden dürfen. Daneben soll das vorgeschlagene „Vertragssplitting“ in einem zweiten Vertrag (bzw. mehreren (Ergänzungs-)Verträgen) die rechtlichen Grundlagen der einzelnen Politikfelder der Europäischen Union legen. Dieser zweite Vertrag sollte - so die Weizsäcker-Kommission - mit einer von dem Rat noch näher festzulegenden Mehrheit durch Rat und Parlament änderbar sein.
Als Vorteil einer Aufspaltung der Verträge in einen Grundlagenvertrag und einen Ergänzungsvertrag benennen die drei Politiker die Möglichkeit, Komplettrevisionen der Verträge, wie sie in der jüngsten Vergangenheit mehrmals vorgenommen wurden, zu vermeiden. Daneben - so die drei Altpolitiker - würde durch ein „Vertragssplitting“ die grundlegende Struktur und Arbeitsweise der Institutionen gerade auch für die breite Öffentlichkeit einsichtiger. Durch Mehrheitsentscheidungen und eine verstärkte Beteiligung des Europäischen Parlaments würden außerdem der demokratische Mehrwert der Union gestärkt.28 Der wohl größte Vorteil des Vorschlages der „Drei Weisen“ sollte in dem Umstand gesehen werden, daß er auf der Verwendung und Hierachisierung der bestehenden Vertragstexte und -formulierungen beruht. Danach bedarf es also „keines verfassungspolitischen Urknalls“29, womit eine komplette Neufassung und -formulierung des zu schaffenden Verfassungstextes gemeint wäre. Es handelt sich vielmehr um eine „ ...Verbesserung der Verfassung, die Demokratisierung, Konsolidierung und Effektivierung des Bestehenden ...“, wie Pernice es formuliert hat.30 Darunter ist die Kompilation der bestehenden elf Verträge und sämtlicher Protokolle, der Verzicht auf die „Drei-Säulen-Struktur“ sowie die Verschmelzung der drei Europäischen Gemeinschaften (EG, EGKS und EURATOM) in eine Union zu verstehen. Mit diesem Vorgehen würde man außerdem der Rechtsprechung des EuGHs gerecht, der die bestehenden Verträge bereits als Verfassung(sgrundlage) der EU bezeichnet.
Das „Vertragssplitting“ und der daraus hervorgehende Grundlagenvertrag für die Europäische Union hätten den weiteren Vorteil, daß die in diesem Jahr ausgearbeitete EU-Grundrechtscharta an prominenter Stelle - vielleicht in Form einer Präambel - am Anfang dieses Grundsatzvertrages stehen könnte. Somit würde dieses Dokument nicht nur ein weiteres unter der Vielzahl der Verträge bilden.31 Daneben könnte ein transparenter, gut strukturierter und möglichst verständlicher Grundlagenvertrag ein Beitrag zur Identitätsförderung der Unionsbürger mit der Europäischen Union leisten, gleichwohl sich eine solche Erwartung wohl nur in einer Langzeitwirkung entfalten wird. Eine solche identitätsstiftende Wirkung hinge sicherlich auch von der Form der Ausarbeitung des Vertrages ab. So würde diese Wirkung zum einen sicher dadurch unterstützt, wenn sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer im Europäischen Rat für einen ähnlich wie bei der EU-Grundrechtscharta besetzten Konvent als Gremium zur Ausarbeitung dieses Grundlagenvertrages, entscheiden könnten.32
D. h., daß die überwiegende Zahl der Mitglieder dieses einzusetzenden Verfassungskonvents ebenfalls aus Parlamentariern der nationalen Parlamente und des EPs bestehen sollte. Die identitätsstiftende Wirkung eines von den „Drei Weisen“ vorgeschlagenen Grundlagenvertrages könnte zum anderen aber sicherlich auch durch ein europaweites Referendum erhöht werden, das nach Abschluß der Ausarbeitung durch einen solchen Konvent durchgeführt werden könnte. Schon im Zusammenhang mit der bevorstehenden Aufnahme der EU-Grundrechtscharta in das Primärrecht erhoffen Befürworter einer solchen Volksbefragung eine veränderte Wahrnehmung und Sichtweise der europäischen Unionsbürger auf die EU.
Ein weiterer Vorteil der Zweiteilung der europäischen Vertragstexte bestünde in der Schaffung einer „dynamischen Komponente“ in Form des Ergänzungsvertrages. Mit diesem Vertrag über die Einzelbestimmungen und Ausführungen zu den (vergemeinschafteten) Politikfeldern der EU, die nach dem Vorschlag der Weizsäcker-Kommission zukünftig durch Mehrheitsentscheidungen revidierter sein sollten, würde man einer wichtigen Feststellung von Pernice und Frowein gerecht, wonach „Verfassung im europäischen Kontext als Prozess zu verstehen“ sei.33 Auch wenn man bereits auf dem EU-Gipfel von Nizza eine neue Regierungskonferenz mit dem Auftrag einer Ausarbeitung einer europäischen Verfassung einsetzen bzw. einen Zeitplan für dieses Vorhaben in Aussicht stellen sollte, so wird sich auch 200434 noch nicht endgültig beantworten lassen, welche Politikfelder in welchem Umfang zukünftig im ausschließlichen Regelungsbereich der EU liegen sollen. Für diesen Umstand benötigt man einen Mechanismus bzw. eine „dynamische Komponente“, die es erlaubt, ohne komplette Novellierungen, den Ergänzungsvertrag so anzupassen, daß neue Befugnisse der EU, die in Zukunft möglicherweise in einzelnen Politikfelder schrittweise ausgebaut werden, festgeschrieben werden können. Ein ähnlichen Modus hat man mit Art. 51 der EU-Grundrechtscharta geschaffen.35
Die Nachteile des „Vertragssplittings“ im Rahmen der Ausarbeitung einer zukünftigen europäischen Verfassung hat u. a. Pernice benannt. Er ist der Auffassung, daß diese Art der Neukonzipierung der Rechtsgrundlage der EU „unrealistisch“ sei, da es schwierig werde, Politikbereiche zu definieren, „deren Bedeutung augenfällig gering ist“.36 Diese Äußerung von Pernice impliziert einen Verweis auf die unzähligen Abhängigkeiten und Interdependenzen zwischen den einzelnen Policy-Feldern der EU. So ist die Frage, welche Politiken als Bestandteil des Grundlagenvertrages und welche als Bestandteile des Ergänzungsvertrages der Union aufgenommen werden sollten, durchaus berechtigt. Nach den Vorstellungen der Expertenkommission sollten beispielsweise die Aufgaben und Zuständigkeiten der Organe und Institutionen in dem zukünftigen Grundlagenvertrag geregelt. Damit würden aber bereits in diesem Vertrag Bestimmungen und Aussagen zu einzelnen Politikbereichen gemacht. Dies könnte zu Überschneidungen mit dem Ergänzungsvertrag führen.
Pernice benennt im Zusammenhang mit einer möglichen Zweiteilung der europäischen Vertragstexte einen zweiten gewichtigen Nachteil: So stehe zu erwarten, daß die Mitgliedstaaten auch in Zukunft nicht bereit sein werden, „daß Vertragsänderungen im vereinfachten Verfahren und mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden“.37 Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt eine Forschergruppe am CAP (Centrum für angewandte Politikforschung). Zwar befürworteten die Kommission und das Europäisches Parlament die Zweiteilung, die Mitgliedstaaten hingegen hielten „diese Initiative für unrealistisch, nicht durchsetzbar oder zumindest verfrüht“.38
Insbesondere die Frage der Vertragsänderungen im Bereich der Politiken der EU sollte nicht unterschätzt werden. So zeigt sich in der zur Zeit laufenden Regierungskonferenz, daß eine Ausweitung des Mehrheitsprinzips kaum durchsetzbar scheint. Es bleibt also abzuwarten, ob dieses Prinzip zukünftig überhaupt als Grundregel des Entscheidungsverfahrens im Rat angewandt werden kann. Die Notwendigkeit dieses Prinzips steht angesichts der Ost-Erweiterung und der allgemeinen Verdichtung des europäischen Integrationsprozesses wohl selbst bei den Verhandlungsführern der Mitgliedsstaaten außer Frage. Nur so scheint die Handlungsfähigkeit der Union auch in Zukunft zu gewährleisten zu sein. Die Mehrzahl der Mitgliedsstaaten ist zwar bereit, punktuell das Einstimmigkeitsprinzip in das Mehrheitsprinzip zu überführen. Allerdings gehen die Meinungen über die Politikbereiche, in denen dies erfolgen sollte, weit auseinander. Aus heutiger Sicht ist kaum vorstellbar, daß z. B. auch kleinere Entscheidungen in Fragestellungen aus den Bereichen der gemeinsamen Justiz- und Innenpolitik oder der Verteidigungszusammenarbeit zukünftig mit Mehrheitsentscheidung gefällt werden.
Gegen diesen von Pernice angeführten Nachteil einer zukünftigen „zweigeteilten“ europäischen Verfassung muß allerdings eingewendet werden, daß der von den „drei Weisen“ vorgeschlagene verfassungsgebende Prozeß erst der zweite Schritt sein kann. Vor diesem Prozeß muß erst einmal eine grundlegende Reform der derzeit hinlänglich bekannten Defizite der Europäischen Union erfolgen. Dies gilt natürlich insbesondere für die drei left-overs von Amsterdam, die Ausweitung der flexiblen Zusammenarbeit, die Reform der Institutionen und die Abschaffung der „Drei-Säulen-Struktur“ u. ä.. Diese Tatbestände bedürfen einer möglichst raschen und grundlegenden Reform. Auf diese Weise müssen die Institutionen und Funktionsmechanismen der Europäischen Union derart arbeits- und handlungsfähig gemacht werden, daß sie nicht mit jeder der zukünftig anstehenden Erweiterungs- runden angepaßt werden müssen. Sollte dem Europäischen Rat auf dem Gipfel von Nizza am 6. und 7. Dezember d. J. eine grundlegende Reform bzw. eine „verfassungsreife“ Regelung der drei left-overs von Amsterdam gelingen, so müßte dies als Durchbruch und wichtiges Signal für eine zukünftige europäische Verfassung gewertet werden.39
4 Ausblick
An Fragen wie der finalen Gestalt Europas und einer zukünftigen europäischen Verfassung wird die Zweischneidigkeit des europäischen Integrationsprozesses besonders deutlich. Grundsatzfragen dieser Art offenbaren gleichzeitig einerseits die enormen Diskrepanzen zwischen europapolitischen Visionen und der tagespolitischen Realität, andrerseits geben sie Einblick in die enormen Interdependenzen zwischen den aktuell notwendigen Reformen und der finalen Verfasstheit Europas. Der europäischen Integrationsprozeß ist an einem Punkt angelangt, der ein Nachdenken über eine zukünftige europäische Verfassung notwendig und sinnvoll macht. Allerdings muß zum gegenwärtigen Zeitpunkt die konkrete Ausarbeitung einer europäischen Verfassung - also auch einer zweigeteilten, wie sie von den „Drei Weisen“ vorgeschlagen worden ist - angesichts des hohen Regelungs- und Reformbedarfes in den vielen Einzelbereichen der EU als zu verfrüht bezeichnet werden. Besonders deutlich wird dieses komplexe Dilemma auf der zur Zeit laufenden Regierungskonferenz. So besteht das Mandat der Regierungskonferenz im wesentlichen erst einmal „nur“ in der Reform der drei left-overs von Amsterdam, um die Europäische Union auch nach der Ost-Erweiterung handlungsfähig zu erhalten. Andrerseits sprechen etliche Europapolitiker schon heute von einer europäischen Verfassung, einem Kompetenzkatalog und einer rechtsverbindlichen Grundrechtscharta. Dies ist legitim, denn Ziel der EU sollte es sein, sich nach Jahren des „integrationspolitischen Stillstandes“ eine demokratisch legitimierte, übersichtlich strukturierte, funktionsfähige und leistungsstarke institutionelle finale Gestalt zu geben. Diese (bisher nur verbalen) Bestrebungen erzeugen allerdings einen enormen Druck auf die derzeit laufende Regierungskonferenz. Diesem Druck kann die Konferenz nicht bzw. nur kaum gerecht werden, da die traditionellen Verhandlungsmechanismen kaum für den „verfassungs- politischen Quantensprung“ ausreichen. Dies wird einmal mehr zu Problemen in der Wahrnehmung der EU und ihrer Institutionen, Mechanismen und Politiker durch die europäischen Unionsbürger beitragen.
Ein wichtige Signalwirkung für eine zukünftige europäische Verfassung könnte von dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Nizza im Dezember d. J. ausgehen. So müßte es dem Europäischen Rat dort gelingen, die drei left-overs von Amsterdam nicht nur durch einen Minimalkonsens, sondern weitgehend uneigennützig von nationalstaatlichen Interessen zu regeln. Schaffte er dies, bestünde die positive Aussicht, daß sich unter ähnlichen Prämissen auch eine europäische Verfassung samt eines dringend erforderlichen Kompetenzkataloges und der Festschreibung der Rechtsverbindlichkeit der EU-Grundrechtscharta mittelfristig realisieren lassen könnte. Für ein solches Zurückstellen nationaler Interessen gibt es durchaus Anzeichen. So verlautete aus deutschen Diplomatenkreisen bei dem informellen Ratstreffen von Biarritz, daß Deutschland durchaus bereit sei, völlig auf Kommissars- posten zu verzichten, sollte für die zukünftige Kommissionsbesetzung ein Rotationsprinzip eingeführt werden. Allerdings müsse dafür die Stimmengewichtung im Rat zu Gunsten der Bundesrepublik aufgewertet und den demographischen Verhältnissen besser angepaßt werden.40 Andrerseits sollte der Einfluß von Staaten wie Schweden, Großbritannien und Dänemark, die allgemein als „Bremser“ des europäischen Integrationsprozesses bekannt sind, nicht unterschätzt werden. So setzt sich beispielsweise Schwedens Ministerpräsident Persson, der in der ersten Hälfte des Jahres 2001 die Ratspräsidentschaft im Europäischen Rat übernehmen wird, für einen weiteren Ausbau der Intergouvernementalisierung in der EU aus.41 Gerade vor dieser Tendenz hat Kommissionspräsident Prodi jüngst vor dem Europaparlament gewarnt. Es liegt auf der Hand, daß Staaten, die sich gegen eine weitere Vergemeinschaftung von Politikfeldern stellen und vielmehr ein Europa starker Nationalstaaten befürworten, kaum Interesse an einer europäischen Verfassung haben.
Eine zweigeteilte europäische Verfassung, wie sie die „Drei Weisen“ der Weizsäcker-Kommission vorgeschlagen haben, kommt den traditionellen Verhandlungsmechanismen in der EU und dem bisherigen Integrationsprozeß insofern entgegen, als daß sie auf die bestehenden Verträge aufbaut und diese auf zwei Grundlagendokumente reduziert. Der erreichte (verfassungs)rechtliche Besitzstand der Europäische Union würde gewahrt und konsolidiert. Allerdings kann eine solche Kompilation des „gemeineuropäischen Verfassungsrechts“42 erst nach grundlegenden Reformen erfolgen, sonst würde dieser Vorschlag ad absurdum geführt: Es geht um ein möglichst endgültige Festschreibung der Grundlagen der EU in einem Grundlagenvertrag. Die Hürden zur Änderung dieses Grundlagenvertrages sollen möglichst so hoch sein, daß auf permanente Vertragsrevisionen wie in der Vergangenheit verzichtet werden kann. Da wichtige Reformen der EU-Institutionen und –Mechanismen noch ausstehen, ist der Zeitpunkt für eine europäische Verfassung gegenwärtig noch nicht gekommen. Allerdings sollten Reformen, die kurz- und mittelfristig ohnehin dringend durchgeführt werden müssen, verfassungstaugliche Ergebnisse zeitigen. So könnten bereits ausgearbeitete Entwürfe für eine zweigeteilte europäische Verfassung heute schon gleichsam als Arbeitsagenda genutzt werden, anhand derer man die in näherer Zukunft noch durchzuführenden Reformen organisieren könnte.
5 Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6 Literaturverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Vgl. zu dem gesamten Komplex: „Chronologie der Verfassungsentwürfe“ im Internet: http://www.uni-trier.de/uni/fb5/ievr/www/eu_verfassungen/ENTWURF_1.HTML.
2 FISCHER: 2000: „Der Schritt von der verstärkten Zusammenarbeit hin zu einem Verfassungsvertrag (...) bedarf dagegen eines bewußten politischen Neugründungsaktes Europas“. Kursiv nur hier.
3 CHIRAC: 2000: „Notre Europe - Discours prononcé par Monsieur Jacques Chirac, Président de la République Francaise devant le Bundestag, 27. 06. 2000“.
4 Vgl. hierzu u. a.: „Reform der Europäischen Union nicht verzögern“. In: FAZ: 22. September 2000; Nr. 221; S. 4.
5 Ein weiteres Beispiel für die wissenschaftliche Begleitung des „europäischen Verfassungsprozesses“ ist u. a. das CAP (Centrum für angewandte Politikforschung München) mit seinem „Grundvertrag für die Europäische Union - Entwurf der „Zweiteilung“ der Verträge“. München: 2000. Daneben auch: die Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh.
6 DEHAENE, WEIZSÄCKER, SIMON: „Die institutionellen Auswirkungen der Erweiterung“. Bericht an die Europäische Kommission. Brüssel: 18. Oktober 1999.
7 Vgl. hierzu u. a.: FISCHER: 2000; S.
8 Vgl. hierzu u. a.: GRIMM: 1995 und MÜLLER-GRAFF: 2000.
9 Vgl. hierzu u. a.: KOENIG/PECHSTEIN: 1998.
10 Der Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) wird 2001 auslaufen.
11 Vgl. hierzu den Verweis von PERNICE: 2000: Insbesondere: Fußnote 16.
12 Dolf Sternberger hat mit seinem Urteil über die Wirkung des deutschen Grundgesetzes die Hoffnung verbunden, daß dieses - nach den negativen Erfahrungen mit der nationalsozialistischen Diktatur - bei den Bundesbürgern einen identitätsstiftenden „Verfassungspatriotismus“ hervorrufe. Ein Terminus, der von Habermas später aufgegriffen wurde.
13 BERTELSMANN - Europa-Kommission: 2000; S. 5.: „Die Gefahr ist jedoch groß, daß in Nizza die Einhaltung des Zeitplans höher bewertet wird als die Qualität der Ergebnisse“.
14 Vgl. zu diesem Vorschlag: SCHMUCK: 2000; S. 50.
15 Diese Entwicklung bleibt weitgehend unberührt von der Klage in der jüngsten Rede von EU-Kommissionspräsident Prodi vor dem Europaparlament in Straßburg, daß eine zunehmende „Intergouvernementalisierung“ die Arbeit der EU- Kommission beeinträchtige. Vgl. hierzu u. a.: FAZ: „Zusammenarbeit der Regierungen schadet der Kommission“; 4. 10. 2000; Nr. 230; S. 9.
16 Nach dem Mandat der Schlußfolgerungen des Ratsvorsitzes von Köln soll die Charta (auf dem Gipfel von Nizza) lediglich feierlich proklamiert werden. „Danach wird zu prüfen sein, ob und gegebenenfalls auf welche Weise die Charta in die Verträge aufgenommen werden sollte“. Zitiert nach: DEUTSCHER BUNDESTAG: Der Konvent der Europäischen Grundrechte-Charta. Texte und Materialien; 2000; Band 2.
17 So war es Niedersachsens Ministerpräsident Gabriel, der als erster die Forderung nach einer klaren Kompetenzab- grenzung als Tagesordnungspunkt der Agenda (spätestens) der nächsten Regierungskonferenz erhoben hat. So sinngemäß in: „Niedersachsen - Eine starke Region für Europa. (...) Regierungserklärung vom 21. Juni 2000. Ähnlich aber auch die französischen Neogaullisten in ihrem Entwurf für eine zukünftige europäische Verfassung. In: FAZ: „Eine Verfassung für Europa“. 17. 06. 2000; Nr. 139; S. 8.
18 MÜLLER-GRAFF: 2000; S. 34.
19 Der Begriff des Staatenverbundes wurde vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seinem bekanntgewordenen „Maastricht-Urteil“ geprägt, der Terminus des „Verfassungsverbundes von PERNICE. U. a. in: ders.: 1999; S. 2.
20 Diese Option wurde mehrfach im Konvent diskutiert und als Möglichkeit angeführt, um auf eine Ausarbeitung der EU- Grundrechtscharta ganz zu verzichten.
21 Vgl. zu einer Darstellung der Lösungsvorschläge u. a. BERTELSMANN-Europa-Kommission; 2000, PERNICE; 2000; WIEDENFELD; 1999.
22 Vgl. hierzu u. a. PERNICE: 2000; S. 10.
23 WEIZSÄCKER, DEHAENE, SIMON: 1999; S. 12.
24 Ebd.; S. 12.
25 Ebd.; S. 12.
26 Ebd.; S. 12.
27 Ebd.; S. 12.
28 Vgl. dazu sinngemäß: WEIZSÄCKER, DEHAENE, SIMON: 1999; S. 13.
29 BERTELSMANN - Europa-Kommission; 2000; S. 30.
30 PERNICE: 1999; S. 2; § 10. PERNICE hat sich ansonsten eher kritisch zur Zweiteilung der europäischen Vertragstexte geäußert. Vgl. hierzu u. a.: PERNICE: 2000; S. 26.
31 Zur Forderung, daß die Grundrechtscharta eine besondere Stellung im EU-Primärrecht erhalten sollte, vgl. u. a. SCHMUCK 2000; S. 49.
32 Von den 62 ordentlichen Mitgliedern des Konvents zur Ausarbeitung der „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ waren alleine 36 Parlamentarier (16 Mitglieder des EPs und 30 Mitglieder der nationalen Parlamente).
33 PERNICE: 2000; S. 13; § 17. FROWEIN fast diese These noch weiter, indem er meint, daß die Europäische Union „ein Bestandteil des Verfassungsprozesses der Mitgliedstaaten ist“. Zitiert nach PERNICE 2000; S. 13; § 17 und Fn. 48. Auf die in dieser These implizierte und von Kritikern einer europäischen Verfassung immer wieder angeführte „Sog- Wirkung“, die nationale Verfassungstatbestände aufsaugen bzw. nachhaltig beeinflussen wird, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden.
34 Dieses Datum wird momentan für den Abschluß der nächsten Regierungskonferenz diskutiert.
35 Vgl. hierzu: CHARTE 4470/1/00 REV 1. Deutsche Fassung. Art. 51, Abs. 1 [Tragweite der garantierten Rechte].
36 PERNICE: 1999; S. 9; § 39.
37 PERNICE: 1999; S. 9; § 39.
38 CAP: 2000; S. 2.
39 Eine solche „große“ Lösung scheint aber z. Z. aber noch in weiter Ferne - betrachtet man die Vielzahl von Pressemitteilungen und Äußerungen von Politikern, die an den Verhandlungen beteiligt sind. Vgl. dazu u. a. nur: „Nur kleinster gemeinsamer Nenner?“ In: FAZ; 10. 10. 2000; Nr. 235; S.6.
40 Vgl. hierzu: „EU einigt sich auf Soforthilfe für Jugoslawien“. In: Süddeutsche Zeitung; 14. 10. 2000; S. 12. 13
41 Vgl. hierzu: „Wenn Schweden über Europa nachdenkt“. In: FAZ; 12. 10. 2000; S. 1 f.
Häufig gestellte Fragen zu: Anforderungen an eine zukünftige europäische Verfassung
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument analysiert die Anforderungen an eine zukünftige europäische Verfassung und bewertet insbesondere den Vorschlag der "Zweiteilung" der europäischen Vertragstexte.
Was sind die wesentlichen Bestandteile des Dokuments?
Das Dokument enthält eine Einleitung und Fragestellung, eine Diskussion der Anforderungen an eine zukünftige europäische Verfassung, eine Analyse der Zweiteilung der europäischen Vertragstexte und einen Ausblick auf die potentiellen Erfolgsaussichten einer solchen Verfassung.
Welche Anforderungen werden an eine zukünftige europäische Verfassung gestellt?
Das Dokument nennt mehrere Anforderungen, darunter Resistenz gegen Novellierungen, Transparenz und Übersichtlichkeit, Aufnahme eines Kompetenzkataloges, vertragliche Festschreibung der Rechtspersönlichkeit der EU und detaillierte Aussagen zu den "left-overs" von Amsterdam. Außerdem sollen die demokratische Legitimation der Organe und Institutionen der EU deutlich erhöht werden.
Was bedeutet der Vorschlag der "Zweiteilung" der europäischen Vertragstexte?
Der Vorschlag, der von der Weizsäcker-Kommission eingebracht wurde, sieht vor, die bestehenden Vertragstexte in einen Grundlagenvertrag (mit Zielen, Grundsätzen, Bürgerrechten und institutionellem Rahmen) und einen Ergänzungsvertrag (mit den rechtlichen Grundlagen der einzelnen Politikfelder) aufzuspalten.
Was sind die Vorteile der Zweiteilung der Vertragstexte?
Vorteile sind die Vermeidung von Komplettrevisionen der Verträge, die größere Einsichtlichkeit der Institutionen, die Stärkung des demokratischen Mehrwerts, die Möglichkeit zur Verwendung bestehender Vertragstexte und -formulierungen, die prominente Platzierung der EU-Grundrechtscharta und die Schaffung einer "dynamischen Komponente" durch den Ergänzungsvertrag.
Was sind die Nachteile der Zweiteilung der Vertragstexte?
Nachteile sind die Schwierigkeit, Politikbereiche nach ihrer Bedeutung zu differenzieren, die mögliche mangelnde Bereitschaft der Mitgliedstaaten, Vertragsänderungen im vereinfachten Verfahren zu beschließen und die potenziellen Überschneidungen zwischen Grundlagen- und Ergänzungsvertrag.
Welchen Ausblick gibt das Dokument auf die Realisierung einer europäischen Verfassung?
Das Dokument sieht die konkrete Ausarbeitung einer europäischen Verfassung zum gegenwärtigen Zeitpunkt als verfrüht an, da noch ein hoher Regelungs- und Reformbedarf in den vielen Einzelbereichen der EU besteht. Es wird aber betont, dass Reformen, die kurz- und mittelfristig ohnehin dringend durchgeführt werden müssen, verfassungstaugliche Ergebnisse zeitigen sollten.
Was ist die "Methode Monnet"?
Die "Methode Monnet" wird im Dokument erwähnt und steht für ein schrittweises Vorgehen in der europäischen Integration, das aber von vielen Europapolitikern als überholt angesehen wird.
Was sind die "three left-overs from Amsterdam"?
Die "three left-overs from Amsterdam" beziehen sich auf die Fragen der Stimmengewichtung und der Mehrheitsentscheidungen im Rat sowie der Zusammensetzung der EU-Kommission (Anzahl der Kommissare), die bereits im Vertrag von Amsterdam hätten gelöst werden sollen, aber auf die nächste Regierungskonferenz verschoben wurden.
- Quote paper
- Henrik Scheller (Author), 2000, Die Zweiteilung der Europäischen Vertragstexte, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/104263