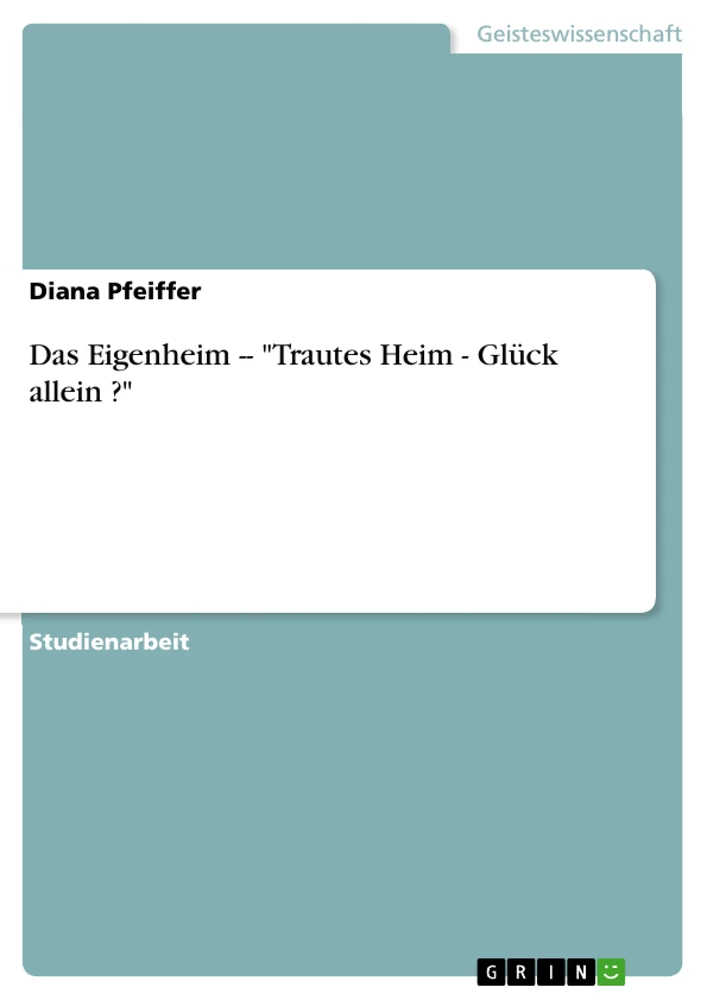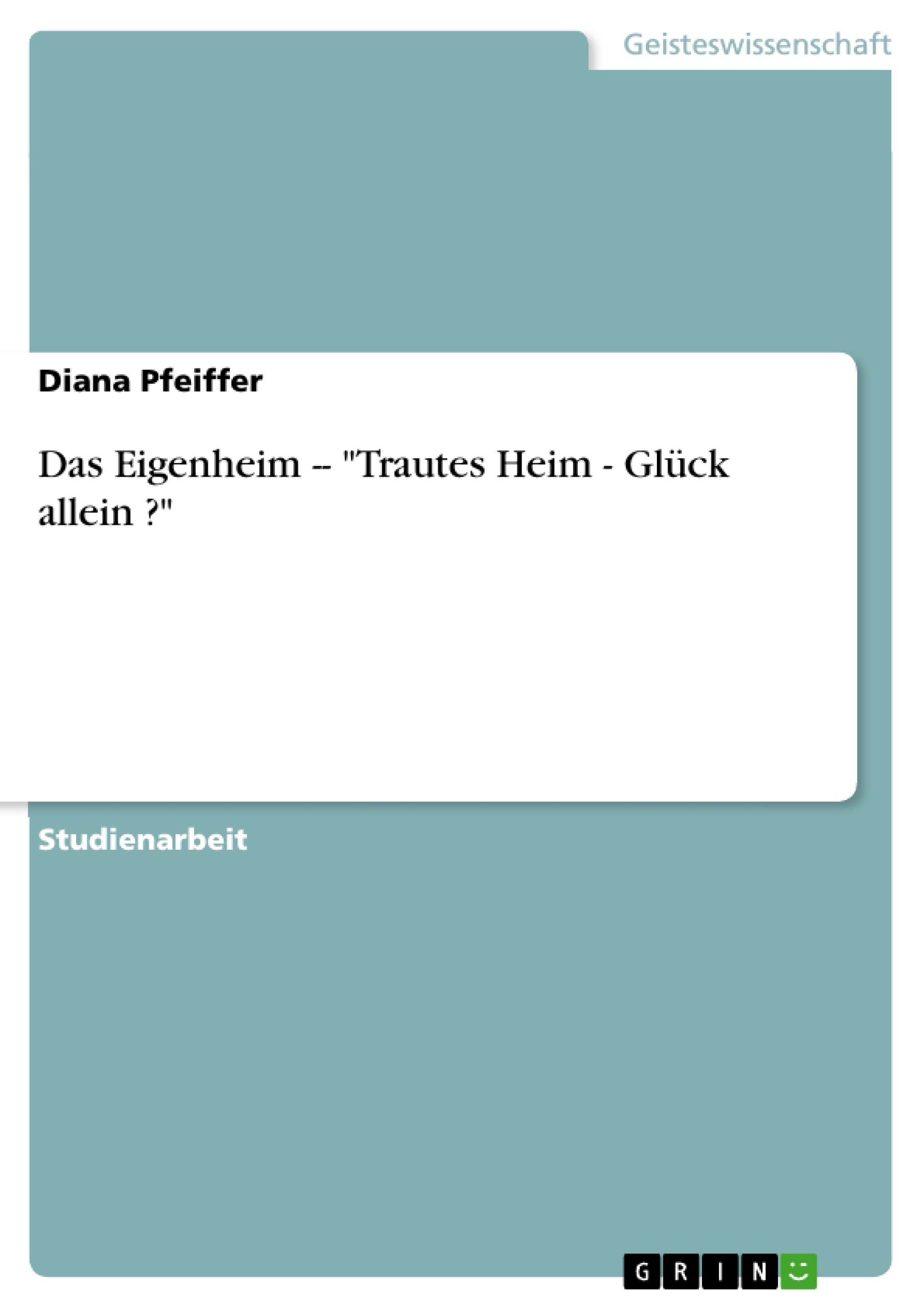Gliederung
Vorwort
I. Bourdieus Theorie der Klassen und Lebensstile
II. Das Eigenheim
III. Verknüpfung von Theorie und Praxis
IV. Literaturangaben
V. Anlagen
Vorwort
Ausgehend von meinem Referat über das Eigenheim, möchte ich dies hier mit theoretischen Grundlagen unterlegen. Den Teil I der Arbeit bildet das theoretische Kapitel über die Lebensstiltheorie Bourdieus. Der französische Soziologe veröffentlichte allerdings bis jetzt so viel Material, dass es keineswegs leicht war das Wichtigste, für mich Notwendige, herauszufiltern. Es wird versucht, in diesem ersten Teil der Arbeit seinen Ansatz kurz und prägnant darzustellen. Natürlich kann dabei nicht auf alles, sei es noch so interessant, eingegangen werden.Es wird im folgenden nur einen kurzen Überblick seiner Lebensstiltheorie geben.
Teil II wird das praxisbezogene Kapitel über das Wohnen im Eigenheim sein. Es war relativ einfach Material über diese Wohnform zu finden, da sie nicht nur in der heutigen Gesellschaft zu der bevorzugten gehört und es desha lb viel Informationen darüber gibt. Speziell geholfen hat mir dabei mein Praktikum im Wohnungsamt Zwickau.
Im dritten Kapitel werde ich versuchen Theorie und Praxis zu verbinden und sie miteinander zu vergleichen.
I. Bourdieus Theorie der Klassen und Lebensstile
Pierre Bourdieu (*1930) hat eine Gesellschaftstheorie entworfen, die versucht soziale Ungleichheiten allgemein zu erklären. Er wollte die Praxis über eine Strukturtheorie beschreiben. Zwischenelement ist dabei der Habitus. Als Ergebnis stellte er eine soziokulturelle Klassentheorie auf, die er mit vielen empirischen Studien der Gesellschaft Frankreichs belegte, so z.B. in seinem wichtigsten Werk Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft (frz. Erstausgabe 1979). In zahlreichen anderen Arbeiten und Schriften erweiterte und spezialisierte er sein Modell ständig. Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht seine Erklärung der Lebensstile.
Laut Bourdieu entstehen die Lebensstile durch die soziale Position (soziale Klasse) und den Habitus. Der Habitus bestimmt die Handlungen eines Akteurs in jeder Handlung. Er ist nicht angeboren, sondern entsteht durch individuelle und kollektive Erfahrungen bei der Wahrnehmung, beim Denken und Handeln.
Ein sehr treffendes Schema zu Bourdieus Theorie entwarf H.-P. Müller. (aus: Müller, H.-P.; 1992; S.297).
Schema 1: Der theoretische Ansatz von Pierre Bourdieu
In einem Raum-Modell führt Bourdieu das Konzept des sozialen Raumes und das Konzept der Lebensstile zusammen. Für die Erklärung sozialer Ungleichheit nutzt er die Klasse- Stand-Problematik und damit zwei Theorietraditionen. Er verbindet Marx' Klassentheorie und Webers Schichttheorie. Marx' Theorie bildet durch die Besitz- und Eigentumsverhältnisse den materialistischen Pol, das "Haben", Webers Schichttheorie stellt durch die subjektiven Werte und Einschätzungen den symbolische Pol dar, das "Sein". Das Materielle wird in das Modell als sozialer Raum oder Raum objektiver, sozialer Positionen aufgenommen, das Subjektive als Raum der Lebensstile.
Der soziale Raum wird anhand objektiver, materieller Lebensverhältnisse untersucht, d.h. anhand des Kapitalvolumen, Kapitalstruktur und der sozialen Laufbahn. Das alles ist empirisch messbar. An dieser Stelle integrierte Bourdieu seine Kapitaltheorie. Jeder Mensch besitzt ökonomisches (Güter, Waren, Geld), kulturelles (Bildung, Titel, Antiquitäten) und soziales (Beziehungen, Freundeskreise) Kapital.
Kapitalvolumen meint den Umfang, die Größe dieser drei Kapitalarten, Kapitalstruktur ist das Verhältnis der drei Arten zueinander und soziale Laufbahn ist die Veränderung oder der Übergang der drei Arten im Laufe der Zeit.
Bourdieu hat ein Schema entwickelt, dass das Verhältnis von Kapitalvolumen (y) zur Kapitalstruktur (x) wiederspiegelt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die x-Achse (Kapitalstruktur) zeigt das Verhältnis von kulturellem Kapital zu ökonomischem Kapital. Im negativen Bereich der x-Achse ist das kulturelle Kapital größer als das ökonomische. Auf der rechten Seite der x-Achse überwiegt das ökonomische Kapital. Das soziale Kapital wird von Bourdieu hier vernachlässigt.
Es ist möglich in dieses Schema die verschiedenen Berufsgruppen einzutragen und so ihre Stellung im sozialen Raum zu bestimmen. Führungskräfte aus der Privatwirtschaft und Freiberufler z.B. sind nahe der positiven y-Achse einzuordnen. Ihre Kapitalstruktur ist ausgeglichen, d.h. sie liegen nahe Null auf der x-Achse und haben ein großes Kapitalvolumen, was bedeutet sie befinden sich im oberen bereich der y-Achse. Ingenieure haben eine ähnliche Lage in dem Schema. Sie liegen nur noch oberhalb der Führungskräfte und Freiberufler auf der y-Achse, weil sie noch mehr Kapitalvolumen besitzen. Zu sehen ist das im nächsten Schema, das von Bourdieu selbst stammt. (Bourdieu; 1982; S. 708).
Schema 2: Der soziale Raum für die französische Gesellschaft in den 60/70er Jahren:
Kursiv geschrieben sind französische Zeitungen, die von den Gruppen bevorzugt gelesen werden. In Rechtecke eingerahmt gibt Bourdieu die Parteigesinnung der Gruppen an.
Ohne genau beschreiben wie leitete Bourdieu daraus drei soziale Klassen ab, die herrschende Klasse (Großbürgertum), die Mittelklasse (auch Kleinbürgertum) und die Beherrschten (auch Volksklasse). Das Großbürgertum lässt sich unterscheiden in Besitz-, Bildungsbürgertum und neue Bourgeoisie und das Kleinbürgertum kann man intern differenzieren in absteigendes, exekutives und aufsteigendes Kleinbürgertum.
Klassen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(nach: Müller,H.-P.; 1992; S.322)
Der Raum der Lebensstile zeigt symbolische Merkmale der Lebensführung, also die repräsentierte Welt. Subjektive Werte wie bevorzugte Ernährung, Musik, Hobbies und Autos werden aufgezeigt und ausgewertet. Die soziale Stellung im Raum (Klasse) bestimmt den Habitus und damit den Lebensstil. Lebensstile sind nicht zufällig verteilt, noch frei wählbar. In seinem Buch Die feinen Unterschiede. analysiert Bourdieu bis ins Kleinste die Lebensstile der verschiedenen Klassen. Nach Auswertungen von Statistiken, aber auch nach Einzelinterviews beschreibt detailgetreu, welche Trink- und Essgewohnheiten jede Klasse besitzt, welche Hobbies und andere Vorlieben sie haben und auch wie sie wohnen. Wie im oberen Schema kann man jeder Gruppe einen eigenen Geschmack zuordnen. Geschmack ist die Grundlage des Lebensstils. Er wird durch den Habitus der eigenen Klasse vermittelt. Der Klassenhabitus verbindet also Theorie und Praxis.
Im nächsten Schema sind Geschmacksunterschiede der herrschenden Klasse (Großbürgertum) dargestellt.
Schema 3: Antagonistische Lebensstile des herrschenden Geschmacks
(Quelle: Müller, H.-P.; 1992; S. 328)
Sich auf die drei Klassen beziehend unterscheidet Bourdieu drei Geschmacksformen: den legitimen Geschmack (auch Distinktions- oder Luxusgeschmack), den mittleren Geschmack (Bildungsbeflissenheit) und den populären Geschmack (Notwendigkeitsgeschmack) der Volksklasse.
II. Das Eigenheim
Die privateste Form des Wohnens ist das Einfamilienhaus. Darin wohnt nur die Kernfamilie, d.h. eine Zwei-Generationen- Familie.
Der begriffliche Unterschied zwischen Eigenheim und Einfamilienhaus besteht in der Eigentumsform. Das Eigenheim ist immer Wohneigentum, während das Einfamilienhaus auch gemietet sein kann, und dann im Eigentum einer anderen Person steht.
Im zweiten Wohnungsbaugesetz von 1956 steht, ein Eigenheim ist "ein im Eigentum einer natürlichen Person stehendes Grundstück mit einem Wohngebäude, das nicht mehr als zwei Wohnungen enthält, von denen eine Wohnung zum Bewohnen durch den Eigentümer oder seine Angehörigen bestimmt ist." (Schildt, 1998, S.410).
Ein Eigenheim vereinigt drei Aspekte:
- den rechtlichen, indem es Eigentum einer Person ist
- die Wohnform, die individuell ist, mit Grundstück versehen und eine große Wohnfläche hat
- den emotionellen, der "mein Eigen" bedeutet und meinen Geschmack darstellt
(ebd., S.409).
Ein „Häuschen im Grünen“ für die Kleinfamilie erträumt sich die Hälfte aller Deutschen zwischen 25 und 35 Jahren. (Bourdieu, 1998, S.7). Es ist ihr Wohnideal, weil sie unabhängig von Mietpreisen sind, Sicherheit im Alter haben, Platz und Grünfläche da ist, sie Privatsphäre haben und selbst organisieren können.
Das alles entspricht auch den Aspekten modernen Wohnens von Häußermann und Siebel:
- die zwei- Generationen- Familie als soziale Einheit
- Trennung von arbeiten und wohnen
- Trennung vo n Privatheit und Öffentlichkeit
- individuelle Aneignung und Gestaltung
(Häußermann/ Siebel aus: Häußermann, Ipsen, Krämer- Badoni, Läpple, Bodenstein, Siebel, 1992; S.134).
Auch Klein hat 1970 eine Umfrage geleitet, in der man von Bürgern wissen wollte, warum sie Eigentümer werden wollen. Als Antworten kamen: Unzufriedenheit mit der Mietwohnung, das ständige Rücksichtnehmen auf andere, schlechte Erfahrung mit Vermietern, sie sehen eine symbolische Identität zwischen Familie und Eigenheim, wollen Sicherheit, Unabhängigkeit, Freifläche und Abstand, kurz gesagt alles, was vitale s Wohnen ausmacht. (Häußermann/ Siebel, 1996, S. 232).
Eine andere Untersuchung von Petrowsky 1993 erforschte Biografien von Arbeitern. Petrowsky fand heraus, dass niemand „Mieter aus Überzeugung“ war. (ebd., S.269).
Es sind zwar bestimmte Normen für den Wohnungsbau vorgeschrieben, aber bei Eigenheimen kann man sehr viel mitbestimmen über die eigenen Wohnbedingungen und kann den Wohnraum individuell an seine Bedürfnisse anpassen. Z.B. kann jeder selbst entscheiden, ob er Wintergarten, Garage oder ein Gästezimmer benötigt. Die Durchschnittsfläche beträgt zwischen 100 - 130m². Es gibt heute fast zu viele Möglichkeiten für die Einrichtung des individuellen Hauses. In Anlage 1 und 2 sind verschiedene Häuser einer Firma zu sehen. Sie gaben sogar bestimmte Vorschläge zum Grundriss und Innenausbau. Dies sind einige Musterbeispiele wie ein Haus räumlich aufgeteilt sein kann.
In der Anlage sind außerdem unterschiedliche Häuser zu sehen, teils auf Fotos (Kreis
Chemnitzer Land), teils auf Werbeblättern spezieller Anbieter. (Anlage 3und 4). Einen großen Absatz haben zur Zeit auch die schnell gebauten Fertigteilhäuser. (vgl. Anlage 4). Eine ebenso große Auswahl gibt es an Zeitschriften für den Haus-(aus-)bau, die Tipps geben wie man sein Haus noch schöner und individueller gestalten kann.
Es heißt, Eigentum gehört zur menschlichen Natur und steht für Freiheit und Unabhängigkeit. In einer Fernsehwerbung der LBS heißt es: "Ein Haus zu bauen liegt in der Natur des Menschen, Miete zahlen nicht. LBS - wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause." Man ist unabhängig von „draußen“, indem man seine eigene kleine Welt, die Privatsphäre, aufbaut, wo man selbst der Chef ist. Man träumt von einem harmonischen Familien- zusammenleben.
In Anlage 6 sieht man ein Werbeblatt einer Bank, was behauptet, "Wohneigentum macht glücklich !". Wirtschaft und Politik fördern also den Erwerb eines Hauses, denn es hat einen hohen symbolischen, materiellen und praktischen Wert. Im Wohnungsamt kann man sich über die verschieden Förderungsmöglichkeiten (Eigenheimzulage, Eigentumsförderungsgesetz...) informieren.
Das Eigentum an Grund und Boden dient als Selbstbeweis des Menschen, dass er etwas geschaffen hat in seinem Leben. Eine ländliche Tradition heißt: „Baue ein Haus, pflanze einen Baum und zeuge einen Sohn“, dann ist die Existenz und das Fortleben gesichert. Etwas an seine Kinder vererben, stellt etwas wie ein Denkmal, eine Erinnerung an einen selbst dar. In der vorindustriellen Zeit dient ein Haus hauptsächlich zur Existenzsicherung.
Heute ist es eher soziale Sicherung, Kapitalsicherung und demonstrativer Konsum, weil Grund und Boden immer noch Beständigkeit hat. Gerade bei lohnabhängigen Arbeitern bedeutet ein eigenes Heim Sicherheit gegenüber der Unsicherheit der Markt- und Arbeitslage. Es dient sozusagen als Kapitalanlage. Während Mieten im Laufe der Zeit höher werden, sinken die Zahlungsraten des Hauses bis hin zum kostenlosen Wohnen im Alter. Die Wohnkosten sinken mit der Zeit. Wenn man bedenkt, dass Rentner weniger Geld zur Verfügung haben, ist Wohneigentum ein großer Vorteil. So haben Eigentumshaushalte im Vergleich der Wohnbelastungsquoten im Rentenalter einen Vorteil gegenüber Mieter- haushalten von 20%. (vgl. Tabelle).
Es ist erwiesen, dass Rentner einen Umzug ohne zwingende Gründe ablehnen. Sie wollen ihren Lebensabend in der gewohnten Umgebung verbringen.
Quelle: Broschüre der Initiative zur Stärkung des Wohneigentums durch kostengünstiges Bauen. 1999. S. 51.
Neben dem privaten Nutzen des Eigenheims gibt es die Legende des gesellschaftlichen Nutzens. Die Förderung des Eigenheimbaus von konservativen Politikern, zielt auf eine stabile, bürgerliche Gesellschaft ab, auf eine "Verwurzelung" der Menschen in der Gesellschaft. (Schildt, 1988, S.421). Wenn Menschen Eigentum haben, sind sie zufrieden und das ergibt eine entpolitisierende Wirkung. Vor allem Arbeitern soll so Sparsamkeit, Eigenverantwortung und freie Lebensgestaltung beigebracht werden.
Der CDU/ CSU Fraktionssprecher Dr. Brönner sagte 1949 im Bundestag: "Wer ein eigenes heim besitzt, ist der sparsame, zufriedene, glückliche Mann, dessen Familie lebt ganz anders, als wenn sie in eine Wohnung, in irgendeinen Stock hineingepresst ist. Es fragt sich also, ob wir gerade das Sparen für das Eigenheim und das Sparen für das Wohneigentum nicht noch weiter fördern können. Je mehr Eigentum an Wohnungen es gibt, desto zufriedener ist die Bevölkerung." (Schildt, 1988, S.367).
Trotz dieser Vorteile sind sich alle Autoren einig, dass der Hausbau die folgenschwerste ökonomische Entscheidung im Leben ist. Er strukturiert ganze Lebensläufe durch hohe Kosten an Zeit, Geld, Arbeit und Affekten. Die ganze Familie muss Entbehrungen hinnehmen.
Bourdieu schreibt in seinem Buch Der Einzige und sein Eigenheim, dass viele die auf sie zukommenden Probleme nicht sehen. Die Funktion der Existenzsicherung wird fraglich durch die hohe Verschuldung. Viele wollen unbedingt ein eigenes Haus haben und geraten in eine finanzielle Notlage, gerade dann, wenn nur einer in der Familie arbeitet oder einer von beiden arbeitslos wird. Ein anderes Risiko ist z.B. eine Zinssteigerung während der Abzahlung. Die Eigentumsbildung hat also schwerwiegende Konsequenzen für die restliche Lebensführung, besonders bei den unteren Einkommensschichten. Bei denen ist dies auch nur einmal im Leben möglich. Von der Finanzlage der Familie hängt u.a. ab, wie man das Haus finanziert, wo man es baut und wie ausschweifend. Reichere Einkommensgruppen können sich Plätze preisunabhängig aussuchen oder an mehreren Orten bauen. Die untere soziale Schicht muss mehr in Eigenarbeit und mit Bekannten bauen. Die Exklusivität des Hauses demonstriert die finanzielle Lage der Familie. Das kann man oft schon am Äußeren des Hauses erkennen. (vgl. Anlage 1-5).
Ökologische Nachteile des vermehrten Eigenheimbaus sind Versiegelung der Grünflächen, Zersiedelung der Landschaft, Zunahme des Verkehrs durch die Arbeitspendler und die Entleerung der Städte. Es entsteht Segregation, d.h. unterschiedliche soziale Schichten ziehen in verschiedene Wohngebiete. Arme, Ausländer und Alte bleiben in den Innenstädten, reichere Familien ziehen an den Stadtrand.
Außerdem ist das Eigenheim die am meisten energie- und flächenverbrauchende Wohnform. Woran die meisten Leute beim Eigenheimbau nic ht denken ist die soziale Isolation. Man wünscht sich zwar ein „Häuschen ganz für uns“, aber nach und nach vereinsamt man doch. Verwandte und Freunde leben weit weg und die Kontakte brechen langsam ab. Die Nachbarn kennt man oft nicht. Besonders für Frauen, die häufig „nur“ Hausfrauen sind, ist die Lage schwer zu ertragen. Diese Hausfrauen werden auch „grüne Witwen“ genannt. (Vaterlaus,S.79). Die Männer sind nur zum Schlafen zu hause, weil die Pendelzeit lang ist. Die Wege zum Einkauf oder zu staatlichen Institutionen sind länger. Vaterlaus‘ Essay Titel Nach dem Eigenheim kommt die Scheidung sagt alles über den Fortgang der Ehe. Sicher ist das nicht immer der Fall, aber in der Schweiz ist bewiesen, dass die Scheidungshäufigkeit in städtischen Agglomerationen höher ist als in den Städten. Erich Fromms Theorie war, dass man sich nicht-käufliche Dinge über andere ökonomische Leistungen verschaffen, was aber nicht möglich ist. Der Wunsch nach dem Eigenheim ist oft der Wunsch nach Geborgenheit, familiärer Eintracht, d.h. nach einem guten Leben. (Junker, S.76). Man hofft, die positiven Wirkungen sind im Kaufpreis enthalten.
Als weiterer Nachteil wird die geringe Mobilität der Bevölkerung nach dem Hausbau genannt. Dies muss man allerdings differenzierter betrachten, denn die Drittvariable Alter hat einen entscheidenden Einfluss.
Es ist ein Vorurteil, dass Mietbewohner mobiler sind als Hauseigentümer. Richtig ist, dass jüngere mobiler sind als ältere. Dabei ist egal, ob die ältere Generation ein Haus oder eine Wohnung hat. Kinderlose Ehepaare unter 35 Jahren sind am mobilsten. (Häußermann/ Siebel, 1996, S.279).
Folglich ist der Hausbau abhängig vom Alter. Es wird während der Familienaufbauphase gebaut, d.h. heute ca. mit 30-40 Jahren. Wenn man sich beruflich etabliert hat und ein stabiles Einkommen bezieht. Die Eigentumsquote ist bei den unter-30-jährigen 4%, bei unter-35- jährigen 24,4%, bei 45-55-jährigen größer als 60% und bei denen, die älter sind als 65 Jahre 41,3%. (Häußermnn/ Siebel, 1996, S.237). Ehepaare erwerben zu 90% Wohneigentum im Zusammenhang mit der Familiengründung. (Bourdieu u.a., 1998, S.151).
Im europäischen Vergleich hat Deutschland trotzdem nur eine geringe Eigentumsquote, 1997 41,6% (Westdeutschland). Während es in Großbritannien 68% und in Frankreich 54%. Die aufholenden neuen Bundesländer erhöhen die Zahl noch. Dort stieg die Zahl von 26,1% (1993) auf 31,1% (1997). (Bourdieu u.a., 1998, S.7).
Die geringere Quote ist sicherlich mit dem gut ausgebauten Sozialnetz zu erklären, womit Sozialschwache hier relativ gut abgesichert sind. Denn in den USA und in Australien, wo dies nicht der Fall ist, ist auch die Quote viel höher. (Häußermann/ Siebel, 1996,S.277).
III. Verknüpfung von Theorie und Praxis
Es gibt Unterschiede in der Verteilung von Eigentum an Häusern und Wohnungen nach sozialen Schichten und Generationen. Die verschiedenen sozialen Schichten haben unterschiedliche Voraussetzungen und für den Eigentumserwerb. Geschmack, Habitus und Lebensstil variieren. Die Zusammensetzung des Kapitals bestimmt den Habitus und die Vorlieben. Man kann die verschiedenen Klassen mit ihren Lebensstilen und Präferenzen an verschieden Stellen im Konzept des sozialen Raums einordnen.
Ausgangspunkt für die Anschaffung von Wohneigentum ist die Menge und Struktur des Kapitals, der soziale Werdegang, das Alter, Anzahl der Kinder und Stellung im Familienkreis. Die Eigentumsquote ist vom Kapital abhängig. Je höher das Vermögen ist, desto wahrscheinlicher besitzt man Eigentum. Haushalte mit ho hem ökonomischen Kapital haben allerdings die Wahl zwischen Eigentum oder Miete.
Der Anteil der Personen, die durch ein Erbe Eigentum bekommen geht immer mehr zurück. Allgemein ist die Zahl der Hauseigentümer gewachsen. Bourdieu fand für Frankreich heraus, dass die Eigentumsquoten bei Haushalten mit höherem Einkommen stärker stiegen als bei ärmeren Haushalten. Trotzdem verfügen ca. 30% der Haushalte der unteren Einkommensschicht über Hauseigentum. (Bourdieu u.a., 1998, S.131).
Gewiss ist die Besitzquote bei denjenigen am höchsten, bei denen das ökonomische Kapital überwiegt, d.h. bei Industrie- und Handelsunternehmern, Landwirten und Freiberuflern. Aber gestiegen ist das Eigentum am meisten bei Personen, die mehr kulturelles als ökonomisches Kapital besitzen, d.h. bei Beschäftigten des mittleren und höheren öffentlichen Dienstes (Techniker, Angestellte, Ingenieure) und in höheren Regionen der Arbeiterklasse (Vor-, Facharbeiter).
Haus- und Grundbesitz in Westdeutschland:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Geißler, 1996, S.66)
Um Eigentum zu erwerben muss ein gewisses Minimalvolumen an ökonomischem Kapital da sein, ein bestimmter Schwellwert. Unter dessen Grenze wagt man es nicht zu bauen, man würde sich zu hoch verschulden. Personen mit einem großen kulturellen Kapital sind eher Mieter (z.B. Professoren, Künstler, leitende Angestellte). Der Prozentsatz der Wohnungseigentümer steigt mit dem ökonomischen Kapitalvolumen, zumindest oberhalb eines Schwellenwertes. Er steigt mit dem Einkommen (8,1% - 22,1%). Der Prozentsatz der Hauseigentümer steigt weniger mit dem Einkommen (35,2% - 43,1%). (Bourdieu u.a., 1998, S.143).
Bourdieu vermutet außerdem, dass nicht nur ökonomisches Kapital für Eigentum benötigt wird, sondern auch ein Minimum an kulturellem, was aber kaum sichtbar ist. Eine notwendige Bedingung für Eigentum ist ein Berufsabschluss.
Trotz einer scheinbaren Demokratisierung des Zugangs zum Eigenheim, die durch den Anstieg der Quote bestätigt wird, verbergen sich große Unterschiede in Lage, Ausstattung und Finanzierung. Die Größe des Wohnortes, wo man ein Haus baut, zeigt die soziale Schicht des Eigentümers. Zum Beispiel haben Arbeiter eher ein Haus in ländlichen Gegenden, weil da die Bodenpreise geringer sind, und Vorarbeiter in der Stadtrandzone. (Bourdieu u.a., 1998, S.150).
So bleiben die sozialen Schichten meist unter sich und die typischen Lebensweisen werden weiter übertragen.
In Häußermanns und Siebels Soziologie des Wohnens wird von zwei grundlegenden Lebensstilen gesprochen, dem investiven und den konsumtiven Lebensstil. (Häußermann/ Siebel, 1996, S.281). Der investive Lebensstil trifft meist für lohnabhängige Arbeiter zu, die für Eigentum viel Arbeitskraft, Zeit und Geld investieren müssen. Der konsumtive Lebensstil ist typisch für höhere Einkommensklassen, die eine starke Position auf dem Arbeitsmarkt haben und den Eigentumserwerb durch eigenes Geldeinkommen finanzieren können. Beim investiven Lebensstil wird alles getan, um eigene Werte zu schaffen. Dieser Lebensstil kann gleichgesetzt werden mit Bourdieus Lebensstil des Kleinbürgertums.
"Das Kleinbürgertum ist der beste Kunde von Massenkultur und Massenkonsum...". Die Anerkennngssucht bringt die Bürger dazu sich Bildung, Kultur und Sachgüter zu erwerben. Man orientiert sich dabei am altbewährt Klassischen und investiert in sichere Werte, tendiert aber zur Überkorrektheit und zu Rigorismus, d.h. man hält sich peinlich genau an Regeln und vermeidet ängstlich Fehler. (Bourdieu, 1982, S. 333).
Auch das Wahlverhalten charakterisiert den Lebensstil. Eigentum wiederum beeinflusst das Wahlverhalten. Aus Studien ist bekannt, dass sich Eigentum positiv die Wahl von „rechts“- Parteien, d.h. konservative Parteien, auswirkt. Man wünscht sich, dass alles so bleibt wie es ist und sich so wenig wie möglich ändert.
An Bourdieu anknüpfend wäre zu sagen, dass Eige nheime von allen Bevölkerungsschichten als ideale Wohnform anerkannt werden, aber nicht von allen gleichermaßen genutzt werden. Durch unterschiedliche Lebensbedingungen (materiell, kulturell und sozial) entstehen unterschiedliche Präferenzen und unterschiedliche Wohnbedingungen.
IV. Literaturangaben
von Aarburg, Hans Peter; Oester, Kathrin (Hrsg.): Wohnen. Zur Dialektik von Intimität und Öffentlichkeit. Diskussionsbeiträge zum Thema Wohnen. Freiburg. 1990. darin: Junker, Pierre: Das Eigenheim.
Vaterlaus, Thomas: Nach dem Eigenheim kommt die Scheidung.
Bourdieu, Pierre: Die Feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt a. M. .1982.
Bourdieu, Pierre u.a.: Der Einzige und sein Eigenheim. Schriften zu Politik & Kultur 3. Hamburg. 1998.
Geißler, Rainer: Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Zwischenbilanz zur Vereinigung. Opladen. 1996.
Häußermann, H.; Ipsen, D.; Krämer- Badoni; Th.; Läpple, D.; Rodenstein, M.; Siebel, W.: Stadt und Raum. Soziologische Analysen. Pfaffenweiler. 1992.
Häußermann, H.; Siebel, W.: Soziologie des Wohnens. Eine Einführung in Wandel und Ausdifferenzierung des Wohnens. Weinheim. 1996.
Initiative "Stärkung des Wohneigentums durch kostengünstiges Bauen" (Bausparkasse Schwäbisch Hall): Stärkung des Wohneigentums in Sachsen. Fachsymposium/ Dokumentation. 1999.
Müller, H.-P.: Sozialstruktur und Lebensstile. Der neuere theoretische Diskurs über soziale Ungleichheiten. Frankfurt a. M. .1992.
Schildt, Axel (Hrsg.): Massenwohnung und Eigenheim. Wohnungsbau in der Großstadt seit dem ersten Weltkrieg. Frankfurt a.M. . 1988.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Eigenheim und dessen Verknüpfung mit der Lebensstiltheorie von Pierre Bourdieu. Sie analysiert die sozialen Ungleichheiten im Zusammenhang mit Wohneigentum und untersucht, wie Klassen, Habitus und Lebensstile die Entscheidung für ein Eigenheim beeinflussen.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit stellt Bourdieus Theorie der Klassen und Lebensstile vor. Es wird erläutert, wie soziale Position (Klasse) und Habitus die Lebensstile prägen. Das Konzept des sozialen Raumes wird erklärt, ebenso wie die Rolle von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital.
Was wird zum Thema Eigenheim untersucht?
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich dem Eigenheim als Wohnform. Es werden Definitionen, Aspekte und Motive für den Erwerb eines Eigenheims untersucht. Auch die Vor- und Nachteile des Eigenheimbaus werden beleuchtet, darunter finanzielle Aspekte, ökologische Auswirkungen und soziale Isolation.
Wie werden Theorie und Praxis miteinander verbunden?
Die Arbeit versucht, Bourdieus Theorie mit der Realität des Eigenheimbaus zu verbinden. Es wird analysiert, wie unterschiedliche soziale Schichten unterschiedliche Voraussetzungen für den Eigentumserwerb haben und wie Geschmack, Habitus und Lebensstil die Wohnbedingungen beeinflussen. Die Konzepte des investiven und konsumtiven Lebensstils werden in diesem Zusammenhang diskutiert.
Welche sozialen Klassen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet hauptsächlich zwischen drei sozialen Klassen nach Bourdieu: die herrschende Klasse (Großbürgertum), die Mittelklasse (Kleinbürgertum) und die Beherrschten (Volksklasse). Es wird erläutert, wie sich diese Klassen in Bezug auf Kapitalvolumen, Kapitalstruktur und Lebensstile unterscheiden.
Welche Vor- und Nachteile des Eigenheims werden genannt?
Zu den Vorteilen gehören Unabhängigkeit, Sicherheit im Alter, Platz und Grünfläche, Privatsphäre und die Möglichkeit zur Selbstorganisation. Zu den Nachteilen zählen hohe Kosten, ökologische Auswirkungen (Versiegelung, Zersiedelung), soziale Isolation und geringere Mobilität.
Was sind die wichtigsten Schlussfolgerungen der Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass der Erwerb eines Eigenheims von der sozialen Schicht und den individuellen Lebensumständen abhängig ist. Obwohl das Eigenheim von allen Bevölkerungsschichten als ideale Wohnform anerkannt wird, gibt es große Unterschiede in Bezug auf Lage, Ausstattung und Finanzierung. Die Lebensweisen und Präferenzen werden innerhalb der sozialen Schichten oft weitergegeben.
Welche Literatur wurde verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Vielzahl von Quellen, darunter Werke von Pierre Bourdieu, sowie Studien zur Soziologie des Wohnens und zum Eigenheim. Eine vollständige Liste der Literaturangaben findet sich im entsprechenden Abschnitt der Arbeit.
- Quote paper
- Diana Pfeiffer (Author), 2000, Das Eigenheim -- "Trautes Heim - Glück allein ?", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103914