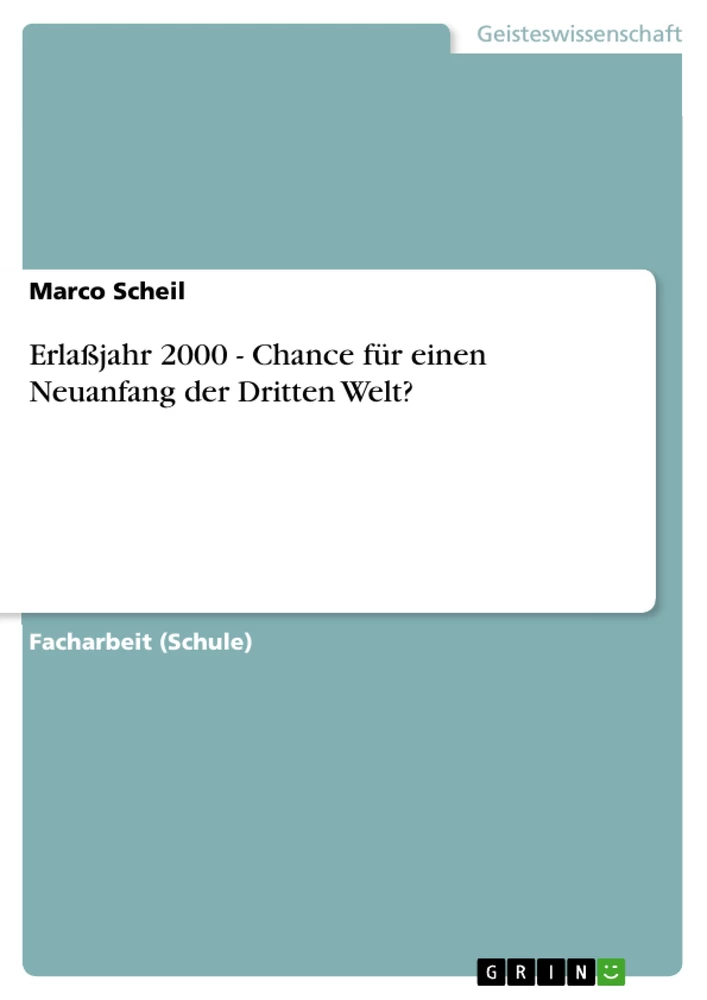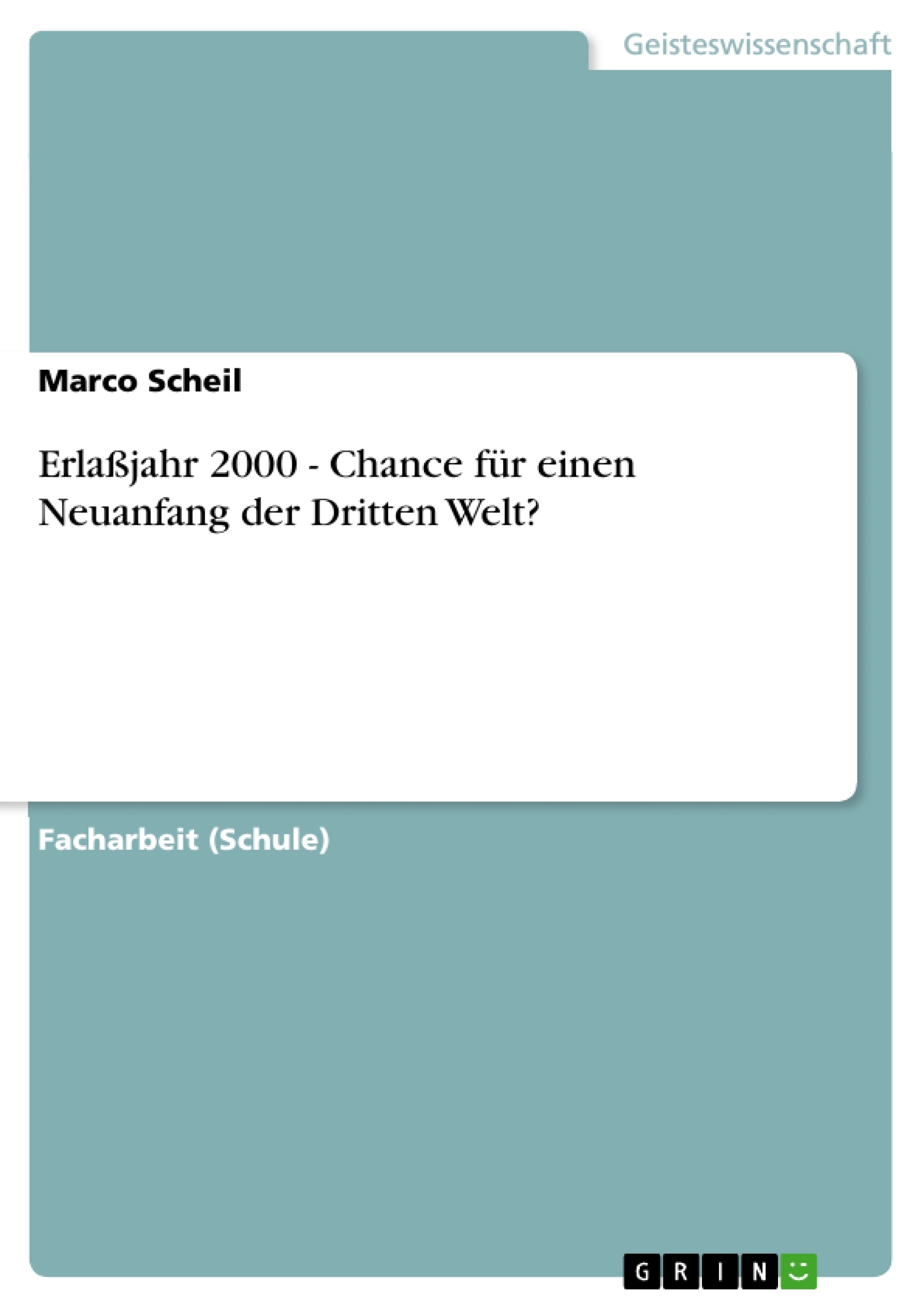Facharbeit im Leistungskurs Sozialwissenschaften
Thema der Arbeit:
Kann durch die Forderung der Kampagne„Erlassjahr 2000“, ein Internationales Insolvenzrecht zu beschließen, die wirtschaftliche Lage der Entwicklungsländer grundlegend verbessert werden?
Eine Untersuchung am Beispiel Mosambiks
1. Was ist„Erlaßjahr 2000“? Welche Ziele verfolgt es?
„Erlaßjahr 2000“ ist eine internationale Kampagne, die einen umfangreichen Schuldenerlass für die Entwicklungsländer der Dritten Welt fordert. Ein weiteres Ziel der Kampagne ist die Neuschaffung eines internationalen Insolvenzrechtes. Gegründet wurde „Erlassjahr 2000“ Ende 1997 in Wuppertal. Die Gründung ging vom „Initiativkreis Entwicklung braucht Entschuldung“ aus, in dem sich seit 1992 ca. 50 Nichtregierungsorganisationen zusammengeschlossen hatten. In Deutschland gibt es 2011 (Stand 31.8.2000) Mitträger, wie z.B. kirchliche oder humanitäre Organisationen, die unter dem Dach der Kampagne zusammengefasst sind.
Die Organisationstruktur sieht wie folgt aus: Das höchste Entscheidungsgremium ist der Kampagnenrat, dem 17 gewählte Mitglieder angehören. Dieses Gremium steht in enger Verbindung mit dem Kampagnenbüro, das bundesweite Aktionen plant und ausführt. Des weiteren gibt es Regionalkoordinatoren, die für die Orga- nisation von regionalen Veranstaltungen verantwortlich sind und als Ansprech- parnter fungieren.
Neben der deutschen Kampagne gibt es auf der ganzen Welt nationale Organisati- onen, die das selbe Ziel verfolgen, eine der bekanntesten ist die britische „Jubilee 2000 Coalition“, die gleichzeitig auch die erste ihrer Art war. Das Engagement der Kampagne hatte bisher ihren Höhepunkt am 17. Juni 1999 bei der symbolischen Unterschriftenübergabe von Bischof Rodriguez, dem Schirmherr der Kampagne, und dem Sänger der Gruppe U2, Bono Vox an Bun- deskanzler Schröder während des G8-Wirtwirtschaftsgipfels in Köln. Die Forderungen, die „Erlaßjahr 2000“ an die Regierungen der G8-Länder stellt, sind zusammengefasst in dem Appell (s. Anlagen), den bis 1999 17 Millionen Menschen aus 160 Ländern unterschrieben.
Auf dem G8-Gipfel in Köln und auf der Herbsttagung 1999 des Internationalen Währungsfonds wurde dann ein Schuldenerlass für die 41 horverschuldeten Staaten (HIPC, Heavily Indepted Poor Countries) beschlossen.
Die Mitträgerversammlung beschloss im November 2000 in Bonn, dass „Erlaß- jahr 2000“ Mitte des Jahres 2001 endet, eine Nachfolgeorganisation soll darauf folgen. Wie die Struktur hiervon aussehen soll und mit welchen Themen sich die neue Organisation dann vorrangig auseinandersetzen wird, das wird zur Zeit ge- plant und vorbereitet.
2. Die Verschuldungskrise der Entwicklungsländer
2.1 Ursachen
Die Verschuldung der Entwicklungsländer wird nach internen und externen Ursachen unterschieden. Die internen Ursachen der Verschuldungskrise sind hierbei in den inneren Gegebenheiten und der Wirtschafts- und Finanzpolitik des jeweilig betroffenen Landes zu suchen. Die externen Ursachen beruhen auf den Bedingungen und Entwicklungen der Weltwirtschaft und dem Verhalten anderer Staaten gegenüber dem jeweiligen Land. Außerdem unterscheidet man langfristige, strukturell-bedingte von kurzfristigen, konjunkturellen Ursachen.
2.1.1 Interne Ursachen
Die internen Ursachen der Verschuldungskrise sind vielschichtig:
Ende der 1960er Jahre gab es zunehmend Industrialisierugsbemühungen in den Entwicklungsländern, auf Grund dessen stieg die Kreditnachfrage deutlich an. Was hierbei berücksichtigt werden muss, ist das Fehlen eines inländischen Ban- kensektors in den Entwicklungsländern bzw. das sich erst im Aufbaustadium be- findliche Finanzwesen. Die Länder waren also gezwungen, sich das benötigte Kapital bei anderen Staaten bzw. bei ausländischen Banken zu leihen, dieser Vor- gang wird als für die Entwicklungsländer charakteristisches „Auslandsbanking“ bezeichnet.
Beeinflußt war das finanzpolitische Geschehen aber auch durch ein weiteres Merkmal: Die politische Lage des jeweiligen Landes war entscheidend für die Kreditvergabe. Während des Kalten Krieges sollten bestimmte Regime gezielt gestützt werden. Ein Beispiel hierfür ist Zaire. Während seiner Amtszeit erhielt Präsident Mobutu Kredite in Höhe von ca. 8,5 Mrd. US-$ vor allem von westli-chen Privat-Banken. Beabsichtigt hatten die Vereinigten Staaten mit dieser Kre-ditvergabe den Machterhalt Mobutus, da Zaire westlich orientiert war.
Nach internen Gesichtspunkten liegt der Hauptgrund für die Verschuldung in der unökonomischen Haushalts- und Finanzpolitik bei den meisten Ländern. So wur- de das geliehene Kapital nicht rentabel investiert, z.B. in gewinnbringende Objek- te wie Fabriken oder Manufakturen. Oftmals wurde das Kapital für Rüstungskäufe oder Prestigeobjekte, die verlustbringend waren, aufgewendet. Die so eingefahre- nen Verluste behinderten die Tilgung und Zinszahlungen daher sehr stark, wes-halb die Schulden weiter anstiegen. Trotz der steigenden Schulden wurden weiterhin bi- oder multilaterale Kredite aufgenommen.
Berücksichtigt werden muss auch die im Vergleich zu den Industrienationen ü- berdurchschnittlich hohe Kapitalflucht. Dabei wurde das an potentielle Investoren wie z.B. Großgrundbesitzer oder Industrielle gegebene Kapital von diesen veruntreut, es wurde nicht für die vorgesehenen industriellen Objekte aufgewendet, sondern im Ausland, meistens bei privaten Banken in den Vereinigten Staaten, gewinnbringend angelegt. Auch korrupte Regierungsangehörige bekamen oft ein Teil des durch Kredite geliehenen Geldes.
Die Investoren provitierten also von den Entwicklungshilfekrediten, während die Wirtschaft und vor allem die Zivilbevölkerung enorm unter der größer werdenden Schuldenlast litt. So blieben z.B. Investitionen in Bildungseinrichtungen und Inf- rastruktur aus, was sich auf die soziale Situation in manchen Ländern verheerend auswirkte: Bis heute liegt in großen Teilen der Dritten Welt die Analphabetenquo- te über 80%, das Straßennetz befindet sich in einem desolaten Zustand und die Versorgung mit Medikamenten ist nicht ausreichend. Viele Entwicklungsländer nutzten ihre Chance nicht oder nur ansatzweise, die bestehenden strukturellen Mängel mit Hilfe der Entwicklungshilfe-Kredite zu beseitigen bzw. ihre Lage grundlegend zu verbessern.
2.1.2 Externe Ursachen
Die Verschuldungskrise hatte nicht nur interne Ursachen: auch im weltwirtschaftlichen Zusammenhang vollzog sich für die Entwicklungsländer vor allem in den 1970er Jahren eine ungünstige Entwicklung.
So wirkte sich die erste Ölkrise von 1973/74 für die ölimportierenden Entwick- lungsländer negativ aus. Da der Ölpreis stark anstieg, verteuerten sich folglich auch die Ölimporte, was sich für die diesbezüglich extrem anfälligen Entwick- lungsländer in den verschlechterten Zahlungsbilanzen niederschlug.
Die ölexportierenden Länder (OPEC-Länder) fuhren aufgrund des erhöhten Öl- preises hohe Gewinne ein. Diese Exporterlöse wurden überwiegend bei privaten US-amerikanischen Banken angelegt. Da diese Banken daher über enorm viel Kapital, den sog. „Petrodollar“ verfügen konnten, konnten sie der weiter gestiege- nen Kreditnachfrage der Entwicklungsländer entgegenkommen und diesen zins- günstige Kredite anbieten, was man als „Dollarrecycling“ bezeichnet. Ab Ende der 1970er Jahre verschlechtere sich die Situation drastisch: Durch das Aufeinandertreffen von drei Faktoren wurde die finanzielle Lage der Entwicklungsländer zunehmend schlechter. Zum einen stellte sich 1979/80 eine zweite Ölkrise ein, was die Importe weiter verteuerte, zum anderen sanken die Weltmarktpreise für bestimmte Produkte wie Tee, Reis, Kaffee etc. stark. Des weiteren betrieben die Vereinigten Staaten eine Hochzinspolitik, was eine Verteu- erung der Kapitalimporte zur Folge hatte.
Die weltwirtschaftliche Rezession war für die Entwicklungsländer aber nicht vor- hersehbar, sie hatten auch keine reele Chance, sich den Effekten zu entziehen, da sie aufgrund ihrer strukturellen finanztechnischen Gegebenheiten nicht in der Lage waren, sich davor zu schützen. Da die Industrieländer ihre Märkte weitest- gehend gegen Waren aus den Entwicklungsländern abschirmten, blieb diesen also kaum die Möglichkeit von der Wirtschaftskrise unberührt zu bleiben, weil sie auf die Exportwirtschaft angewiesen sind.
Während der 1980er Jahre wurde der Zusammenbruch des internationalen Finanz- systems befürchtet, da Brasilien und Mexiko 1982 zahlungsunfähig wurden. Be- gründet wurde diese Befürchtung dadurch, dass sich die Schulden größtenteils bei privaten US-amerikanischen Banken auf der Gläubigerseite konzentrierten. Diese hatten sich teils weit über ihr eigenes Vermögen hinaus im für sie lukrativen Ge- schäft des „Dollarrecyclings“ engagiert. Die Mitverantwortung für die Schulden- krise liegt also auch bei den privaten Kreditinstituten. In Folge dessen zogen diese sich umgehend aus dem Kreditgeschäft mit den Entwicklungsländern zurück, was ein Blick auf das Kreditvolumen bestätigt: 1982 betrug es 40 Mrd. US-§, 1984 nur noch 5 Mrd. US-§.
2.2 Die Folgen der Verschuldungskrise und die momentane Lage der Ent-wicklungsländer - eine Erläuterung am Beispiel Mosambiks
Viele Entwicklungsländer stecken in einer sog. „Schuldenfalle“. Auch bei einer radikalen Senkung der Staatsausgaben bestünde keine Chance, die Schulden je- mals zurückzuzahlen. Die Zahlungsrückstände wachsen, da die jeweiligen Staaten oftmals nicht alle anfallenden Zinsen und fast immer nicht die gesamten Tilgun- gen zurückzahlen können. Auf diese Rückstände müssen wiederum Zinsen ge- zahlt werden.
Deutlich wird z.B. das Schuldenvolumen Mosambiks daran, wie lange es seine gesamten Exporterträge aufwenden müsste, um seine bi- und multilateralen Schulden zu begleichen: 12 Jahre lang. Dieses hohe Schuldenaufkommen ist für die Volkswirtschaft nicht tragbar, da notwendige Importe wie Nahrungsmittel oder Medikamente bezahlt werden müssen.
2.2.1 Diepolitische Lage Mosambiks
Seit Beendigung des Bürgerkrieges 1992 und dem Friedensvertrag von Rom ist Mosambik eine Republik. 1999 fanden die zweiten demokratischen Präsidents- und Parlamentswahlen statt, wobei die regierende Partei „Frelimo“ nur knapp die Mehrheit erzielte. Die Oppositionspartei „Renamo“ zweifelte die Wahlergebnisse an und vermutete Wahlbetrug. Sie rief zu Demonstrationen gegen die amtierende Regierung auf, bei denen mehr als 100 Menschen zu Tode kamen. Die politische Lage ist daher als instabil einzustufen. Um sie zu stabilisieren, steht die mosambi- kianische Gesellschaft vor Herausforderungen wie der nationalen Versöhnung, der weiteren Demokratisierung und der Erhaltung des Friedens.
2.2.2 Die wirtschaftliche Lage Mosambiks
Mosambik steht vor der Aufgabe, die Volkswirtschaft zu dynamisieren und Lö- sungen für die Reduzierung der Armut zu finden. Wie wichtig diese Aufgabe ist, zeigt ein UNDP-Bericht zur menschlichen Entwicklung: nach der Klassifizierung von 175 Ländern im Human Development Index nimmt Mosambik den 166. Platz ein, laut Weltbank leben ca. 60 % der Bevölkerung in absoluter Armut. Der Stand der nominalen Schulden betrug 1998 8,208 Milliarden US-Dollar. Mosambik ist aufgrund der Überschwemmungskatastrophe im Frühjahr 2000 vom Schuldendienst befreit. Die Gläubigerstaaten beschlossen ein einjähriges Schul- denmoratorium.
Problematisch dabei ist, das zwar keine Schuldentilgung gezahlt werden muss, die Zinsen wurden aber nicht erlassen und laufen weiter, was eine Vergrößerung der Schuldenlast bedeutet.
Da Mosambik zu den HIPC-Ländern gehört, wird es nach Beschlüssen des Welt- wirtschaftsgipfels 1999 in Köln teilweise entlastet. Der Schuldenerlass (Daten s. Anlage) ist an eine Bedingung geknüpft: Die Regierung Mosambiks ist aufgefor- dert, ein Armutsbekämpfungsprogramm (Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP) auszuarbeiten, mit dem nachgewiesen werden soll, dass die durch den Schuldenerlass eingesparten Finanzen zur Armutsbekämpfung verwendet wird. Weiterhin soll die Verwendung der Finanzmittel erläutert und das Programm in Partizipation mit der Zivilbevölkerung erarbeitet werden. Ein Problem dabei ist, wie man den Begriff Partizipation hierbei definiert. Ob die Zivilbevölkerung nur befragt werden soll oder wie man sie in den Prozess mit einbindet, wurde bis dato noch nicht geklärt. Bis jetzt wurde das PRSP im Auftrag der mosambikanischen Regierung lediglich von internationalen Experten erarbeitet. Verbände wie Ge- werkschaften oder Initiativen wurden bisher nicht mit einbezogen. Bisher beschlossen wurde nur ein vorläufiges Armutsbekämpfungsprogramm, das sog. Interims-PRSP. Hierin werden grobe Ziele formuliert, verschiedene Armuts- bereiche beschrieben und ein Zeitplan für die Ausarbeitung des vollständigen Programmes, des Full-PRSP, vorgelegt. Mosambik wurde von den Gläubigerstaa- ten keine zeitliche Grenze zur Vorlegung des PRSP gesetzt, es wird jedoch erwar- tet, dass dies Ende März 2001 geschieht. Begründet ist diese Erwartung darin, dass im Mai 2001 das einjährige Schuldenmoratorium abläuft und der Schulden- dienst wieder aufgenommen werden muss, die Regierung Mosambik steht daher unter Handlungszwang.
3. Lösungsstrategie von„Erlaßjahr 2000“
3.1 Grundannahmen
Erlaßjahr 2000 geht von folgenden Grundannahmen1 aus:
1. Überschuldung von Personen und Ländern bedroht nicht nur die wirtschaftli- che und soziale Entwicklung der Betroffenen, sondern die der ganzen Gesell- schaft.
2. Alle bisherigen Versuche der Lösung der Schuldenkrise sind gescheitert. Die Schulden waren und sind für viele Staaten zu hoch und können nur durch einen drastische Reduktion auf ein tragfähiges Niveau gesenkt werden.
3. Die Verantwortung für die Schuldenkrise liegt nicht nur bei den Schuldnern, sondern bei den Schuldnern und den Gläubigern. Deshalb müssen beide Seiten entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit dazu beitragen, dass ein Ausweg aus der Schuldenkrise geschaffen wird.
4. Eine dauerhafte Lösung muss auf international verbindliche Vereinbarungen aufgebaut werden. Es muss ein Verfahren gefunden werden, wie international im Rahmen eines Insolvenzrechtes für Staaten Regeln für eine bei beiden Sei- ten tragbare Lösung ausgehandelt werden kann.
Auf dieser Basis hat „Erlaßjahr 2000“ folgende Ziele:
1. einen weitreichenden Schuldenerlass für die armen Länder der Erde im Jahr 2000,
2. die völkerrechtlich verbindliche Beugestaltung internationaler Finanzbezie- hungen im Sinne eines fairen Interessenausgleichs zwischen Schuldnern und Gläubigern („Internationales Insolvenzrecht“)
3.2 Modell eines Internationalen Insolvenzrechtes
Ein internationales Insolvenzrecht ist kein Novum, das „Erlaßjahr 2000“ zuerst forderte, sondern schon früh nach Ausbruch der Schuldenkrise gab es erste Vorschläge dazu.1984 schlug der britische Bankier David Suratgar einen Vergleich von Staaten nach dem Vorbild des Vergleiches von Firmen vor. Aufgrund juristischer Bedingungen konnte dieser Vorschlag nicht verwirklicht werden. Von den Gläubiger gab es Einwände, dass ein dem Firmenvergleich nachgebildetes Verfahren wegen der staatlichen Souveränität nicht rechtmäßig sei.
Die von „Erlaßjahr 2000“ angestrebte Variante basiert nicht auf der eines internationalisierten Firmenvergleiches, sondern auf den Grundlagen des US- amerikanischen „Chapter 9“.
In den Vereinigten Staaten können Schuldner mit einer Hoheitsgewalt, sog. „Municipalities“ wie z.B. Gemeinden oder Verwaltungsbezirke, Vergleich anmelden, wenn sie zahlungsunfähig sind. Dann findet ein Insolvenzverfahren statt, bei dem die Gläubiger Schulden nur im Rahmen des Vergleichs anmelden können. Das Verfahren muss transparent und fair sein, weder die Gläubigerseite noch die Schuldnerseite darf bevorzugt werden.
Bei der Festlegung der Vergleichsquote müssen folgende Aspekte auf der Schuld- nerseite berücksichtigt werden: Sowohl die Möglichkeit, Steuern und Abgaben zu erheben werden betrachtet als auch die Einnahmen und Ausgaben. Verboten ist es dem Gericht, auf steuerliche, hoheitliche und politische Dinge des Schuldners Einfluss zu nehmen. Auch der Gläubiger darf hier nicht intervenieren, damit die Souveränität des Schuldners geschützt wird.
Des weiteren wird der betroffenen Bevölkerung und den Beamten ein Anhörungsrecht eingeräumt, d.h. sie dürfen am Verfahren teilnehmen und Lösungsvorschläge miterarbeiten.
Überträgt man dieses Modell auf ein internationales Verfahren, so ergeben sich folgende momentane Defizite:
Die Rechtsstaatlichkeit des Modells ist nicht gewährt. Grundsatz dieser ist es, das niemand Richter in eigener Sache sein darf, es muss immer einen Unabhängigen geben, der diese Rolle einnimmt.
IWF und Weltbank verwalten gleichzeitig die Schulden der Entwicklungsländer und entscheiden über einen Schuldenerlass für diese. Sie sind daher befangen und nicht als objektive Regulatoren einzustufen. Aus der Rolle der o.g. internationalen Finanzinstitutionen ergibt sich ein schwerwiegender Nachteil für die Schuldner, da diese keinen Einfluss auf Entscheidungen haben, die sie betreffen. Auch für nicht-öffentliche Gläubiger wie Banken ergibt sich ein Nachteil, da IWF die eige- nen Schuldenrückzahlungen gegenüber den anderen bevorzugen könnte. Für die Errichtung eines Internationalen Insolvenzrechtes ist deshalb die Einrich- tung eines unabhängigen Schiedsgerichtes erforderlich. Hierbei muss die Gläubi- gerseite und die Schuldnerseite die gleiche Anzahl von Sitzen erhalten, um Objek- tivität zu gewähren. Vereinbarungen zwischen den Parteien werden durch die Bes- tätigung des Gerichts rechtskräftig.
Für den Verlauf des Verfahrens ist die genaue Schuldenfeststellung wichtig, es müssen alle Ansprüche angemeldet und verifiziert werden.
Des weiteren müssen Maßnahmen gegen die Kapitalflucht ergriffen werden. In die Veruntreuung des Kapitals während oder nach der Kreditvergabe muss dazu Transparenz gebracht werden. Alle sozialisierten Schulden, d.h. Schulden, die von Privatleuten veruntreut wurden, müssen aufgrund der Gerechtigkeit gegenüber dem Schuldner erlassen werden, bzw. „reprivatisiert“ werden, d.h. die entspre- chenden Personen müssen dieses Kapital an die Gläubiger zahlen.
Die Vergleichsquote sollte an die Wirtschaft des entsprechenden Landes unter Berücksichtigung des Verhältnisses Schuldendienst/Exporterlöse angepasst wer- den.
Weiterhin muss sich ein Ausgleich zwischen den Zahlungen der Schuldnerstaaten und dem Protektionismus der Gläubigerstaaten vollziehen, d.h. je weniger Möglichkeiten einem Staat gegeben werden, Devisen zu verdienen, desto größer muss der Schuldenerlass für den Staat sein.
3.3 Folgen des angestrebten Internationalen Insolvenzrechts für Mosambik
Würde das Internationale Insolvenzrecht und somit eine Reform des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, auf dem nächsten Weltwirtschaftsgipfel beschlossen und daraufhin in Kraft treten, so hätte das große Auswirkungen auf die finanzielle Situation Mosambiks.
Die Chance, das Land aus der Verschuldungskrise zu führen, stiegen deutlich, da die Konditionen für den Schuldenabbau verbessert sind.
Zwar gibt es bis jetzt schon einen Schuldenerlass für Mosambik und das prioritäre Ziel der Regierung gilt der Armutsbekämpfung, jedoch würden diese Verbesse- rungen durch ein neues Insolvenzrecht auf eine andere Grundlage gestellt. Der Entschuldungsprozess hätte als Basis ein gerechtes und transparentes Schiedsver- fahren. Dieses wäre mit den o.g. Bedingungen verknüpft, z.B. dem Verbot der Intervention der Gläubiger und Unparteiischen in Hoheitsrechte. Mosambik würde also von den Schulden erlassen, eine Forderung der Gläubiger nach einem Armutsbekämpfungsprogramm im Gegenzug wäre dann aber nicht mehr rechtmäßig.
So wäre die mosambikanische Regierung von dem Druck befreit, in nur kurzer Zeit ein PRSP zu erstellen. Um ein ausgereiftes PRSP zu erstellen, ist eine einjäh- rige Frist nicht zu bewältigen, da die Inhalte über längere Zeit erarbeitet und abge- stimmt sein müssen und so das Programm erfolgreich sein kann. Vor allem durch die veränderte Rolle der Weltbank und des IWF, die nur noch als Gläubigerpartei und nicht mehr auch gleichzeitig als Richter aufträte, würde sich die Situation Mosambiks verändern. So könnten diese Institutionen ihre Forde- rungen nicht mehr ohne Prüfung einer dritten Instanz an das Land stellen, sondern sie würden im gegenseitigen Einvernehmen mit der mosambikanischen Regierung getroffen. Das hieße, dass Mosambik von der Bevormundung seiner Gläubiger befreit würde, was gegenüber der tatsächlichen aktuellen Situation ein Novum darstellen würde.
4. Wertung der Lösungsstrategie
Der von „Erlassjahr 2000“ geforderte Schuldenerlass und das angestrebte Interna- tionale Insolvenzrecht wird aufgrund weitersteigender Schulden der Entwick- lungsländer notwendiger denn je. Vor allem die dramatische humanitäre Lage der 3.Welt verschlechtert sich weiterhin, falls sich deren finanzielle Lage nicht ver- bessert.
Dabei muss man in Betracht ziehen, das solch ein Erlass für die öffentlichen und privaten Gläubiger durchaus umsetzbar wäre, die Staatsbudgets der Gläubigerstaaten würde nicht merklich strapaziert und privaten Banken haben die Kreditsummen längst von den Steuern abgeschrieben. Deutlich wird dies am Beispiel Deutschland: würde sie auf die Rückzahlungen der HIPC verzichten, betrügen die jährlichen Einnahmeverluste für die BRD ca. 500 Mio. DM, was 0,1% des Bundeshaushalts ausmacht.
Die Einrichtung eines Insolvenzrechtes auf internationaler Ebene ist ebenfalls juristisch durchführbar als auch ökonomisch sinnvoll, vor allem aber in menschlicher Hinsicht eine notwendige und sinnvolle Lösung.
Die G8-Staaten zeigten bereits ihre Bereitschaft, den HIPC die Schulden zu erlassen, die Einrichtung eines Insolvenzrechtes wurde dagegen weder auf einem Weltwirtschaftsgipfel angesprochen noch beschlossen. Die Industrieländer beharren also weiterhin auf dem veralteten internationalen Finanzsystem, obwohl Neuerungen dringend notwendig erscheinen.
Problematisch ist hierbei die Rolle der G8-Staaten: Sie sind die jeweiligen Staaten, die von der Schuldenkrise profitieren, und nur sie können durch Reformen genau diese beenden, was nicht in ihrem Interesse liegt.
Eine schnelle Lösung, die wirklich sinnvoll für alle Beteiligten ist, scheint daher ohne die Initiative unbeteiligter Dritter nicht in Sicht. Aufgrund dessen kann nur der Druck der Öffentlichkeit auf die Regierungen in den westlichen Ländern ein Weiterkommen in der Schuldenkrise bewirken.
Des weiteren muss man erkennen, das eine Entschuldung eine notwendige, nicht aber eine hinreichende Bedingung für Entwicklung ist. Ohne Entschuldung fehlen hingegen die Voraussetzungen für eine gesunde wirtschaftliche und soziale Ent- wicklung.
„Erlaßjahr 2000“ halte ich aus diesen Gründen für eine humanitär enorm wichtige Kampagne.
Literaturverzeichnis
Dritte Welt Haus Bielefeld, Insolvenzverfahren: Ein fairer Ausgleich, in: Armutsfalle Verschuldung, Bielefeld 1999,S.24
Dritte Welt Haus Bielefeld, Armutsfalle Verschuldung, in: Armutsfalle Verschuldung, Bielefeld 1999, S. 7ff
Hütz-Adams, Friedel, Die Grundannahmen von „Erlassjahr 2000“, www.erlassjahr2000.de ,2000
Hütz-Adams, Friedel, Mosambik im Entschuldungsprozess, www.erlassjahr2000.de ,2000
Nohlen, Dieter, Verschuldung, in: Dritte Welt Lexikon, Reinbek 1993, S.712ff
Raffer, Kunibert, Modell eines Internationalen Insolvenzrechtes, www.jubilee2000uk.org ,2000
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Facharbeit im Leistungskurs Sozialwissenschaften?
Die Facharbeit behandelt die Frage, ob die Forderung der Kampagne "Erlassjahr 2000" nach einem Internationalen Insolvenzrecht die wirtschaftliche Lage der Entwicklungsländer grundlegend verbessern kann. Untersucht wird dies am Beispiel Mosambiks.
Was ist "Erlassjahr 2000"? Welche Ziele verfolgt die Kampagne?
"Erlassjahr 2000" ist eine internationale Kampagne, die einen umfassenden Schuldenerlass für Entwicklungsländer fordert sowie die Schaffung eines Internationalen Insolvenzrechts. Die Kampagne wurde Ende 1997 in Wuppertal gegründet.
Wie ist "Erlassjahr 2000" organisiert?
Das höchste Entscheidungsgremium ist der Kampagnenrat mit 17 gewählten Mitgliedern. Dieser steht in Verbindung mit dem Kampagnenbüro, das bundesweite Aktionen plant. Zudem gibt es Regionalkoordinatoren.
Welche Ursachen hat die Verschuldungskrise der Entwicklungsländer?
Es werden interne und externe Ursachen unterschieden. Interne Ursachen umfassen z.B. Industrialisierungsbemühungen ohne inländischen Bankensektor, unökonomische Haushalts- und Finanzpolitik, Korruption und Kapitalflucht. Externe Ursachen sind beispielsweise die Ölkrise, sinkende Weltmarktpreise für Rohstoffe und die Hochzinspolitik der USA.
Welche internen Ursachen werden für die Verschuldung der Entwicklungsländer genannt?
Zu den internen Ursachen gehören: zunehmende Industrialisierungsbemühungen in Entwicklungsländern Ende der 1960er Jahre, das Fehlen eines inländischen Bankensektors, die politische Lage des Landes als Faktor für Kreditvergabe, unökonomische Haushalts- und Finanzpolitik (z.B. Investition in Rüstungsgüter statt produktive Anlagen), und eine überdurchschnittlich hohe Kapitalflucht.
Welche externen Ursachen werden für die Verschuldung der Entwicklungsländer genannt?
Zu den externen Ursachen gehören: die Ölkrise von 1973/74, die die Ölimporte verteuerte, steigende Gewinne der OPEC-Länder, die bei US-Banken angelegt wurden (Petrodollar-Recycling), eine zweite Ölkrise 1979/80, sinkende Weltmarktpreise für Rohstoffe und die Hochzinspolitik der USA.
Welche Folgen hat die Verschuldungskrise für die Entwicklungsländer?
Viele Länder stecken in einer "Schuldenfalle", in der sie selbst bei drastischen Ausgabenkürzungen ihre Schulden nicht zurückzahlen können. Dies führt zu Zahlungsrückständen und weiteren Zinszahlungen. Als Beispiel wird die Situation Mosambiks erläutert, das seine gesamten Exporterlöse 12 Jahre lang aufwenden müsste, um seine Schulden zu begleichen.
Wie ist die politische und wirtschaftliche Lage in Mosambik?
Politisch ist Mosambik seit dem Friedensvertrag von 1992 eine Republik, jedoch ist die politische Lage instabil. Wirtschaftlich steht Mosambik vor der Aufgabe, die Volkswirtschaft zu dynamisieren und die Armut zu reduzieren. Laut Weltbank leben etwa 60 % der Bevölkerung in absoluter Armut.
Welche Lösungsstrategie verfolgt "Erlassjahr 2000"?
"Erlassjahr 2000" fordert einen weitreichenden Schuldenerlass für arme Länder und die völkerrechtlich verbindliche Beugestaltung internationaler Finanzbeziehungen im Sinne eines fairen Interessenausgleichs zwischen Schuldnern und Gläubigern ("Internationales Insolvenzrecht").
Wie sieht das Modell eines Internationalen Insolvenzrechts von "Erlassjahr 2000" aus?
Das Modell basiert auf dem US-amerikanischen "Chapter 9", bei dem Gemeinden bei Zahlungsunfähigkeit einen Vergleich anmelden können. Das Verfahren muss transparent und fair sein. Auf internationaler Ebene wird ein unabhängiges Schiedsgericht gefordert, in dem Gläubiger und Schuldner gleichberechtigt vertreten sind.
Welche Folgen hätte ein Internationales Insolvenzrecht für Mosambik?
Die Chance, das Land aus der Verschuldungskrise zu führen, würde steigen, da die Konditionen für den Schuldenabbau verbessert wären. Der Entschuldungsprozess hätte eine gerechte und transparente Basis. Mosambik wäre von der Bevormundung seiner Gläubiger befreit.
Wie wird die Lösungsstrategie von "Erlassjahr 2000" bewertet?
Der geforderte Schuldenerlass und das Internationale Insolvenzrecht werden als notwendig erachtet, da sich die humanitäre Lage in der Dritten Welt verschlechtert. Die Einrichtung eines Insolvenzrechtes wird als juristisch durchführbar und ökonomisch sinnvoll angesehen. Problematisch ist die Rolle der G8-Staaten, die von der Schuldenkrise profitieren.
- Quote paper
- Marco Scheil (Author), 2001, Erlaßjahr 2000 - Chance für einen Neuanfang der Dritten Welt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103851