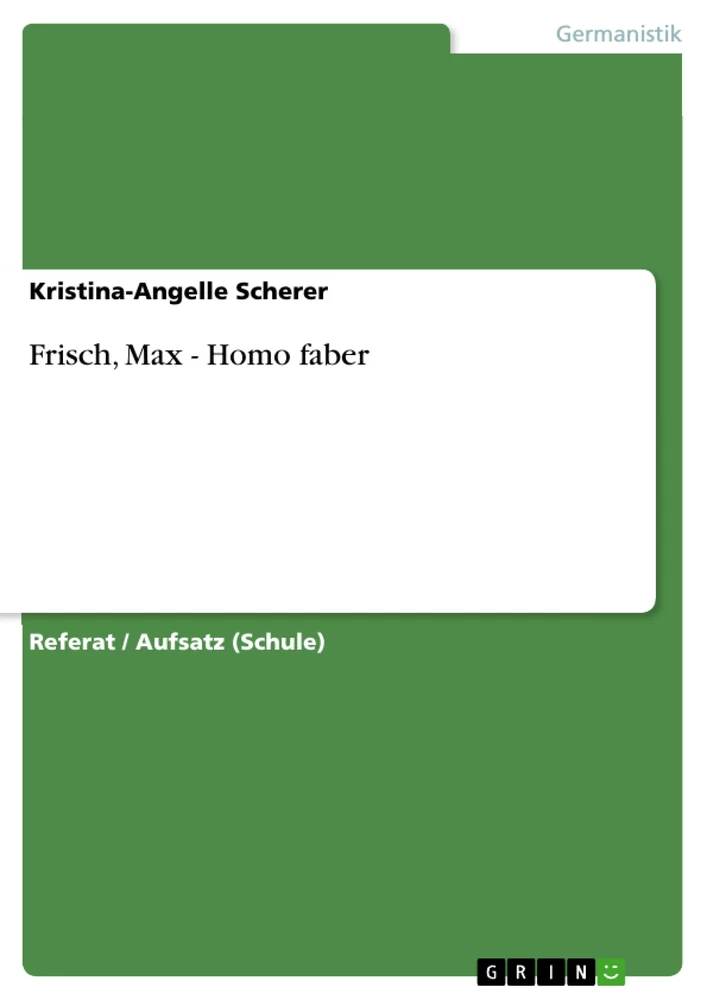Homo faber
Vom menschenfremden Technokraten zum sensiblen Entdecker
Aufgabenstellung: Erörtern Sie das Verhältnis des „Homo faber“ zu seiner Umwelt und zu sich
Cuba-Episode. Roman abrät.
selbst sowie die allmähliche Veränderung bis einschließlich der Erkären sie anhand von Beispielen, wovon Max Frisch in seinem
Max Frischs Roman „Homo faber“ ist eines der berühmtesten und wichtigsten Bücher der modernen deutschen Literatur. Wahrscheinlich verarbeitet der Autor in diesem Werk persönliche Erfahrungen, da sein Lebenslauf stellenweise an den der Hauptfigur erinnert. Es handelt von einem Ingenieur, der durch ein falsches Selbstbildnis an einem überaus rationalem Weltbild festhält, bis dieses durch eine Liebesbeziehung mit dramatischen Folgen zerbricht. Der Titel „Homo faber“ („Der Mensch als Ingenieur“) ist eine Rollenbezeichnung. Walter Faber hält sich für einen „Homo faber“ und fühlt sich mit dem Konzept dieser Rolle anfangs erfüllt, bis er zu seiner eigentlichen Identität, seinem wirklichen Denken und Fühlen, gelangt. Bevor dies geschieht, besitzt er neben vielen zu kritisierenden Verhaltensweisen auch ein recht reduziertes Bild von seinen Mitmenschen, welches in dieser literarischen Erörterung ausführlich untersucht werden soll.
Zu Beginn des Buches „Homo faber“ wird der Leser in die Konfliktproblematik von Technik und Natur eingeführt. Als Techniker möchte Walter Faber die Natur als Umwelt, aber auch die eigene Natur beherrschen. Er fühlt sich ständig dazu gezwungen, sich zu rasieren. Dieser Vorgang bedeutet für ihn die Abwehr von Natur am eigenen Körper mit Hilfe der Technik. Außerdem besitzt er den Drang, immer zu fotografieren bzw. zu filmen. Dieses Bedürfnis macht seine Eigenschaft, sich von seinem Umfeld und besonders anderen Menschen Bildnisse anzufertigen, deutlich. Der Schweizer wünscht sich ein menschliches Leben, welches bis in jegliche Einzelheit durchkonstruiert ist. Dieses Ideal und Vorbild findet Faber in der Maschine und speziell im Roboter. Ihm schreibt er die Fähigkeiten zu, die er auch für sich selbst wünscht: Freiheit von Angst, Gefühlen, Irrtümern, Erlebnissen und unerklärbaren Dingen. Der Naturwissenschaftler hat einen Ekel vor der Natur und Natürlichkeiten, wie sie in Wüste und Dschungel vorkommen und wenn man sich seine Verhaltensweisen noch deutlicher macht, sogar eine krankhafte Beziehung zum Leben. Dinge wie Kunst, Kultur, Mystik und Literatur lehnt er wegen ihrer
„Unwirklichkeit“ und Nutzlosigkeit ab („Die Primitiven versuchten den Tod zu annullieren, indem sie den Menschenleib abbilden - wir indem wir den Menschenleib ersetzen. Technik statt Mystik!“, vgl. Seite 77). Als Ausdruck seines technischen Weltbildes sind die Gegenstände zu bezeichnen, die er immer mit sich führt und welche fast zu seinem Wesen gehören: Schachspiel, Kamera, Schreibmaschine und Rasierapparat. Es sind Symbole technischer Macht, die es ihm ermöglichen, die Vorgänge des Lebens und der Natur von sich fernzuhalten. Besonders belastend sind für ihn dabei Beziehungen zu anderen Menschen. Der Ich-Erzähler ist ein Einzelgänger. Er fühlt sich anfangs nur wohl, wenn er sich ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Andere Menschen versteht er nicht und findet sie nervend („Menschen sind komisch!“, Seite 43). Faber lebt in seiner Arbeit sowie in Statistiken und ist am liebsten alleine. Er vermeidet jede Form von Kontakten, seien es Freundschaften, Liebesbeziehungen oder einfach nur Gespräche. Als er Herbert Hencke, den Bruder seines Jugendfreundes Joachim Hencke, im Flugzeug kennenlernt und dieser Konversation mit ihm führen möchte, reagiert der Ingenieur sehr ablehnend. Einmal flüchtet er regelrecht vor ihm, um sich zu rasieren. Bei der anschließenden Notlandung in der Wüste von Taumaulipas weicht er dem Kontakt mit dem jungen Hencke durch Schachspiele aus. Als sich herausstellt, dass Herbert der jüngere Bruder von Joachim ist, fühlt sich Faber an seine Vergangenheit erinnert. Nach einer Weile fängt er an sich zu erkundigen, was denn derzeit mit Joachim sei. Faber erfährt von Hanna, seiner Jugendliebe und möchte mehr über ihr momentanes Leben herausbekommen. In den rational denkenden Mann zeigen sich plötzlich subjektive Züge. Seit der Beziehung zu Hanna erlebt er Liebe nur noch als momentanes Ereignis. Faber hat Bindungsangst, da er weibliche Verhaltensweisen wie Anlehnungsbed ürftigkeit auf Grund der fehlenden Sachlichkeit nicht ertragen kann. Auf einer Schiffsreise lernt er Sabeth, eine 20 jährige Kunststudentin, kennen, die ihn an Hanna erinnert. Durch Gespräche mit ihr erfährt der 50 jährige, dass Sabeths Mutter Hanna heißt. Doch nicht nur das, es kommen auch andere Parallelen zwischen dieser Hanna und seiner Jugendliebe Hanna zum Vorschein, die Faber jedoch nicht wahrhaben möchte und verdrängt. Als er sich immer mehr in das Mädchen verliebt und sogar eifersüchtig wird („Was mich aufregt, sind keineswegs seine blöden Witze über die Ingenieure, sondern seine Flirterei mit dem jungen Mädchen (...)“., Seite 77), steigert er sich in Statistiken und Mathematik. Auf diese beruft er sich auch später, um sich von aller Schuld am Vater/Tochter-Inzest freizusprechen. Doch in der Realität trägt er Schuld daran. Die Folgen seines Bestrebens, sich von allen Menschen Bildnisse anzufertigen, sind groß. Er übersieht die Schlange als wirkliche Gefahr für seine Tochter, weil er sich nur das momentan sichtbare wahrnimmt. Aus diesem Grunde führt er auch ein reduziertes Leben; Spaß und Genuss bedeuten nichts für ihn. Das Kuriose dabei ist nicht einmal diese Tatsache, sondern dass dieses Ergebnis aus dem Bildnis erfolgt, welches er von sich selbst angefertigt hat. Als ein auf Tatsachen konzentrierter, rationalistischer Technokrat sieht er sich, der keine Emotionen und irrationale Geschehnisse erleben möchte. Doch sein wahres Ich empfindet anders. Am besten lässt sich dies an den Stilmitteln erkennen. Neben ihnen existieren auch viele Symbole und Leitmotive in dem Roman, die zur Interpretation beitragen. Wenn Fabers Unterbewusstsein ebenfalls bloß rationalistisch eingestellt wäre, würde er keine Vergleiche benutzen, um etwas besser zu beschreiben (Man kam sich wie ein Blinder vor“, vgl. Seite 7). Wenn der Mann etwas nicht genau weiß, benutzt er ebenfalls Stilmittel. Er weicht auf unpersönliche Formen wie „man“ oder den Plural aus. Und seine Verfassung drückt er mit Leitwörtern aus, welche zu Leitmotiven werden: „üblich“ und „nervös“. Ersteres verwendet er, wenn sich Dinge in „unüblicher“ Weise entwickeln, wie bei der Startverzögerung in New York. Diesem Wort entspricht „nervös“. Es taucht immer dann auf, wenn der „übliche“ Ablauf gestört wird, wie wenn sein Rasierapparat versagt. Der Gebrauch dieser Leitworte lässt erkennen, dass Faber jede Erschütterung seines Weltbildes unsicher macht und er diese Verunsicherung durch Betonung des Zwanghaften ausgleichen möchte, wie zum Beispiel durch ständiges Rasieren. In der ersten Station sind die Worte „üblich“ und „nervös“ äußerst oft zu finden, in der zweiten Station hingegen werden sie durch noch mehr Vergleiche ersetzt. Im Laufe der zweiten Station wandelt sich sogar das Erzählende Ich in ein Erlebendes Ich um. Unter den Einflüssen von Sabeth verwendet Faber immer mehr seine Fantasie, wie beim Metaphernspiel vom Vergleichen der Landschaften festzustellen ist. Das Mädchen öffnet neue Horizonte in ihm und er lässt sich diese Veränderungen wegen seiner Liebe zu ihr gefallen. Durch Sabeths Tod zerbricht das technokratische Weltbild Fabers langsam, welches er krampfhaft versuchte aufrechtzuerhalten. Die Aufgabe seines Selbstbildnisses führt mehr und mehr zu der wahren Identität und Lebenslust des Ingenieurs. In Cuba entschließt er sich zur Neuorientierung, die als ein neues Leben zu bezeichnen ist, an dem er „hängt wie noch nie“. Habana steht für den Höhepunkt dieses neuen Lebens. Der Leser erkennt neue, ungewohnte Verhaltensweisen des Hauptcharakters zu sich selbst und seiner Umgebung. Was vorher bedeutungslos für ihn erschien, erfüllt ihn nun („Vier Tage nichts als schauen“, 172). In diesen Tagen gibt er sich ganz bewusst und intensiv den Abläufen der Stadt hin. Er fängt sogar an zu singen
(„Ich singe . Ich kann ja nicht singen, aber niemand hört mich (...)“, Seite 181). Aus dem einstigen Schwarzseher („Was ich sehe, das sind Agaven, eine Pflanze, die ein einziges Mal blüht und dann abstirbt.“, 24) wird nun ein lebensfroher Optimist. Mit dem Mädchen Juana redet er zum ersten Mal über den Tod seiner Tochter und Geliebten und fragt sie, ob sie an Todsünde glaube. Faber denkt das erste Mal über einen eventuellen mythologischen Zusammenhang mit der Schlage (steht für Sünde, nach Sigmund Freud Symbol für Vater/Tochter-Inzest) und Sabeths Tod nach. Selbst mit dem Filmen und Foto- grafieren hört er auf; er muss sich keine Bildnisse mehr machen. Er empfindet sich nicht mehr als Beherrscher der Natur, sondern als eine erlebende Einheit mit ihr. Der 50 jährige Mann spricht plötzlich Menschen an und verspürt Begehren nach ihnen, was sehr deutlich daran zu erkennen ist, als er sich nackt auf sein Hotelbett legt und wünscht, das Zimmermädchen werde eintreten.
Wie auch bei „Biedermann und die Brandstifter“ und „Andorra“ rät Max Frisch bei „Homo faber“ der Anfertigung von Bildnissen ab. „Biedermann“ steht wie „Homo faber“ für eine Rollenbezeichnung, welche die Hauptfigur(en) spielen möchte(n) und somit keine eigene Identität besitzen , sondern eingeschränkt und etwas naiv die Rolle (Selbstbildnis) verfolgen bzw. spielen. In allen drei Werken führt die Bildnistheorie zum Tod mindestens einer Person und hat dramatische Folgen. Folglich wäre Sabeth noch am Leben, wenn sie „auf dieser Reise nicht gerade ihrem Vater begegnet wäre, der alles zerstört hat. Walter Faber wäre ohne Selbstbildnis und Rollenklischee wahrscheinlich von Anfang an ein besserer Mensch gewesen, der Emotionen entwickelt hätte. Durch die Inzest- und Mythologiethematiken spielt Max Frisch vermutlich auf das Drama „König Ödipus“ an, welches auf Grund des „Abnormalen“ auch sehr kritisch ausgelegt werden kann.
Häufig gestellte Fragen zu "Homo faber"
Worum geht es in Max Frischs "Homo faber"?
Der Roman "Homo faber" handelt von Walter Faber, einem Ingenieur, der ein sehr rationales Weltbild hat und sich als "Homo faber" sieht. Durch eine Liebesbeziehung mit dramatischen Folgen zerbricht dieses Selbstbildnis jedoch allmählich, und er gelangt zu seiner wahren Identität.
Was kritisiert Max Frisch in "Homo faber"?
Frisch kritisiert die Reduzierung des Menschen auf seine technische Funktion und die Verdrängung von Gefühlen und Irrationalität. Er warnt vor den Folgen eines übermäßig rationalen Weltbildes, das zu Entfremdung von der Umwelt und von sich selbst führen kann.
Welche Rolle spielt die Technik in "Homo faber"?
Die Technik ist für Walter Faber ein Mittel zur Kontrolle der Natur und zur Abwehr von Unwägbarkeiten. Er idealisiert Maschinen und Roboter, da er sich von ihnen Freiheit von Angst, Gefühlen und Irrtümern erhofft. Allerdings führt diese Fixierung auf die Technik zu einer Entfremdung von seiner eigenen Menschlichkeit.
Was sind die zentralen Konflikte im Roman?
Zu den zentralen Konflikten gehören das Verhältnis von Technik und Natur, Rationalität und Emotionalität, Kontrolle und Hingabe sowie das Selbstbild und die wahre Identität des Protagonisten.
Wer ist Sabeth und welche Bedeutung hat sie für Faber?
Sabeth ist eine junge Kunststudentin, in die sich Faber verliebt. Sie erinnert ihn an seine Jugendliebe Hanna. Durch Sabeth und ihren Tod wird Fabers technokratisches Weltbild erschüttert, und er beginnt, sich für andere Perspektiven und Emotionen zu öffnen.
Welche Rolle spielt die Kuba-Episode im Roman?
Die Kuba-Episode steht für Fabers Neuorientierung und den Beginn eines neuen Lebens. In Havanna erlebt er die Welt bewusster und intensiver, lernt neue Verhaltensweisen kennen und entwickelt eine Lebensfreude, die er zuvor nicht kannte.
Was sind die wichtigsten Symbole und Leitmotive in "Homo faber"?
Zu den wichtigsten Symbolen gehören Fabers technische Gegenstände wie Kamera, Schreibmaschine und Rasierapparat, die für seine Kontrolle und Abwehr von Unwägbarkeiten stehen. Leitmotive sind die Wörter "üblich" und "nervös", die Fabers Unsicherheit angesichts von Erschütterungen seines Weltbildes anzeigen.
Inwiefern warnt Max Frisch vor der Anfertigung von Bildnissen?
Wie auch in anderen Werken rät Frisch davon ab, sich falsche Bilder von der Realität zu machen. Er warnt vor starren Rollenbildern, die dazu führen können, dass man die Realität nicht mehr wahrnimmt und falsche Entscheidungen trifft. Im Falle von "Homo faber" führt das Bildnis zum Tod einer Person.
Welche Bezüge zur griechischen Tragödie "König Ödipus" lassen sich in "Homo faber" finden?
Durch die Inzest- und Mythologiethematiken spielt Max Frisch vermutlich auf das Drama „König Ödipus“ an, welches auf Grund des „Abnormalen“ auch sehr kritisch ausgelegt werden kann. Beide Werke thematisieren eine tragische Verstrickung und die Folgen von Unwissenheit und Verblendung.
- Arbeit zitieren
- Kristina-Angelle Scherer (Autor:in), 2001, Frisch, Max - Homo faber, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103712