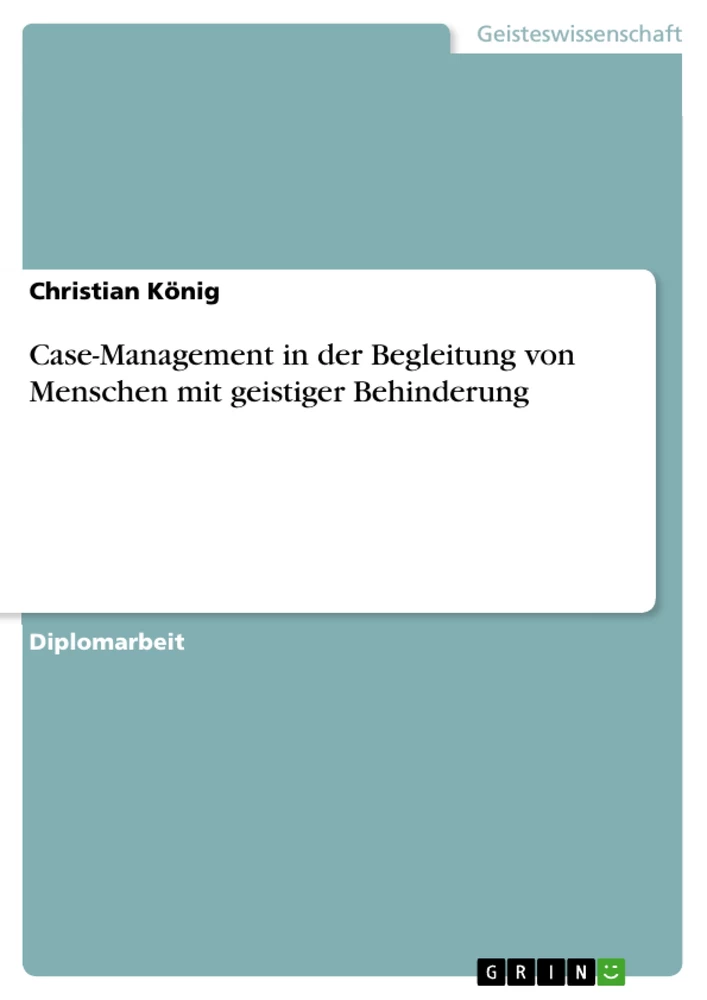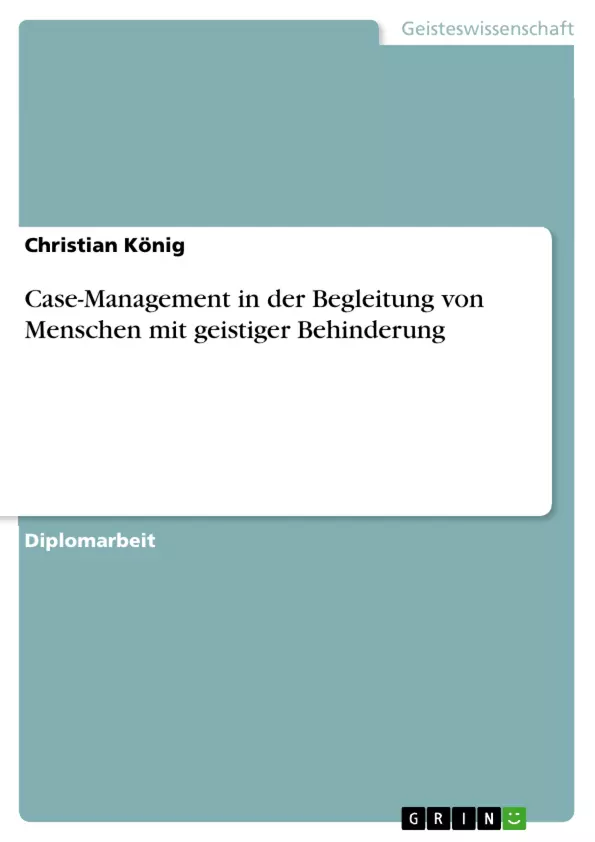Case Management ist eine relativ neue Methode sozialen Handelns. Erst seit kurzem wird diese Methode in Deutschland durch Modellprojekte praktisch umgesetzt und den verschiedenen Zielgruppen in der pädagogischen Arbeit angepasst. Bei Menschen mit geistiger Behinderung gibt es noch keine praktischen Erfahrungen, die mir zum Zeitpunkt dieser Diplomarbeit bekannt sind. Durch den Mangel an entsprechender Literatur und den Mangel an Erfahrung speziell zu dieser Problemstellung stellt diese Diplomarbeit das Bemühen dar, die Erkenntnisse aus anderen Case Management-Modellen auf die Gruppe der Menschen mit geistiger Behinderung zu übertragen. Das in dieser Arbeit erwähnte Modellprojekt Unterstützter Ruhestand für Menschen mit Behinderung des Landesverbandes NRW für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V., das wissenschaftlich durch die Universität Münster begleitet wird, befindet sich derzeitig noch in der Anfangsphase. Daher können und sollen hier noch keine konkreten Ergebnisse veröffentlicht werden.
Neben der fachlichen Ausbildung im Studium sind in diese Arbeit noch meine praktischen Erfahrungen in der Schwimmausbildung von Kindern und jungen Erwachsenen mit geistiger Behinderung eingeflossen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG
- Der Terminus „Behinderung“
- Geistige Störung
- Das Phänomen Geistige Behinderung
- Der medizinische Aspekt
- Der psychologische Aspekt
- Der pädagogische Aspekt
- BEDÜRFNISSE ALS ANTRIEB ZUR SELBSTAKTUALISIERUNG
- Grundlagen einer Motivationstheorie
- Befriedigung der physiologischen Bedürfnisse
- Befriedigung der sozialen Bedürfnisse
- Erschwernisse/Barrieren, die in der Behinderung liegen
- Erschwernisse/Barrieren, die im sozialen Umfeld liegen
- Fazit
- CASE MANAGEMENT IN DER SOZIALEN ARBEIT
- Der Terminus,,Case Management“
- Historische Entwicklung des Case Managements
- Das,,deutsche Modell“
- Das Konzept des Case Managements
- Case Management als Organisations- oder Systemkonzept
- Case Management als Handlungsprozess
- Rolle des Case Managers
- Zusammenfassung
- HANDLUNGSMAXIMEN FÜR SOZIALE ARBEIT
- Das humanistische Menschenbild
- Lebensweltorientierung
- Das Normalisierungsprinzip
- Der systemtheoretische Ansatz
- Fazit
- CASE MANAGEMENT UND GEISTIGE BEHINDERUNG
- Einleitung
- Organisatorische und Kontaktaufnahme
- Assessment und geistige Behinderung
- Planung und geistige Behinderung
- Intervention und geistige Behinderung
- Anwaltliches Handeln des Coaches
- Monitoring und geistige Behinderung
- Praktische Möglichkeiten der Kontrolle
- Entscheidungsschwierigkeiten als Folge sozialer Abhängigkeit
- Evaluation und geistige Behinderung
- Der Ablösungsprozess
- Re-Assessment
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Anwendung des Case Management in der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung. Da es in Deutschland noch keine praktischen Erfahrungen mit dieser Methode gibt, zielt diese Arbeit darauf ab, Erkenntnisse aus anderen Case Management-Modellen auf diese Zielgruppe zu übertragen. Die Arbeit analysiert die Besonderheiten der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung im Kontext des Case Management und betrachtet dabei insbesondere die Bedarfsanalyse, die Planung, Intervention und Evaluation des Prozesses.
- Case Management als Ansatz zur Unterstützung von Menschen mit geistiger Behinderung
- Bedürfnisse und spezifische Herausforderungen von Menschen mit geistiger Behinderung
- Anpassung des Case Management-Konzepts an die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe
- Rolle des Case Managers in der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung
- Ethische und praktische Aspekte des Case Management in diesem Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und erläutert den Kontext der Case Management-Methode in der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Terminus "Behinderung" und dem Phänomen der geistigen Behinderung. Es werden die medizinischen, psychologischen und pädagogischen Aspekte der geistigen Behinderung beleuchtet. Das dritte Kapitel analysiert die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung als Antrieb zur Selbstaktualisierung und betrachtet die erschwerenden Faktoren, die sowohl in der Behinderung selbst als auch im sozialen Umfeld liegen.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Case Management in der sozialen Arbeit, erläutert den Terminus, seine historische Entwicklung und das deutsche Modell. Es werden verschiedene Konzepte des Case Management, die Rolle des Case Managers und die Handlungsprozesse näher betrachtet. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den Handlungsmaximen für soziale Arbeit, darunter das humanistische Menschenbild, die Lebensweltorientierung, das Normalisierungsprinzip und der systemtheoretische Ansatz.
Das sechste Kapitel beleuchtet die Anwendung des Case Management auf Menschen mit geistiger Behinderung. Es analysiert die organisatorischen und kontaktierenden Aspekte, die Durchführung von Assessments, die Planung und Intervention in diesem Kontext sowie die Rolle des Case Managers als Anwalt. Schließlich werden das Monitoring, die Evaluation und der Ablösungsprozess im Rahmen des Case Management betrachtet.
Schlüsselwörter
Case Management, geistige Behinderung, Bedürfnisbefriedigung, Selbstaktualisierung, Motivationstheorie, soziale Arbeit, Handlungsmaximen, humanistisches Menschenbild, Lebensweltorientierung, Normalisierungsprinzip, systemtheoretischer Ansatz, Assessment, Planung, Intervention, Monitoring, Evaluation, Ablösungsprozess, Anwaltliches Handeln.
- Arbeit zitieren
- Christian König (Autor:in), 2002, Case-Management in der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/10350