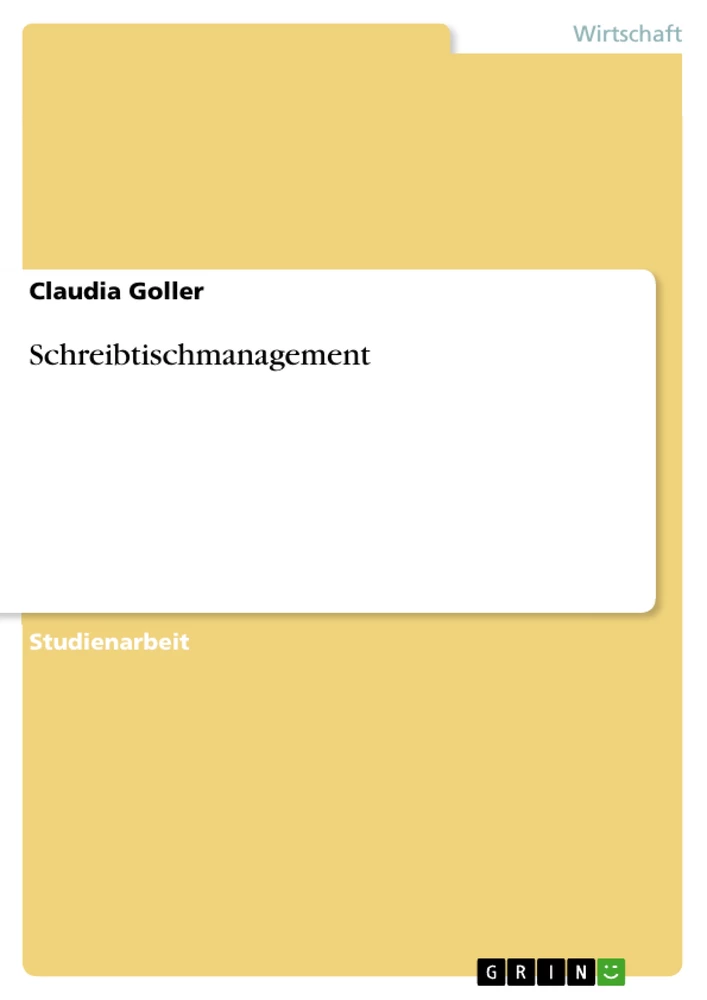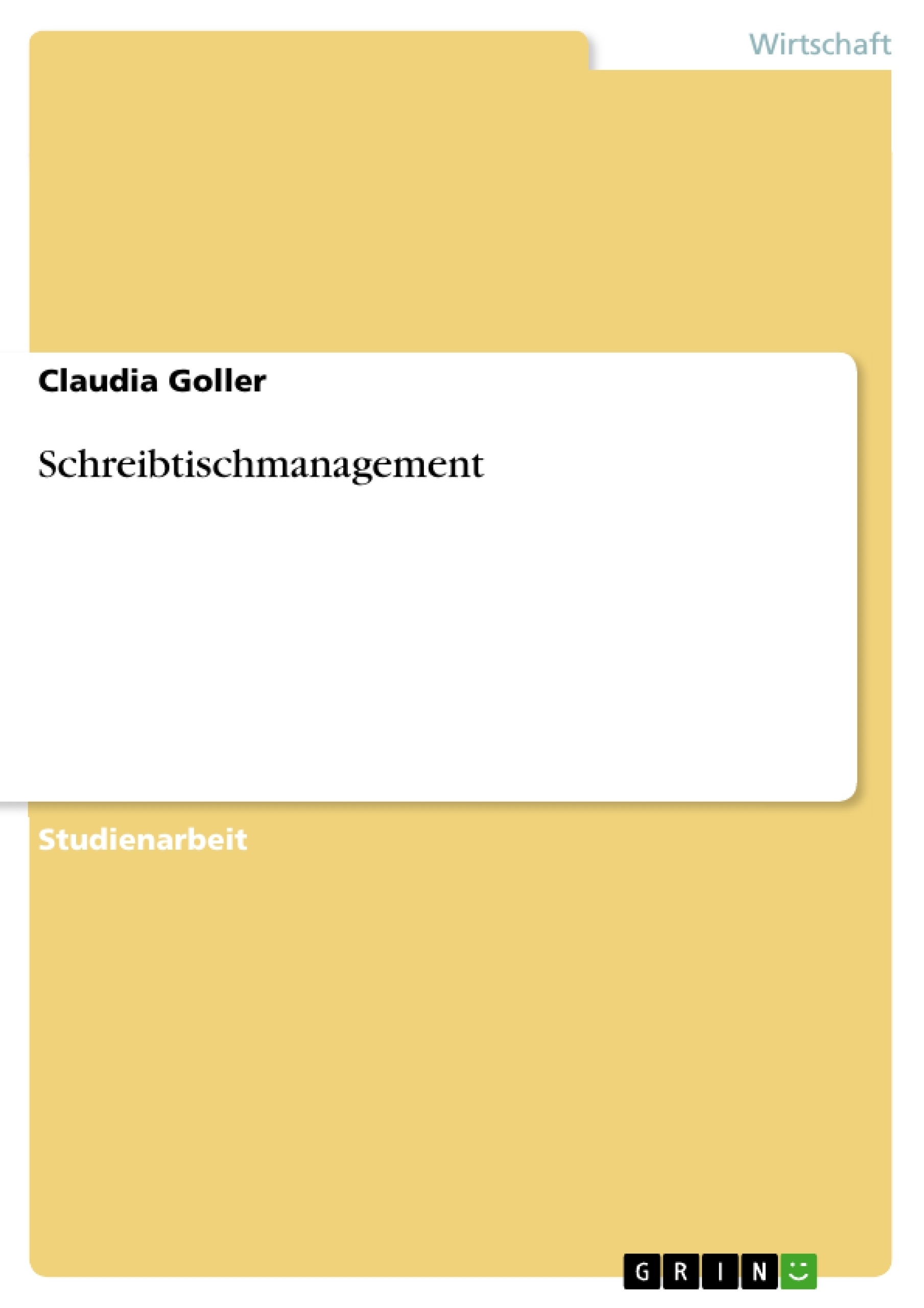1 Einleitung
Für effektives Arbeiten ist ein sinnvoll eingerichteter und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasster Schreibtisch nahezu unerlässlich. Aber nicht nur die Ausstattung des Schreibtisches, sondern auch der Ort, an dem man arbeitet, ist von entscheidender Bedeutung für den Arbeitserfolg. 1
2 Der Schreibtisch
2.1 Schreibtisch und Schreibtischstuhl
Der Schreibtisch sollte ausreichend Platz zum 2 Schreiben und Ausbreiten der benötigten Unterlagen bieten. Die Größe der Arbeitsfläche sollte min- destens 160 x 80 cm einnehmen. Die Höhe sollte für Frauen zwischen 70 und 74 cm und für Männer zwischen 74 und 78 cm betragen. Ideal ist ein höhenverstellbarer Tisch, der gleichzeitig eine geringe Neigung der Ober- fläche ermöglicht. Darüber hinaus sollte darauf geachtet werden, dass die Oberfläche nicht glänzt, um sehstörende Reflexionen zu vermeiden.
Um besonders bei kleineren Personen eine schlechte Sitzhaltung zu ver- hindern, sollte unter dem Schreibtisch eine Fußstütze mit mindestens 70 x 70 cm Durchmesser vorgesehen werden.
Zudem sollte man einen bequemen höhenverstellbaren Drehstuhl verwen- den, der „dynamisches“ Sitzen, also häufigen Stellungswechsel von Rumpf und Gesäß ermöglicht. Arbeitssitze mit verstellbaren Rückenlehnen sollten außerdem eine möglichst große Stützfläche für die Lendenwirbelsäule bie- ten.
Aus orthopädischer und physiologischer Sicht ist es sogar von Vorteil, wenn man beliebig oft zwischen sitzender und stehender Arbeitshaltung wechseln kann. Damit werden Ermüdungserscheinungen vorgebeugt, da im Stehen und im Sitzen unterschiedliche Muskeln beansprucht werden, so dass ein Wechseln bestimmte Muskelgruppen entlastet.
Die folgenden Angaben3 stellen die Mindestanforderungen an einen Schreibtisch dar:
- mindestens 160 cm breit, 80 cm tief
- nicht höhenverstellbare Tische: 72 cm hoch
- höhenverstellbare Tische: 68 cm bis 76 cm hoch
- ausreichend Raum für abwechselnde Arbeitshaltung und Bewegung
- genügend Beinfreiraum (Höhe: 65 cm, Breite 58 cm, Tiefe 60 cm)
- reflexionsarme Oberfläche
2.2 Beleuchtung
Schlechtes Licht erschwert die 1 Konzentration, führt zu schnellerer Ermüdung und schmerzenden Augen:
Hauptanforderungen an die Beleuchtung sind:
- genügend Licht, u.U. mehrere Lichtquellen
- keine scharfen Kontraste, d.h. man sollte große Helligkeitsunter- schiede am Arbeitsplatz vermeiden
- gut verteiltes Licht, d.h. weder man selbst noch das Arbeitsgerät sollten störende Schatten werfen
Der Schreibtisch sollte möglichst gleichmäßig beleuchtet sein. Wenn man ein Buch auf der Arbeitsfläche hin und her schiebt, kann kontrolliert werden, wie gleichmäßig die Arbeitsfläche ausgeleuchtet ist bzw. wo die Schrift gut und sie nicht mehr so gut zu lesen ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 Relative Abnahme der Fehlerrate als Funktion der Beleuchtungsstärke
(entnommen aus dem Skript der Vorlesung Arbeitschutz- und sicherheit WS 00/01, RWTH Aachen, Dr. Ma thias Bauer)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2 Relative Leistungssteigerung als Funktion der Beleuchtungsstärke (entnommen aus dem Skript der Vorlesung Arbeitschutz- und sicherheit WS 00/01, RWTH Aachen, Dr. Ma thias Bauer)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Leistungssteigerung bei Erhöhung der Beleuchtungsstärke von 90 Lux auf 500 Lux
Abb. 3 Einfluss der Beleuchtungsstärke auf geistige Arbeit
(entnommen aus dem Skript der Vorlesung Arbeitschutz- und sicherheit WS 00/01, RWTH Aachen, Dr. Ma thias Ba uer)
2.3 Lärm
Generell sollte Lärm am 1 Arbeitsplatz vermieden werden. Dies ist jedoch nicht immer möglich. Demzufolge sollte auf folgende Faktoren geachtet werden:
- Geräusche mit hohen Frequenzen und Lautstärken wirken unangeneh- mer als solche mit niedrigen Frequenzen und Lautstärken.
- Gleichmäßiger Lärm stört weniger als unerwartete oder immer wieder neu einsetzende Geräusche
- Nicht alle Menschen reagieren gleich auf Lärm, und eine Störung wird von einer Person zu unterschiedlichen Zeiten häufig als unterschiedlich störend empfunden.
- Eine große Rolle spielt die innere Einstellung, die man zu dem Lärm oder zu dessen Erzeuger hat (das laute Telefongespräch einer Kollegin, die man mag, stört weniger als das einer unbeliebten Kollegin)
2.4 Musik
Zu Musik am Arbeitsplatz kann 2 man zwei Aussagen machen:
1. Musik kann bei Routinearbeiten die Leistungsbereitschaft erhö- hen
2. Bei Tätigkeiten, die eine hohe Konzentration erfordern, wirkt Musik eher ablenkend
Dies ist natürlich abhängig von dem persönlichen Empfinden und Erfahrun- gen.
2.4 Belüftung und Beheizbarkeit
Weitere Anforderungen an den optimalen 1 Arbeitsplatz sind eine gute Be- lüftung und Beheizbarkeit. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 40 -60% betragen, bei geringeren Werten trocknen die Schleimhäute der Atemwege und die Haut aus. Außerdem nimmt die Wahrscheinlichkeit der elektrosta- tischen Aufladung zu. Im allgemeinen werden Raumtemperaturen von 21°C bis 23°C empfohlen, da frische Luft und ein kühler Raum die Konzentration fördern.
2.5 negative Faktoren
Auf folgende Störfaktoren sollte2 man achten und diese möglichst vermei- den:
Visuelle Störungen:
- Beleuchtungsfehler
- Bewegte Personen
- Sachen im unmittelbaren Umfeld(z.B. persönliche Gegenstände, Souvenirs, Zeitungen, usw.)
Klimatische Störungen:
- Zu hohe oder zu niedrige Temperatur
- Zugluft
3 Besonderheiten eines Computerarbeitsplatzes
Wenn man auf seinem Schreibtisch einen Computer3 unterbringen will, dann sollte die Arbeitsplatte eine entsprechende größere Tiefe haben. Diese variiert je nach Monitorgröße. Darüber hinaus sollte der Schreibtisch je nach Aufgabe und individuellen Notwendigkeiten verschiedene Anordnungen von Bildschirm, Tastatur und Beleghalter zulassen. Von Vorteil wären hier eine kabellose Tastatur und/oder Maus.
Um dynamisches Sitzen zu ermöglichen, sollte der Bildschirm zudem gedreht, geneigt und in der Höhe verstellt werden können. Im Normalfall wird die Höhe des Bildschirmes so gewählt, dass beim Blick nach geradeaus die obere Bildschirmkante gesehen wird (siehe Abbildung). Als häufigste Ursache für visuelle Beschwerden werden immer wieder Reflexe auf dem Bildschirm genannt. Daher sollten Bildschirme möglichst parallel zum Fenster ausgerichtet werden. Zusätzlich kann man die Fenster mit lichtdurchlässigen und reflexarmen Vorhängen abhängen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4 optimale Sitzhaltung bei Computerarbeit
(entnommen der Aufbauanleitung für den Standard Monitor Riser der Firma Fellowes)
4 Kontrolle des Arbeitsplatzes
4.1 Checkliste
Mit der folgenden Liste kann1 der Arbeitsplatz überprüft werden, indem die jeweils zutreffende Einstufung angekreuzt wird und anschließend mögliche Änderungen vorgenommen werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5 Checkliste zur Kontrolle des Arbeitsplatzes
(angelehnt an Hillebrandt Christian, http://leguan.emp.paed.uni-muenchen.de/strategien/arbeitsplatz /tool/webseiten/seiten/arbeitsmaterial.html vom 06.05.01)
4.2 Tipps
- Bewahren sie ähnliche Gegenstände 1 an einem Platz zusammen auf.
- Bohren sie an der Rückseite Ihres Schreibtischs ein Loch, durch das sie Leuchten- und andere Elektrokabel legen können. So lässt sich Ordnung halten
- Wenn sie nur ein oder zwei Kabel verlegen wollen, sollten Sie einen Kabelkanal verwenden
- Bringen Sie über Ihrem Schreibtisch ein Wandregal an. So bleibt der Boden für wichtigere Dinge frei. - z.B. einen Papierkorb.
- Bringen Sie den Rechner an einer speziellen Halterung an Ihrem Arbeitsplatz unter, so schaffen sie Platz auf dem Schreibtisch und auf dem Boden, den Sie dringend für andere Dinge brauchen.
- Geschlossene Aufbewahrungsmöbel halten Papiere und Ordner, die Sie gerade nicht benötigen, aus Ihrem Blickfeld. Das verringert den Stress.
- Arrangieren Sie Ihren Arbeitsplatz in L-Form oder wählen Sie einen größeren, breiteren Tisch, wenn Sie am Computer arbeiten und auch Platz benötigen, um Ihre Papiere auszubreiten.
- An einer ergonomisch geformten Arbeitsplatte können Sie nahe am Computer sitzen und gleichzeitig all das leicht erreichen, was zu Ihrem Arbeitsumfeld gehört. Abgerundete Tischenden können als kleiner Konferenzbereich genutzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass all das, was Sie häufiger benutzen, in Ihrer Reichweite ist. Weniger oft genutzte Gegenstände können weiter entfernt aufbewahrt werden. Das lädt Sie auch dazu ein, des öfteren Ihre Arbeitsposition zu wechseln.
- Ein Aufbewahrungssystem auf Rollen macht Sie und Ihren Arbeits- platz vielfältig und flexibel.
- In abschließbaren Aufbewahrungselementen können Sie Ihre per- sönlichen Sachen den ganzen Tag über sicher aufbewahren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.3 Arbeitsmaterial und Checkliste
Ein erfolgreiches Schreibtischmanagement hängt auch von der Art der Einrichtung des Arbeitsplatzes und dem richtigen Gebrauch von Hilfsmit- teln ab. „Dies geht von der rationellen Schriftgut-Verwaltung (Ablagesys- tem, Aktenplan, Registratur, Ordnungsmittel), Postkörben, Wiedervorlagen, Karteien, Planungstafeln, Flipchartständern über Diktiergeräte, Textverar- beitung-Computer, Timer und Telefonautomaten bis hin zu Fernschrei- bern, Fernkopieren etc.“1
An dem genutzten Arbeitsplatz sollten folgende nützliche Hilfsmittel in erreichbarer Nähe sein, um unnötiges Aufstehen und Herumsuchen zu vermeiden:
Abb. 6 Checkliste zur Kontrolle des Arbeitsmaterials
(entnommen aus Hillebrandt Christian http://leguan.emp.paed.uni-
muenchen.de/strategien/arbeitsplatz/toll/webseiten/seiten/arbeitsmaterial.html vom 06.05.01) Souvenirs, private Brief, Zeitschriften, der aktuelle Schmöker und alle andere Dinge, die vom Arbeiten ablenken und die Konzentration stören, gehören nicht auf den Schreibtisch.
5 Arbeitsplatzregeln
5.1 „Gestalten Sie Ihren Schreibtisch zum funktionalen Arbeitsplatz“
- Nutzen Sie alle technischen1 Möglichkeiten Ihres Schreibtisches. Setzen Sie vor allem die zugriffschnellen Schreibtischschubladen nutzbringend ein.
- „Gehen Sie alle ihre Dinge auf dem Schreibtisch und in den Schub- laden durch. Werfen sie weg, was immer sie entbehren können. So bleibt mehr Platz für die wirklich wichtigen Dinge.“2
- Lassen Sie nachträglich Hängeauszüge einbauen, falls Sie diese noch nicht besitzen. Scheuen Sie keine Mühe, die Technik Ihres Schreibtisches Ihrem persönlichen Arbeitsstil anzupassen.
- Verwenden Sie Ihre Schreibtischhängeauszüge für Ihre wichtigsten Vorgänge und Unterlagen.
- „Ein anpassungsfähiger Arbeitsplatz erlaubt Ihnen, Elemente wie Aktenschränke und Regale hinzufügen oder wegzunehmen, ganz so, wie Sie es brauchen.“3
- Unterscheiden Sie bei der Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes nach den Zugriffshäufigkeiten. Ordnen Sie häufig benötigte Unterlagen und Hilfsmittel in „Griffnähe“ Ihrer Hände an.
5.2 „Richten Sie Ihre Vorgangs-Ablage optimal ein.“
- Verbinden Sie „Zusammengehöriges“ konsequent 4 zu Vorgängen
- Legen Sie für jeden Vorgang eine eigene Hängemappe an.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vorgänge immer vollständig sind.
- Ordnen Sie Ihre Vorgänge nach übersichtlichen und logischen Kri- terien, die auch von Ihren Kollegen verstanden werden.
- Bewahren Sie am Arbeitsplatz nur Unterlagen hoher Aktualität auf.
- Verlassen Sie sich nicht allein auf Ihr Gedächtnis: Schaffen Sie sich eine perfekte Arbeitsplatzablage!
Wichtige Diktate z.B. sollten ohne Unterbrechungen und konzentriert ablaufen können. Telefonate und Lesezeiten ebenfalls. Halten Sie alle Unterlagen dafür übersichtlich bereit, damit Sie diese Arbeiten nicht wegen unvollständiger Unterlagen immer wieder unterbrechen müssen. Für Ihre wichtigsten Tätigkeiten gilt:
Bündeln Sie alle Unterlagen zu Aufgabenblöcken. Es wäre auch unrationell Lesematerial an verschiedenen Stellen des Schreibtisches aufzubewahren, oder einen bestimmten Gesprächspartner dreimal am Tag zu einer Besprechung zu bitten, nur weil Sie ungenügend vorbereitet sind.1
5.3 „Planen Sie nach zeitlichen Prioritäten.“
- Arbeiten Sie effizient. Sammeln 2 Sie die Unterlagen für Ihre regel- mäßig wiederkehrenden Tätigkeiten, und arbeiten Sie diese „en bloc“ ab.
- Bereiten Sie sich auf jede Tätigkeit ausreichend vor. Halten Sie die Unterlagen dafür komplett bereit.
- Setzen Sie einen Aufgabenplaner konsequent zur Steuerung und Überwachung Ihrer Aufgaben ein.
- Stellen Sie den Aufgabenplaner so auf, dass Sie ihn immer im Blick haben.
- Legen Sie Prioritäten fest.
- Füllen Sie für jede Aufgabe und jedes Ziel eine eigene Planungskar- te aus.
- Prüfen Sie täglich die festgelegten Prioritäten für Ihre wichtigsten Aufgaben.
- Entfernen Sie die Planungskarten für erledigte Aufgaben. Fügen Sie neue Aufgaben sofort unter der jeweiligen Prioritätsstufe ein.
Es ist wichtig, dass Sie die Zeitanteile Ihrer Tätigkeiten kennen: den Zeitbedarf für ständig sich wiederholende Tätigkeiten einerseits und für Schwerpunktaufgaben (z.B. Projekte) andererseits. Erfahrungsgemäß wird der Anteil der Routineaufgaben erheblich unterschätzt.3
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 7 Anteile des Zeitaufwandes für anfallende Tätigkeiten
(angelehnt an Leitz, http://caad.arch.ethz.ch/~spycher/img/LeitzZeitaufwand.gif vom 10.05.01)
6 Fazit
Mut zum leeren1 Schreibtisch!
Der Irrweg von der vollen Schreibtisch-Platte.
Wer Papierberge auf dem Schreibtisch aufbaut, glaubt, alles gut „im Blick“ und bei Bedarf sofort das Richtige „zur Hand“ zu haben. Beides ist ein Trugschluss, denn:
Pro Stapel ist nur ein Blatt sichtbar, nämlich das Blatt, das obenauf liegt. Alle anderen Unterlagen, die darunter liegen, müssen beim Suchen bewegt und umständlich umgeschichtet werden.
Papierberge behindern beim Bearbeiten.
Eine volle Schreibtisch-Platte beeinträchtigt die Leistung und hindert dar- an, sinnvoll zu arbeiten. Das heißt, es wird eine freie Arbeitsplatte benö- tigt, um alle Arbeitsunterlagen auszubreiten. Auf dem Schreibtisch sollten sich nur die allerwichtigsten Ordnungs- und Organisationsmittel befinden, die ständig benötigt werden. Und natürlich der eine Vorgang der gerade bearbeitet wird.
Negative Signale
Es wäre falsch zu glauben, dass viel Papier auf dem Schreibtisch Fleiß, Belastbarkeit oder Unentbehrlichkeit impliziert. Beobachter ziehen vielmehr negative Schlüsse: Vermutlich ist der Arbeitsstil unproduktiv, moderne Arbeitstechniken sind unbekannt, wirkungsvolle Planungshilfen und Organisationsmittel sind nicht geläufig.
Wenn Sie dies alles beachten, dann sollte Ihr Schreibtisch nicht so ausse- hen!
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8 Das "schöpferische Chaos“
(entnommen Leitz, http://caad.arch.ethz.ch/~spycher/img/LeitzChaos.gif vom 10.05.01)
[...]
1 Vgl Hillebrandt Christian, http://leguan.emp.paed.uni-muenchen.de/strategien/arbeitsplatz/ vom 06.05.01
2 Vgl.Hillebrandt Christian, http://leguan.emp.paed.uni-
muenchen.de/strategien/arbeitsplatz/tool/webseiten/seiten/schreibtisch.html vom 06.05.01
3 Vgl. Hillenbrandt Christian, http://leguan.emp.paed.uni-muenchen.de/strategien/arbeitsplatz/ vom 06.05.01 1
1 Vgl. Hillebrandt Christian, http://leguan.emp.paed.uni-muenchen.de/strategien/arbeitplatz/ vom 06.05.01
1 Vgl. Hillebrandt Christian, http://leguan.emp.paed.uni-muenchen.de/strategien/arbeitplatz/ vom 06.05.01
2 Vgl. Hillebrandt Christian, http://leguan.emp.paed.uni-muenchen.de/strategien/arbeitplatz/ vom 06.05.01
1 Vgl. Hillebrandt Christian, http://leguan.emp.paed.uni-muenchen.de/strategien/arbeitplatz/ vom 06.05.01
2 Vgl. Hillebrandt Christian,http://leguan.emp.paed.uni-muenchen.de/strategien/arbeitplatz/ vom 06.05.01
3 Vgl. Hillebrandt Christian, http://leguan.emp.paed.uni-muenchen.de/strategien/arbeitplatz/ vom 06.05.01
1 Vgl. Hillebrandt Christian, http://leguan.emp.paed.uni-muenchen.de/strategien/arbeitsplatz/ vom 06.05.01
1 Vgl.Ikea, http://www.ikea.ch/rooms_ideas/flash_page_storage_workspace.asp vom 06.05.01 und http://www.ikea.ch/rooms_ideas/professionaloffice_workstation.asp vom 06.05.01
1 Seiwert, Lothar J.: Selbstmanagement, Speyer 1988, S.44
1 Vgl. Leitz, http://caad.arch.ethz.ch/~spycher/img/LeitzReg3.gif vom 10.05.01
2 Ikea, http://www.ikea.ch/rooms_ideas/flash_page_storage_workspace.asp vom 06.05.01
3 Ikea, http://www.ikea.ch/rooms_ideas/professionaloffice_workstation.asp vom 06.05.01
4 Vgl. Leitz, http://caad.arch.ethz.ch/~spycher/img/LeitzReg4.gif vom 10.05.01
1 Vgl. Leitz, http://caad.arch.ethz.ch/~spycher/img/LeitzBuendel.gif vom 10.05.01
2 Vgl. Leitz, http://caad.arch.ethz.ch/~spycher/img/LeitzReg6.gif vom 10.05.01
3 Vgl. Leitz, http://caad.arch.ethz.ch/~spycher/img/LeitzZeitaufwand.gif vom 10.05.01
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Mindestanforderungen an einen Schreibtisch?
Ein Schreibtisch sollte mindestens 160 cm breit und 80 cm tief sein. Nicht höhenverstellbare Tische sollten 72 cm hoch sein, während höhenverstellbare Tische zwischen 68 cm und 76 cm hoch sein sollten. Es sollte ausreichend Raum für abwechselnde Arbeitshaltung und Bewegung sowie genügend Beinfreiraum (Höhe: 65 cm, Breite: 58 cm, Tiefe: 60 cm) vorhanden sein. Die Oberfläche sollte reflexionsarm sein.
Welche Faktoren sind bei der Beleuchtung am Arbeitsplatz zu beachten?
Die Beleuchtung sollte ausreichend Licht bieten, gegebenenfalls durch mehrere Lichtquellen. Scharfe Kontraste sollten vermieden werden, um große Helligkeitsunterschiede am Arbeitsplatz zu vermeiden. Das Licht sollte gut verteilt sein, sodass weder man selbst noch das Arbeitsgerät störende Schatten werfen.
Wie kann man Lärm am Arbeitsplatz reduzieren?
Generell sollte Lärm am Arbeitsplatz vermieden werden. Geräusche mit hohen Frequenzen und Lautstärken wirken unangenehmer als solche mit niedrigen Frequenzen und Lautstärken. Gleichmäßiger Lärm stört weniger als unerwartete oder immer wieder neu einsetzende Geräusche. Die individuelle Empfindlichkeit gegenüber Lärm spielt ebenfalls eine Rolle.
Welchen Einfluss hat Musik am Arbeitsplatz?
Musik kann bei Routinearbeiten die Leistungsbereitschaft erhöhen. Bei Tätigkeiten, die eine hohe Konzentration erfordern, wirkt Musik eher ablenkend. Dies hängt jedoch stark vom persönlichen Empfinden ab.
Welche Anforderungen gelten für Belüftung und Beheizbarkeit am Arbeitsplatz?
Eine gute Belüftung und Beheizbarkeit sind wichtig. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 40-60% betragen. Raumtemperaturen von 21°C bis 23°C werden im Allgemeinen empfohlen, da frische Luft und ein kühler Raum die Konzentration fördern.
Welche Störfaktoren sollten am Arbeitsplatz vermieden werden?
Visuelle Störungen wie Beleuchtungsfehler und bewegte Personen sowie klimatische Störungen wie zu hohe oder zu niedrige Temperatur und Zugluft sollten vermieden werden.
Was sind Besonderheiten eines Computerarbeitsplatzes?
Die Arbeitsplatte sollte eine entsprechende Tiefe haben, abhängig von der Monitorgröße. Der Schreibtisch sollte verschiedene Anordnungen von Bildschirm, Tastatur und Beleghalter zulassen. Eine kabellose Tastatur und/oder Maus sind von Vorteil. Der Bildschirm sollte gedreht, geneigt und in der Höhe verstellt werden können. Reflexe auf dem Bildschirm sollten vermieden werden, indem der Bildschirm parallel zum Fenster ausgerichtet wird oder lichtdurchlässige Vorhänge verwendet werden.
Wie kann der Arbeitsplatz kontrolliert werden?
Eine Checkliste kann verwendet werden, um den Arbeitsplatz zu überprüfen und mögliche Änderungen vorzunehmen. Ähnliche Gegenstände sollten an einem Platz zusammen aufbewahrt werden. Kabel können durch ein Loch an der Rückseite des Schreibtischs oder mit Kabelkanälen verlegt werden. Ein Wandregal oder eine spezielle Halterung für den Rechner kann Platz schaffen. Geschlossene Aufbewahrungsmöbel halten Papiere und Ordner aus dem Blickfeld.
Welche Arbeitsplatzregeln sollte man beachten?
Der Schreibtisch sollte zu einem funktionalen Arbeitsplatz gestaltet werden, indem alle technischen Möglichkeiten genutzt und unnötige Gegenstände entfernt werden. Die Vorgangs-Ablage sollte optimal eingerichtet werden, indem Zusammengehöriges konsequent zu Vorgängen verbunden und in Hängemappen abgelegt wird. Nach zeitlichen Prioritäten sollte geplant werden, indem Aufgaben effizient abgearbeitet und ein Aufgabenplaner eingesetzt wird.
Was ist das Fazit zum Thema Schreibtischmanagement?
Mut zum leeren Schreibtisch! Papierberge behindern beim Bearbeiten und vermitteln negative Signale. Auf dem Schreibtisch sollten sich nur die allerwichtigsten Ordnungs- und Organisationsmittel sowie der gerade bearbeitete Vorgang befinden.
- Quote paper
- Claudia Goller (Author), 2001, Schreibtischmanagement, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103298