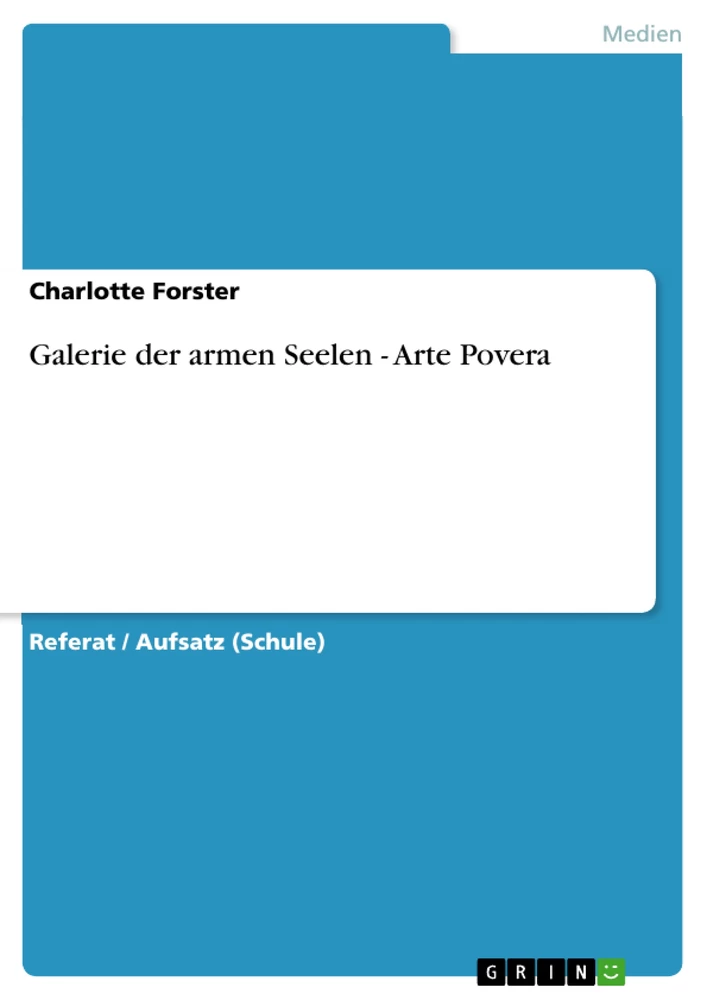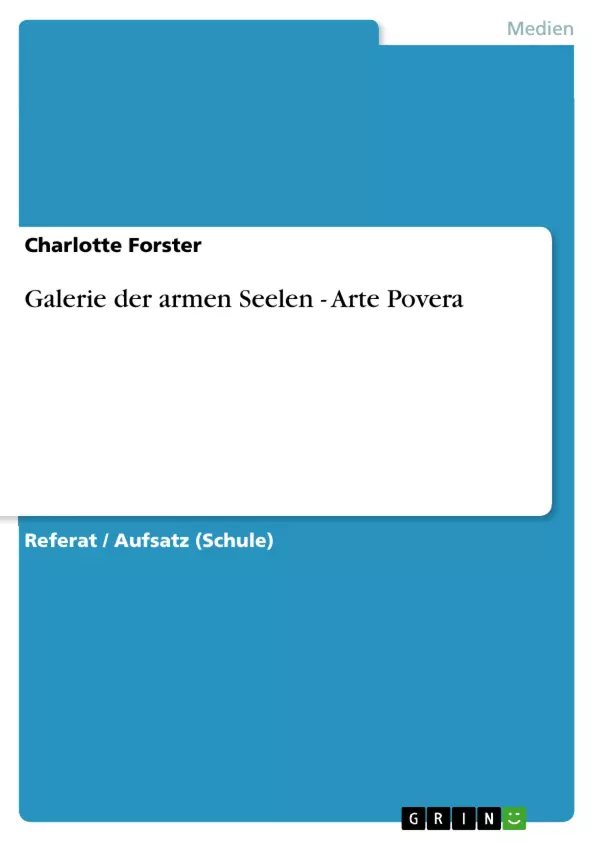Galerie der armen Seelen oder Arte Povera bei Arte Povera Die Dinge sind die Überlebenden der Vergangenheit
Einführungsrede zur Ausstellung von Claude Stockinger
01. Dezember 2000
von charlotte forster
Meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich könnte ich Sie heute auch mit »liebe Arte-Povera-Gemeinde« begrüßen. Nicht nur, weil Sie erfreulicherweise zur Eröffnung der Ausstellung in das gleichnamige Geschäft gekommen sind. Wohl den meisten von uns ist dieser Name auch als Kunstbegriff geläufig, und dies nicht erst seit 1997, als die Kunsthalle Nürnberg einen repräsentativen Überblick dieser von Italien ausgehenden Kunstströmung zeigte.
Vor genau dreiunddreißig Jahren wurde der Begriff Arte-Povera von dem italienischen Kritiker Germano Celant geprägt. Er fasst in diesem Begriff damit zusammen, was eine Reihe junger italienischer Künstler unabhängig voneinander beschäftigte: Aus einer kritischen Haltung gegenüber dem etablierten Kunstmarkt und dem herkömmlichen, geschlossenen Werkbegriff, wollten die Künstler ihre Werke in der Realität verankern. Doch im Gegensatz zu den in den USA entstandenen Strömungen der Pop Art und Minimal Art ist diese angestrebte Präsenz in den neuen Werken nicht geschichtslos, sondern bindet sich in Zitaten und Metaphern bewußt an ein italienisch-europäisches Kulturerbe an.
Inzwischen ist diese Kunstströmung zu einer klassischen Avantgardebewegung der Kunst der sogenannten „zweiten Moderne“ nach 1960 geworden. Für die Kunst von heute liefert sie immer noch wesentliche Impulse in der Beschäftigung mit den Grenzen und fließenden Übergängen von Kunst und Leben. Die Werke der Arte Povera bilden die Welt nicht ab, sondern erschaffen sie in poetischen Erzählungen und unerwarteten Konstellationen immer wieder neu. (#1)1
Damit knüpft die Arte Povera inhaltlich an die von Jean Dubufffet etwa 1945 begründete „Art brut an, über die dieser selbst sagte: "Wir verstehen darunter Werke von Personen, die unberührt von der kulturellen Kunst geblieben sind, bei denen also Anpassung und Nachahmung - anders als bei den intellektuellen Künstlern - kaum eine oder gar keine Rolle spielen. Die Autoren dieser Kunst beziehen also alles (Themen, Auswahl der verwendeten Materialien, Mittel der Umsetzung, Rhythmik, zeichnerische Handschrift usw.) aus ihrem eigenen Innern und nicht aus den Klischees der klassischen Kunst oder der gerade aktuellen Kunstströmung. wir können die künstlerische Arbeit in ganz reiner - sozusagen roher - Form miterleben, wie sie vom Künstler ganz und gar in all ihren Phasen aus eigenem Antrieb neu entdeckt wird. Eine Kunst also, in der nur die eigene Erfindung in Erscheinung tritt, und die nichts von einem Chamäleon oder einem Affen an sich hat, wie das bei der kulturellen Kunst konstante Praxis ist."2 Da auch unser Künstler offensichtlich (und mit gutem Grund) dem ausschließlich rationellen und intellektuellem Kalkül in der Kunst misstraut, siedeln sich Thematik und grundlegendes künstlerisches Verständnis, Formensprache und Symbolik eher im intuitiven Bereich an.
Seine Kunst besitzt Sie einen hochentwickelten Sinn für Proportionen und Harmonie. Alle ausgestellten Arbeiten besitzen die Qualität der Schönheit. Würde man nach Vergleichen in der Kunstgeschichte suchen, böte sich eine assoziative Auseinandersetzung mit Arbeiten von Daniel Spoerri an. Auch bei Spoerri finden wir Objekte mit ähnlicher Semantik. Doch solche Bezüge bergen die Falle der Knechtschaft des Vergleichs, stellen Authentizität in Frage und behindern die eigene Meinung.
Claude Stockinger verwendet Fundstücke aus der Welt der Natur und des Alltags. So entsteht ein Spiel mit der Prozeßhaftigkeit, mit der Fragilität und Flüchtigkeit - Materialien der Natur, wie Holz und Stein verbinden sich ganz selbstverständlich mit den Errungenschaften der Zivilisation. Seine Trouvaillen, entstehen aus einem existentiellen Bedürfnis zu Objekten mit "Fetischcharakter" beziehungsweise magischer Kraft, sie schöpfen scheinbar aus einem Baukasten unendlicher Möglichkeiten.
Die verwendeten Alltagsgegenstände erhalten bei Stockinger eine neue Bestimmung. Als ausgebildeter Restaurator liegt für ihn vielleicht der Gedanke nahe, auch eine Art Bewahrung mit aller konservatorischen Sorgfalt anzuwenden - doch dies würde nicht die Aura der Objekten erklären.
Der Künstler sagt selbst dazu: „Die Dinge müssen zueinander finden, in ihrer eigenen Energie, in ihrer Handwerklichkeit, man muß die Kraft der Person spüren, die dahinter steckte“
„Der Migrant, dieser Mensch der heranrückenden heimatlosen Zukunft, schleppt (..) Brocken der Geheimnisse aller jener Heimaten in seinem Unterbewußtsein mit, die er durchlaufen hat, schreibt Vilem Flusser. (3 )
Hier, wo Relikte Geschichte schreiben, und die Vergänglichkeit zur Gegenwart wird, wird auch das Wertlose und Unscheinbare wieder wertvoll.
Und irgendwo berührt uns das eine oder andere Objekt in seiner eigentümlichen Vertrautheit, erzeugt so ein heimatliches Gefühl. Ein assoziatives Wiedererkennen - vielleicht hatte so ein „Ding“ Ihre Großmutter auch?... Was ist so faszinierend an diesen Object Trouvees - an diesen Fundstücken: Ihre Handhabungen hinterließen Spuren von Gebrauch und Verschleiß: Die verschliffene Klinge des Messers, eine sanfte Mulde am Holzgriff , dort, wo der Daumen lag... in uns entstehen eigene Bilder ... Aber wovon zeugen diese gebrauchten Dinge, diese Gebrauchsgegenstände vergangener Zeiten und vergangener Ereignisse?
Die Dinge sind die Überlebenden der Vergangenheit. Längst verschwundene Generationen haben ihre Gedanken, ihre Botschaft an uns in den Dingen verkapselt. Wer öffnet die Flaschenpost? Wer findet das Zauberwort, um sie zu entziffern? Eine Märchenaufgabe: wir müssen bereit sein, uns selbst zu erkennen. Doch wer mag keine Märchen.
[...]
1 Vgl: Kunsthalle Nürnberg, Ausstellung Arte Povera, 2 Oktober bis 7. Dezember 1997
2 Jan Dubuffet: Band I, die Malerei in der Falle. Bern, 1991
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes "Galerie der armen Seelen oder Arte Povera bei Arte Povera Die Dinge sind die Überlebenden der Vergangenheit"?
Der Text ist eine Einführungsrede zur Ausstellung von Claude Stockinger vom 1. Dezember 2000, gehalten von Charlotte Forster. Er beschäftigt sich mit dem Kunstbegriff Arte Povera, seiner Entstehung, seiner Bedeutung und seiner Verbindung zu den Werken von Claude Stockinger.
Wer prägte den Begriff "Arte Povera" und wann?
Der italienische Kritiker Germano Celant prägte den Begriff "Arte Povera" vor 33 Jahren (bezogen auf das Datum des Textes, also ca. 1967).
Was war das Ziel der Künstler der Arte Povera Bewegung?
Die Künstler wollten ihre Werke in der Realität verankern und sich kritisch mit dem etablierten Kunstmarkt und dem herkömmlichen Werkbegriff auseinandersetzen. Sie bezogen sich dabei bewusst auf ein italienisch-europäisches Kulturerbe.
Wie unterscheidet sich die Arte Povera von Pop Art und Minimal Art?
Im Gegensatz zu Pop Art und Minimal Art, die in den USA entstanden, ist die Arte Povera nicht geschichtslos, sondern bindet sich in Zitaten und Metaphern an ein italienisch-europäisches Kulturerbe an.
Welche Bedeutung hat die Arte Povera heute?
Sie liefert immer noch wesentliche Impulse in der Beschäftigung mit den Grenzen und fließenden Übergängen von Kunst und Leben.
Inwiefern knüpft die Arte Povera an die Art Brut an?
Die Arte Povera knüpft inhaltlich an die "Art brut" an, die von Jean Dubuffet begründet wurde, indem sie sich auf Werke von Personen konzentriert, die unberührt von der kulturellen Kunst geblieben sind und alles aus ihrem Inneren schöpfen.
Welche Materialien verwendet Claude Stockinger in seinen Werken?
Claude Stockinger verwendet Fundstücke aus der Welt der Natur und des Alltags, wie Holz und Stein, und verbindet diese mit Errungenschaften der Zivilisation.
Was sagt Claude Stockinger über die Dinge, die er für seine Kunst verwendet?
Er sagt: „Die Dinge müssen zueinander finden, in ihrer eigenen Energie, in ihrer Handwerklichkeit, man muß die Kraft der Person spüren, die dahinter steckte“
Was wird über die "Dinge" in Bezug auf die Vergangenheit gesagt?
Die Dinge sind die Überlebenden der Vergangenheit und verkapseln Gedanken und Botschaften vergangener Generationen.
Welche weiteren Künstler werden im Text erwähnt?
Neben Claude Stockinger, Germano Celant und Jean Dubuffet wird Daniel Spoerri erwähnt, dessen Arbeiten eine assoziative Auseinandersetzung ermöglichen.
- Arbeit zitieren
- Charlotte Forster (Autor:in), 2001, Galerie der armen Seelen - Arte Povera, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103147