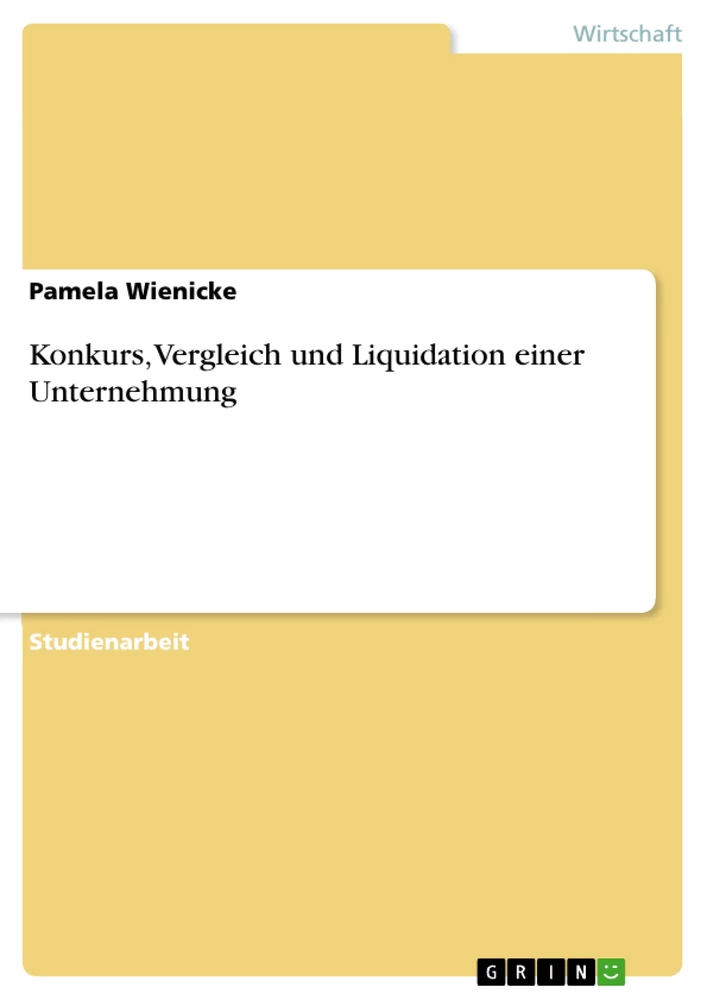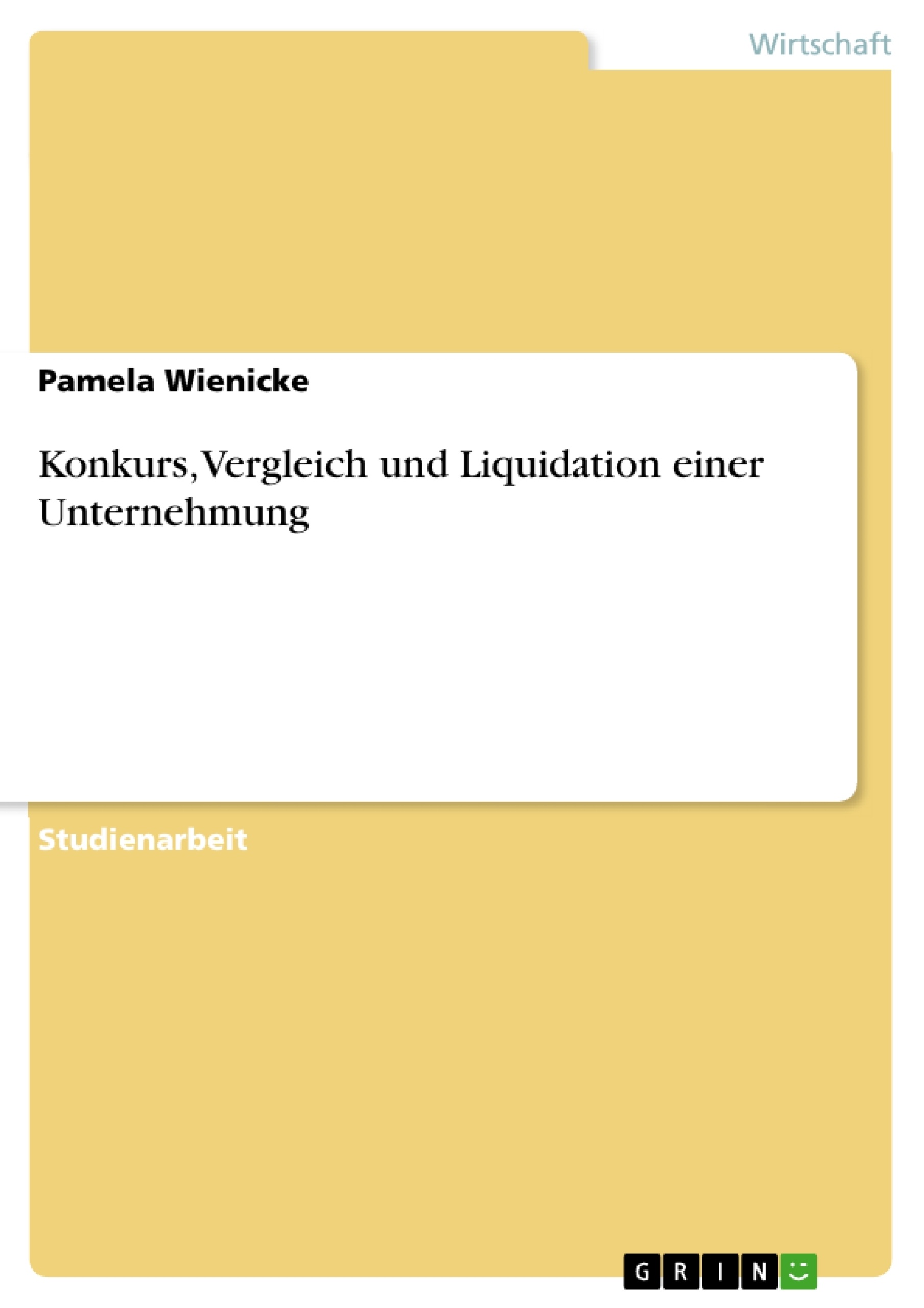Gliederung
1. Konkurs
1.1 Definition
1.2 Entstehung eines Konkurses
1.3 Ablauf des Konkursverfahrens
1.4 Das Recht der freien Nachforderung
1.4.1 unbeschränkte Haftung
1.4.2 beschränkte Haftung
2. Vergleich
2.1 Definition
2.2 Ablauf eines Vergleichverfahrens
2.3 Der außergerichtliche Vergleich
2.3.1 Arten des außergerichtlichen Vergleiches
3. Liquidation
3.1 Definition
3.2. Entstehung einer Liquidation
3.3 Ablauf einer Liquidation
3.3.1 Materielle Liquidation
3.3.2 Formelle Liquidation
4. Resumee
5. Literaturnachweis
1.Konkurs:
1.1 Definition:
Der Konkurs ist die Gesamtvollstreckung in das pfändbare Vermögen eines zahlungsunfähigen bzw. überschuldeten Schuldners zur gleichmäßigen anteiligen Befriedigung aller Gläubiger (vergl. Meyers grosses Taschenlexikon).
1.2 Entstehung des Konkurses:
Für die Entstehung eines Konkurses sind Jahre der Misswirtschaft und die kontinuierliche Überschuldung eines Betriebes verantwortlich.
1.3 Ablauf des Konkursverfahrens:
Das Konkursverfahren wird grundsätzlich auf Antrag der Gläubiger oder durch Antrag des Schuldners selbst vom Gericht eröffnet. Das Konkursverfahren tritt ebenfalls im Anschluß eines gescheiterten Vergleichs (siehe 2) (Anschlusskonkurs) ein. Vorraussetzung für ein Konkursverfahren ist die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners, also der Unternehmung. Außerdem sollte das Vermögen (Konkursmasse) den Kosten des Verfahrens entsprechen, um so wenigstens diese tragen zu können. Ist dies nicht der Fall, wird der Schuldner in ein öffentliches Schuldnerverzeichnis eingetragen. Das Schuldnerverzeichnis wird beim Amtsgericht geführt und beinhaltet die eidesstattliche Versicherung von Schuldnern über die Höhe ihres Vermögens. Bei Eröffnung bestimmt das zuständige Gericht einen Konkursverwalter, der die Konkursmasse sammelt und diese auf die Gläubigen verteilt. Der Schuldner verliert das Verfügungsrecht auf sein Vermögen (Konkursbeschlag).
Laufende, nicht abgeschlossene Geschäfte gehen in die Konkursmasse mit ein. Sollte ein Schuldner weniger als ein Jahr vor Konkurseröffnung Vermögenswerte durch Rechtsgeschäfte abgestoßen haben, wie z.B. Schenkungen an eigene Kinder, können diese Rechtsgeschäfte durch Konkursanfechtung nichtig werden. Liegt eine Schenkung an Ehegatten vor, so verlängert sich die Zeit von 12 Monate auf 24 Monate.
Gläubiger sind zur Anmeldung Ihrer Ansprüche unter Angabe des Grundes und der Höhe bei dem zuständigen Gericht verpflichtet. Hier können Gläubiger ein Konkursvorrecht beanspruchen, wenn eines der folgenden Sachverhalte vorliegt:
1. Lohnforderungen/Ansprüche aus dem Sozialplan
2. Steuerschulden
3. Schulden an Kirchen/Schulen
4. Heilkosten
5. Ansprüche von Kindern/Mündeln
Die genannten Sachverhalte sind als Rangfolge zu sehen, die nacheinander erfüllt werden müssen, bis die Gläubiger ohne Konkursvorrecht befriedigt werden können.
Haben die Gläubiger ihre Ansprüche angemeldet, erstellt das Gericht eine Konkurstabelle, wo die angemeldeten Forderungen in einer Rangfolge festgelegt werden.
In einer Gläubigerversammlung werden die Forderungen der Gläubiger erörtert und festgestellt (Prüfungstermin). Die Befriedigung aller Gläubiger erfolgt nach diesem Prüfungstermin als Abschlagszahlung.
Nach Verwertung der Konkursmasse wird die Schlussverteilung vorgenommen, danach gegebenenfalls eine Nachtragsverteilung.
Um alle Gläubiger gleichmäßig zu befriedigen, wird eine Konkursquote festgelegt, ein prozentualer Anteil entsprechend dem Verhältnis zwischen Forderung und Konkursmasse.
Durch Beschluß des Gerichts wird das Konkursverfahren abgeschlossen und der Konkurs der Unternehmung öffentlich bekannt gegeben.
1.4 Das Recht der freien Nachforderung:
Nicht befriedigten Gläubigern steht es frei, ihre Ansprüche gegenüber dem Schuldner durch das Recht der freien Nachforderung weiter geltend zu machen. Bei dem Recht der freien Nachforderung ist es von besonderer Wichtigkeit, welcher Rechtsform das Unternehmung, welches Konkurs gemacht hat, angehört. Man unterscheidet die beschränkte und die unbeschränkte Haftung bei den einzelnen Rechtsformen.
1.4.1 Unbeschr ä nkte Haftung:
a) Einzelunternehmer/OHG: Der Einzelunternehmer/ die Besitzer einer OHG tragen sämtliche Risiken für das Unternehmen allein und haften unbeschränkt, also auch in voller Höhe des Privatvermögens.
b) KG: werden Verluste erwirtschaftet haften lediglich die Komplementäre in voller Höhe, die Kommanditisten haften in Höhe ihrer Einlage.
Übersteigen die Verluste die Höhe der Einlage, so kann eine Beteiligung des Kommanditisten „im Innenverhältnis“ vereinbart werden, so dass ein negatives Kapitalkonto entsteht.
c) Stille Gesellschaft: Haftung nur in Höhe der Einlage, eine Verlustbeteiligung kann jedoch vereinbart werden
1.4.2 Beschr ä nkte Haftung:
Die GmbH, AG und Genossenschaften haften lediglich bis zur Höhe der Einlage, so dass hier das Recht der freien Nachforderung erlischt.
2. Vergleich:
2.1 Definition:
Der Vergleich ist ein gerichtliches Verfahren zur Abwendung des Konkurses, geregelt in der Vergleichsordnung . Der Vergleich ist ein Vertrag zwischen Gläubigermehrheit und Schuldner, der mit Wirkung für und gegen alle Gläubiger die anteilige Befriedigung der Gläubiger gegen den Erlaß der Restforderungen sicherstellen soll, damit das Unternehmen im Interesse aller Beteiligten weiterbestehen kann (vergl. Meyers großes Taschenlexikon).
2.2 Ablauf des Vergleichsverfahren:
Grundsätzlich wird das Vergleichsverfahren durch den Antrag des Schuldners selbst vom Gericht eröffnet.
Die Frist dafür ist durch den bevorstehenden Konkurs gesetzt, der Schuldner hat also für seinen Antrag Zeit bis zur Eröffnung des Konkursverfahrens.
Der Antrag auf Vergleich muß einen Vergleichsvorschlag enthalten, der aussagt, bis zu welcher Vergleichsquote die Gläubiger befriedigt werden sollen. Die Mindestquote liegt bei 35% der bestehenden Forderungen der Gläubiger.
Das Gericht eröffnet das Vergleichsverfahren, indem es einen Vergleichsverwalter beruft, der mit der Prüfung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, der Geschäftsleitung sowie der Lebenshaltung des Verantwortlichen betraut ist.
Nachdem die Gläubiger vom Gericht aufgefordert wurden, ihre Ansprüche gegenüber dem Schuldner anzumelden, wird, wie beim Konkursverfahren, ein Gläubigerverzeichnis angelegt.
Der Vergleich gilt als zustande gekommen, wenn das zuständige Gericht den Vergleichsvorschlag angenommen und diesem zugestimmt hat. Der Schuldner hat sich nach dem Vergleichsverfahren einem Sachwalter zu unterwerfen, der die Vergleichserfüllung überwacht.
Ist die Zustimmung des Gerichts nicht erfolgt, so wird eine Prüfung bezüglich des Konkursverfahrens gemacht, um festzustellen, ob die Vorraussetzungen für ein solches Verfahren gewährleistet sind (siehe 1.3).
2.3 Der au ß ergerichtliche Vergleich:
Bei einem außergerichtlichem Vergleich handelt es sich um eine private Vereinbarung zwischen dem Schuldner und den Gläubigern. Wichtig bei einem solchem Vergleich ist die absolute Notwendigkeit der Zustimmung sämtlicher Gläubiger.
Wie die Bezeichnung schon zeigt, wird bei einem außergerichtlichem Vergleich kein Gericht eingeschaltet.
So sind auch gesetzliche Schranken nicht vorhanden, an die sich alle Beteiligten halten müssen. Da es sich um einen privaten Vertrag handelt, kann alles vereinbart werden, solange sämtliche Gläubiger zustimmen.
2.3.1 Arten des au ß ergerichtlichen Vergleichs:
Der außergerichtliche Vergleich ist durch 3 Arten geprägt:
1. Der Erlassvergleich: vertraglicher Verzicht der Gläubiger auf die Forderungen
2. Das Stillhalteabkommen: Übereinkunft zwischen Gläubiger und Schuldner über die Stundung von Krediten
3. Der Liquidationsvergleich: Übertragung des Vermögens des Schuldners ganz oder teilweise an die Gläubiger. Die Restforderungen, die durch den Erlös der
3. Liquidation:
3.1 Definition:
Bei einer Liquidation werden sämtliche Vermögensgegenstände eines Unternehmens nach der Auflösung veräußert und zur Tilgung der Schulden eingesetzt. Grundsätzlich geht die Liquidation der Auflösung eines Unternehmens zeitlich zuvor.
3.2 Entstehung einer Liquidation:
Es gibt mehrer Gründe für eine Auflösung einer Unternehmung, die die Liquidation zur Folge hat:
1. mehrere verlustreiche Jahre mit der Folge des Konkurses oder des Liquidationsvergleichs
2. Betriebszweck der Unternehmung wurde nicht erreicht
3. Ablauf der im Gesellschaftervertrag vereinbarten Betriebszeit
4. Beschluß der Hauptversammlung (bei einer AG)
5. Eröffnung des Konkursverfahrens
6. Ablehnung des Konkursverfahrens mangels Konkursmasse
3.3 Ablauf einer Liquidation:
Im Zeitraum der laufenden Liquidation kann die betroffene Unternehmung keine weiteren Aufträge entgegennehmen und wird dadurch von einer Erwerbs- zur Abwicklungsgesellschaft. Während des länger andauernden Liquidationszeitraumes trägt die Firma ihren Firmennamen mit dem Zusatz i.L. (in Liquidation).
3.3.1 Materielle Liquidation:
Die Liquidation wird von den Liquidatoren (meist die Gesellschafter selbst) durchgeführt, die die laufenden Geschäfte beendigen. Die Liquidatoren sind stets bemüht, das vorhandene Firmenvermögen günstig für die Gläubiger zu veräußern, um so die Forderungen der Gläubiger bereits mit dem Erlös zu befriedigen. Am Beginn der Liquidation sind die Liquidatoren zur Vorlage einer Eröffnungsbilanz und bis zum Abschluß der Liquidation zur Vorlage von Jahresabschlüssen und Lageberichten verpflichtet. Diese Berichte sind der Hauptversammlung vorzulegen. Hierbei müssen Vorschriften für die Gliederung, Bewertung und Prüfung der Jahresabschlüsse nicht angewendet werden. Die Bewertung der einzelnen Bilanzpositionen liegt im Ermessen der Liquidatoren.
Können sämtliche Ansprüche der Gläubiger durch Veräußerung des Firmenvermögens befriedigt werden und entsteht ein Gewinn, wird der Gewinn der Liquidation nach Einlage auf die Aktionäre verteilt. Zum Schutze der Gläubiger wird jedoch vorgeschrieben, dass diese dreimalig aufgefordert werden müssen, ihre Ansprüche geltend zu machen (§ 267 AktG).
Erst ein Jahr nach der dritten Aufforderung darf der Gewinn, der durch die Liquidation entstanden ist, auf die Aktionäre verteilt werden.
Sind im Liquidationserlös Beträge aus der Auflösung stiller Reserven enthalten, so werden diese Erlöse entsprechend der nominellen Einlagen auf die Gesellschafter verteilt.
3.3.2 Formelle Liquidation:
Bei der formellen Liquidation handelt es sich um eine rechtliche Auflösung einer Unternehmung. Die Firma wird unter einer anderen Rechtsform (Wandlung) oder unter einer anderen Firma (Fusion) wirtschaftlich fortgeführt.
4. Resumee:
Bei Personengesellschaften entsteht durch die gesetzlich geregelte Erlösverteilung von stillen Reserven nach einer Liquidation (siehe 3.3.1) folgendes Problem, welches im Wöhe, „Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ mit folgendem Beispiel verdeutlicht werden kann:
Da die Erlöse, die sich aus der Auflösung von stillen Reserven ergebn haben, auf den nominellen Anteil der einzelnen Gesellschafter oder Aktionäre verteilt werden, kann diese Regelung bei Personengesellschaften zur Benachteiligung einzelner Gesellschafter führen. Vorraussetzung für dieses Problem ist, dass die Gewinnverteilung nach der Verzinsung von 4% auf die Einlagen erfolgt. Angenommen, Gesellschafter A ist an einer OHG mit einem Anteil von 20%, Gesellschafter B mit einem Anteil von 80% beteiligt, so wird der Erlös aus den stillen Reserven von beispielsweise DM 10.000 auf A mit DM 2.000 und auf B mit DM 8.000 verteilt.
Wären diese stillen Reserven in früheren Jahren als Gewinn ausgewiesen worden, so hätte jeder der beiden Gesellschafter DM 5.000 ausgezahlt bekommen, falls im Gesellschaftsvertrag nichts abweichendes vereinbart wurde.
Wie man deutlich sehen kann, ist der kapitalschwächere Gesellschafter A im Falle einer Liquidation benachteiligt.
Diese Benachteilung kann jede Gesellschaft durch die Möglichkeit der Veränderung der Ergebnisverteilung im Gesellschaftsvertrag umgehen. Der gesetzliche Verteilungsschlüssel wird mit dem geänderten Schlüssel außer Kraft gesetzt.
Ergo ist der Gesellschaftsvertrag ein gutes Instrument für Gesellschafter, um gesetzliche Lücken zu füllen und um gesetzliche Schwächen wie in dem geschilderten Fall zu umgehen.
Neben diesem Aspekt sei zu beachten, dass bei einer Rechtsform mit beschränkter Haftung zwar der Nachteil der meist hohen Mindesteinlage (bei einer AG beispielsweise DM 50.000) besteht, jedoch das recht der Nachforderung nicht besteht (siehe 1.4). Die Forderungen der Gläubiger werden bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung lediglich bis zur Höhe der Einlage befriedigt. Das Privatvermögen der einzelnen Gesellschafter bleibt unberührt. Gründe ich jedoch eine Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung, besteht bei den Gläubigern im Falle eines Konkurses das Recht der Nachforderung auch nach der Liquidation des Firmenvermögens. Das Privatvermögen wird also zur Schuldentilgung hinzugezogen.
Wie man erkennen kann, sind viele Faktoren bei der Gründung einer Unternehmung äußerst wichtig zu bedenken. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit kann die Wahl der Rechtsform der bestehenden Unternehmung die Existenz der Gesellschafter retten, der Gesellschaftervertrag kann die Gesellschafter selbst vor bösen Überraschungen bei der Ergebnisverteilung und bei der Auflösung der Firma bewahren.
Diese Möglichkeiten sollte man als Neugründer bedenken und ausschöpfen.
5. Literaturverzeichnis:
Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftlehre, 16. Auflage
Meyers grosses Taschenlexikon, 5. Auflage
Prof. Dr. Dr. h. c. E. Heinen, Einführung in die Betriebswirtschaftlehre, 6. Auflage
Microsoft® Encarta® 99 Enzyklopädie
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Konkurs gemäß diesem Dokument?
Der Konkurs ist die Gesamtvollstreckung in das pfändbare Vermögen eines zahlungsunfähigen bzw. überschuldeten Schuldners zur gleichmäßigen anteiligen Befriedigung aller Gläubiger.
Wie entsteht ein Konkurs?
Ein Konkurs entsteht durch Jahre der Misswirtschaft und die kontinuierliche Überschuldung eines Betriebes.
Wie läuft ein Konkursverfahren ab?
Das Konkursverfahren wird auf Antrag der Gläubiger oder des Schuldners vom Gericht eröffnet. Ein Konkursverwalter wird bestellt, der das Vermögen (Konkursmasse) sammelt und an die Gläubiger verteilt. Gläubiger melden ihre Ansprüche an, eine Konkurstabelle wird erstellt und die Befriedigung erfolgt als Abschlagszahlung und Schlussverteilung.
Was ist das Recht der freien Nachforderung?
Nicht befriedigten Gläubigern steht es frei, ihre Ansprüche gegenüber dem Schuldner weiter geltend zu machen, abhängig von der Rechtsform des Unternehmens und der Art der Haftung (beschränkt oder unbeschränkt).
Welche Formen der Haftung gibt es im Konkursfall?
Es gibt unbeschränkte Haftung (Einzelunternehmer, OHG, Komplementäre einer KG, Stille Gesellschaft – bis zur Einlage) und beschränkte Haftung (GmbH, AG, Genossenschaften – bis zur Höhe der Einlage).
Was ist ein Vergleichsverfahren?
Der Vergleich ist ein gerichtliches Verfahren zur Abwendung des Konkurses, ein Vertrag zwischen Gläubigermehrheit und Schuldner, der die anteilige Befriedigung der Gläubiger gegen den Erlaß der Restforderungen sicherstellen soll.
Wie läuft ein Vergleichsverfahren ab?
Das Verfahren wird durch den Antrag des Schuldners eröffnet, der einen Vergleichsvorschlag unterbreitet. Ein Vergleichsverwalter wird berufen, die Gläubiger melden ihre Ansprüche an, und das Gericht stimmt dem Vergleichsvorschlag zu, wenn er angenommen wird.
Was ist ein außergerichtlicher Vergleich?
Ein außergerichtlicher Vergleich ist eine private Vereinbarung zwischen Schuldner und Gläubigern, bei der sämtliche Gläubiger zustimmen müssen.
Welche Arten des außergerichtlichen Vergleichs gibt es?
Es gibt den Erlassvergleich (Verzicht der Gläubiger auf Forderungen), das Stillhalteabkommen (Stundung von Krediten) und den Liquidationsvergleich (Übertragung des Vermögens an die Gläubiger).
Was ist eine Liquidation?
Bei einer Liquidation werden sämtliche Vermögensgegenstände eines Unternehmens nach der Auflösung veräußert und zur Tilgung der Schulden eingesetzt.
Wie entsteht eine Liquidation?
Eine Liquidation entsteht durch verlustreiche Jahre, Nichterreichen des Betriebszwecks, Ablauf der Betriebszeit, Beschluß der Hauptversammlung, Eröffnung des Konkursverfahrens oder Ablehnung des Konkursverfahrens mangels Konkursmasse.
Wie läuft eine Liquidation ab?
Die Liquidation wird von den Liquidatoren durchgeführt, die die laufenden Geschäfte beendigen und das Firmenvermögen veräußern. Es gibt materielle Liquidation (Veräußerung des Vermögens) und formelle Liquidation (rechtliche Auflösung mit wirtschaftlicher Fortführung unter anderer Rechtsform oder Firma).
Was ist bei der Liquidation von Personengesellschaften zu beachten?
Die gesetzliche Erlösverteilung von stillen Reserven nach nominellen Anteilen kann zur Benachteiligung einzelner Gesellschafter führen, insbesondere wenn die Gewinnverteilung nach der Verzinsung von Einlagen erfolgt. Dies kann durch eine abweichende Regelung im Gesellschaftsvertrag umgangen werden.
Welche Rechtsform ist im Hinblick auf Konkurs und Liquidation vorteilhaft?
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH, AG) bieten den Vorteil, dass das Recht der Nachforderung nicht besteht, während bei Gesellschaften mit unbeschränkter Haftung auch das Privatvermögen zur Schuldentilgung herangezogen werden kann.
- Arbeit zitieren
- Pamela Wienicke (Autor:in), 2001, Konkurs, Vergleich und Liquidation einer Unternehmung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/102917