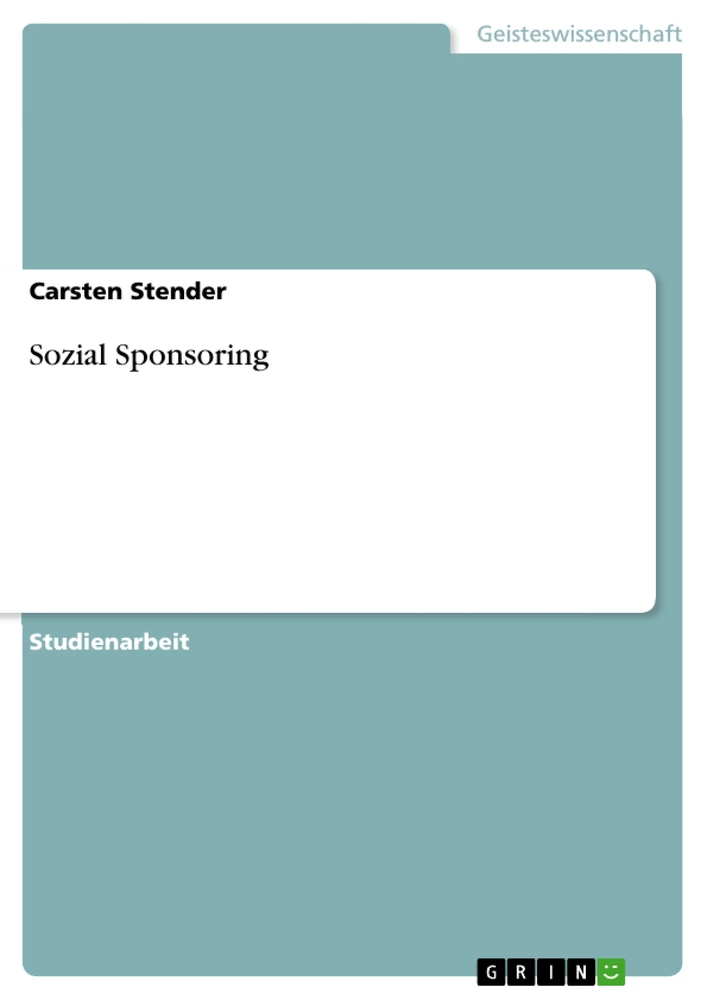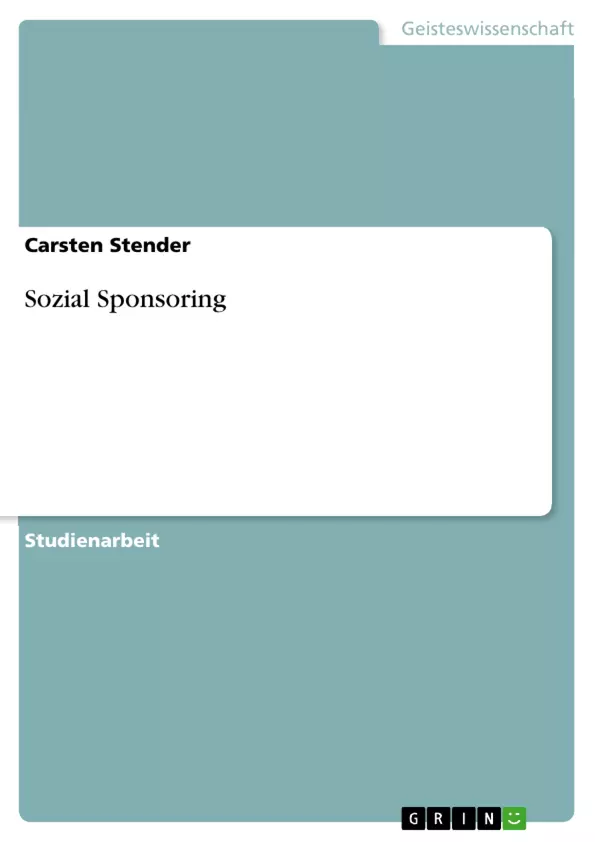Stehen soziale Organisationen am Scheideweg, gezwungen, innovative Finanzierungswege zu beschreiten, um ihre lebenswichtige Arbeit aufrechtzuerhalten? Diese tiefgründige Analyse beleuchtet das Sozialsponsoring als eine zunehmend relevante Strategie, um die wachsenden finanziellen Herausforderungen im sozialen Sektor zu bewältigen. Angesichts knapper öffentlicher Mittel und einer sich verändernden Spendenlandschaft, erkundet dieser Bericht die Potenziale und Feinheiten des Sozialsponsorings und bietet einen umfassenden Überblick über seine vielfältigen Aspekte. Von der Klärung grundlegender Begrifflichkeiten wie Sponsoring, Mäzenatentum und Spendenwesen, bis hin zur detaillierten Auseinandersetzung mit den Motiven sowohl der gesponserten Organisationen als auch der Sponsoren, werden die komplexen Dynamiken dieses Feldes präzise aufgeschlüsselt. Entdecken Sie, wie Sozialsponsoring nicht nur finanzielle Lücken füllt, sondern auch neue Möglichkeiten für soziale Träger eröffnet, ihre Arbeit zu professionalisieren, innovative Konzepte zu entwickeln und ihre Reichweite zu erhöhen. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Leistungen, die Anzahl der Sponsoren, die Art der Gegenleistungen und die spezifischen Felder des Sozialsponsorings, von der Unterstützung des Sozial- und Gesundheitswesens bis hin zur Förderung von Bildung und Wissenschaft. Ein besonderes Augenmerk gilt den steuerrechtlichen Grundlagen, die für soziale Organisationen von Bedeutung sind, um die finanziellen Auswirkungen des Sponsorings zu verstehen. Der abschließende Teil der Analyse widmet sich dem Planungsprozess eines Sponsorships und bietet einen detaillierten Stufenplan, der von der Situationsanalyse über die Zielbestimmung und die Festlegung von Grundsätzen bis hin zur Realisierung und Auswertung reicht. Diese Arbeit dient als unverzichtbarer Leitfaden für soziale Organisationen, die Sozialsponsoring als Instrument zur nachhaltigen Finanzierung und Weiterentwicklung ihrer Arbeit in Betracht ziehen, um im Wettbewerbsumfeld bestehen zu können. Es analysiert die Möglichkeit der Existenzsicherung durch Sponsoring im Sozialwesen, die oft vernachlässigten Chancen für NGOs und NPOs im Fundraising-Bereich, und das oft übersehene Marketing-Potential für Unternehmen, die Social Responsibility übernehmen und gleichzeitig ihr Employer Branding stärken wollen.
Social Sponsoring
Einleitung
Ziel dieser Arbeit ist es einen Überblick über Sozialsponsoring als zusätzliche Möglichkeit der Finanzierung sozialer Organisationen zu geben. Ich halte die Auseinandersetzung mit diesem Thema deshalb für sehr wichtig, weil solche oder ähnliche Arten der Finanzierung, aufgrund der zunehmenden Kürzungen im sozialen Bereich, immer stärker an Bedeutung gewinnen werden, wodurch womöglich auch mehr Freiräume für die sozialen Träger entstehen, die zu einer weiteren Professionalisierung der Sozialarbeit beitragen könnten.
Im ersten Teil der Arbeit werde ich mich mit den, diesem Thema zugrunde liegenden, Begrifflichkeiten beschäftigen um anschließend näher auf die einzelnen Aspekte des Sozialsponsorings eingehen zu können. Der letzte Teil beinhaltet die phasenweise Schilderung eines möglichen Vorgehens bei der Planung eines Sponsorships.
1. Begriffsklärung
1.1 Was ist Sponsoring
Der Begriff Sponsor kommt aus dem Englischen und bedeutet soviel wie Gönner, Förderer oder Geldgeber. Aus Sicht der Unternehmen beinhaltet Sponsoring die „Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten, die mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln oder Dienstleistungen durch Unternehmen zur Förderung von Personen und/oder Organisationen verbunden sind, um damit gleichzeitig Ziele der Unternehmenskommunikation zu erreichen.“ (Bruhn 1991, 21) Sponsoring zielt also auf einen Imagetransfer zugunsten des Sponsors ab, erfüllt für den Gesponsorten den Zweck der Mittelbeschaffung und ist zudem Instrument der Unternehmenskommunikation. Die Basis für ein Sponsoring bildet das Prinzip von Leistung und Gegenleistung d.h. der Sponsor setzt Kapital oder Sachmittel ein und erwartet dafür vom Gesponsorten imagefördernde Gegenleistungen wie z.B. die Öffentlichmachung der Förderung durch den Gesponsorten mittels Bereitstellung von Werbeflächen. Mögliche Sponsoringbereiche sind Sport-, Kultur-, Öko- und Sozialsponsoring.
1.2 Mäzenatentum und Spendenwesen
M ä zenatentum: Mäzen haben im klassischen Sinne ausschließlich selbstlose Motive für ihre Förderungen, es liegen also keine kommerziellen Absichten zugrunde. Beispielhaft heißt das, ein Mäzen gibt seine Unterstützung auch dann, wenn sein Name nicht mit der Förderung in Zusammenhang gebracht wird. Man kann folglich sagen, dass sich Mäzen aus innerer Überzeugung für andere Menschen engagieren. „Mäzenatentum schließt zwar eine image- fördernde Publizität nicht aus, ist jedoch nicht auf diese hin angelegt.“ (Schiewe 1995, S.20) Geschichtlich betrachtet ist letztlich das Inkognito des Gönners das wesentliche Merkmal. Spendenwesen: Spenden sind im allgemeinen Förderungen, die im Bewusstsein gesell- schaftlicher Verantwortung geleistet werden. Obwohl es sich hierbei, wie beim Mäzenaten- tum, ebenfalls um eine Leistung handelt die keine Gegenleistung erfordert, beweist die Praxis jedoch oftmals das Gegenteil z.B. eine Ruhebank im Park, die mit einer kleinen Infotafel versehen ist. Dies wird als professionalisiertes Spendenwesen bezeichnet, wobei es darüber allerdings keinen Vertrag geben darf. Zusammenfassend liegt der Unterschied zum Sponsoring darin, dass die Spende ein Geschenk und das Sponsoring ein Geschäft ist.
1.3 Definition Sozialsponsoring
Die oben genannte Definition des Sponsorings ist nicht ohne weiteres auf den sozialen Bereich übertragbar, denn obwohl die Sponsoren nicht uneigennützig sind dominiert beim Sozialsponsoring in erster Linie der Fördergedanke. Sozialsponsoring bedeutet „die Verbesserung der Aufgabenerfüllung im sozialen Bereich durch die Bereitstellung von Geld- Sachmitteln oder Dienstleistungen durch Unternehmen, die damit auch (direkt oder indirekt) Wirkungen für ihre Unternehmenskultur und -kommunikation erzielen wollen“ (Bruhn 1990, S.14) und obwohl der Sponsor für seine Förderung eine Gegenleistung erwartet, hat dieser jedoch keinen Einfluss auf die Ausgestaltung der gesponserten Arbeit. Zu den Beteiligten am Sozialsponsoring gehören neben den Sozialorganisationen und den Unternehmen, der Staat als Gesetzgeber und häufig auch Agenturen, die als Vermittler und Berater des Sponsorships fungieren.
2. Sozialsponsoring
2.1 Motive der Gesponsorten
Die Motive, die dem Entschluss einen Sponsorship als zusätzliche Finanzierungsquelle zu nutzen zu Grunde liegen sind vielfältig. Ein Motiv stellt die Tatsache dar, dass die sozialen Organisationen nicht (oder noch nicht) gewinnorientiert arbeiten. Desweiteren sind Bund, Länder und Kommunen aufgrund knapper Kassen zunehmend auf Sparkurs, was sich natürlich negativ auf die zur Verfügung gestellten Geld- und Sachmittel für die sozialen Organisationen auswirkt. Dadurch wird es besonders für kleinere Projekte, deren neue Konzepte in der Öffentlichkeit womöglich noch nicht sehr bekannt oder anerkannt sind, nahezu unmöglich eine geeignete Form der Finanzierung zu finden. Ein weiteres Motiv resultiert aus der sinkenden Spendenbereitschaft der Bevölkerung, welcher die wirtschaftliche Rezession zu Grunde liegt. Den ebengenannten Gründen aber steht ungleich die ständige Zunahme von sozialen Problemen gegenüber, die nur durch ein eng geknüpftes Netz sozialpädagogischer Hilfeangebote abgefedert werden können - dies jedoch erfordert auch einen ausreichenden finanziellen Background, der immer weniger gewährleistet ist. Aus diesen Gründen ist es für die sozialen Organisationen unerlässlich neben den Geldern aus öffentlicher Hand nach weiteren, ergänzenden Finanzierungsquellen zu suchen - wobei zu bedenken ist, dass sich aus diesen zusätzlichen Mitteln längerfristig keine laufenden Kosten decken lassen da dies von den sponsernden Unternehmen nicht medienwirksam vermarktet werden kann.
2.2 Motive des Sponsors
Um einen erfolgreichen Sponsorship zu gewährleisten sollte es auch für Mitarbeiter sozialer Organisationen von Interesse sein, sich vor allem im Vorfeld etwaiger Vertragsverhandlungen mit den Motiven des Sponsors auseinanderzusetzen. Im folgenden werde ich, um den Bogen nicht zu überspannen, nur kurz und in Form von Stichpunkten mögliche Motive des Sponsors aufzählen. Die Unternehmen können:
- die Gefahr von Streuverlusten ausschließend, ohne Umwege über Printmedien o.ä. direkten Käuferkontakt aufnehmen
- ihr Image verbessern / den Bekanntheitsgrad steigern
- gesellschaftliche Verantwortung übernehmen
- den Geförderten helfen
- ihre Mitarbeiter motivieren d.h. diese können sich durch die soziale Verantwortung, die das Unternehmen übernimmt, womöglich stärker mit diesem identifizieren
2.3 Neue Möglichkeiten durch Sozialsponsoring
Ein Sponsorship beugt nicht nur finanziellen Notsituationen vor oder löst diese, sondern eröffnet den sozialen Organisationen auch neue Möglichkeiten, die zu einer weiteren Professionalisierung der Arbeit beitragen können. So kann sich durch die Einnahmen aus einem Sponsoring der finanzielle Spielraum eines Trägers womöglich so erweitern, dass dieser im weiteren unabhängiger von Entscheidungen des Bundes o.ä. zu handeln in der Lage ist. Zudem können durch die zusätzlichen Mittel neue Aufgaben übernommen und neue Arbeitsplätze geschaffen werden z.B. durch die Erweiterung des Hilfeangebotes oder die Arbeit mit anderen Zielgruppen. Desweiteren kann ein Sponsorship ein Impulsgeber sein um neue Konzepte und Methoden in der Sozialarbeit zu entwickeln und diese öffentlich bekannt machen - gerade hierbei könnte ein besonderer Reiz für die Unternehmen liegen, da sich ungewöhnliche und neue Projekte oftmals besser vermarkten lassen. Abschließend besteht die Möglichkeit durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit die mit dem Sponsoring gesammelten Erfahrungen in die weitere Professionalisierung der Sozialarbeit einfließen zu lassen und den Bekanntheitsgrad der Einrichtung zu erhöhen - wodurch vielleicht auch die Spendenbereitschaft der Bevölkerung erhöht werden kann.
2.4 Voraussetzungen
Vor dem Abschluß eines Sponsorships sollten sich die sozialen Organisationen über bestimmte Voraussetzungen, auf die ich im folgenden näher eingehen werde, im klären sein.
Art und Umfang der Leistung
Obwohl beim Sozialsponsoring in der Regel finanzielle Zuwendungen dominieren sollten die sozialen Organisationen prüfen inwiefern auch andere Möglichkeiten der Förderung für sie in Frage kommen könnten. Eine Möglichkeit wäre, dass das sponsernde Unternehmen Sachmittel zur Förderung zur Verfügung stellt z.B. einen Computer zur Bewältigung der Verwaltungsaufgaben. Desweiteren können Unternehmen als Leistungsart auch ihr Know- how als Dienstleistung anbieten z.B. wenn eine Internetfirma einer sozialen Organisation bei der Erstellung einer Homepage behilflich ist. Eine letzte oft praktizierte Möglichkeit ist die, dass ein Unternehmen ein Teil des Erlöses, vom Verkauf eines Produktes aus eigener Produktion, einem sozialen Zweck zur Verfügung stellt z.B. Verkaufsaktionen, in denen 2,- DM pro verkaufter CD an die Organisation gehen.
Anzahl der Sponsoren
Je nach Anzahl der beteiligten Sponsoren spricht man von „Exklusiv- und Co-Sponsorships“. Beim „Exklusiv-Sponsorship“ wird dem Sponsor durch seine Dominanz der Eindruck vermittelt, dass das etwaige Projekt nur durch seine Zuwendung überhaupt verwirklicht werden konnte - wodurch womöglich dessen Spendenbereitschaft noch erhöht wird. Im Gegensatz dazu müssen sich die Sponsoren, bei der Beteiligung mehrerer, die Imagewirkung für das Unternehmen teilen, was ein Sponsorship nicht sehr attraktiv erscheinen lässt. Daher ist in der Praxis das „Exklusiv-Sponsoring“ auch häufiger anzutreffen.
Art der Gegenleistung
Die für das Sponsoring vom Unternehmen erwarteten Gegenleistungen können wie folgt unterschieden werden. Zum einen in aktive Gegenleistungen - z.B. dadurch das der soziale Träger das Unternehmen in Pressemitteilungen oder bei Veranstaltungen erwähnt und zum anderen in Gegenleistungen als passive Duldung, die darin bestehen könnte, dass das Unternehmen mit seiner Förderung bzw. mit der unterstützten Organisation in den Medien wirbt. Bei den Arten der Gegenleistungen dominiert die der passiven Duldung.
2.5 Felder des Sozialsponsorings
Das Sozialsponsoring ist derzeit hauptsächlich im Bereich des Sozial- und Gesundheitswesens sowie in Bildung und Wissenschaft präsent. Im folgenden werde ich erläutern in welcher Form sich diese Präsens in den beiden Bereichen darstellt.
Sozial- und Gesundheitswesen
Dieser Bereich bezieht sich vorrangig auf Gesundheitsfürsorge, Behandlung von Krankheiten, Katastrophenhilfe, Integration benachteiligter Gruppen sowie auf die Wohlfahrtspflege und deren Träger. Nach Meinung Bruhn`s (Bruhn 1990, S.22) kann man hierbei 5 typische Formen hervorheben:
- die Unterstützung sozialer Organisationen durch Geldmittel d.h. das soziale Engagement der Unternehmen drückt sich durch finanzielle Zuwendungen aus;
- die Gründung unternehmenseigener Stiftungen d.h. dabei werden durch das Stiftungs- kapital gezielt soziale Aufgaben übernommen;
- Beitragsleistungen durch unternehmenseigene Produkte - wird vor allem von High- tech Firmen genutzt, die mittels technischer Unterstützung die Effizienz sozialer Aufgabenerfüllung steigern
- die Präsenz der Unternehmen bei Wohltätigkeitsveranstaltungen d.h. die Unternehmen können als offizieller Sponsor oder als Mitveranstalter in Erscheinung treten;
- das Engagement der Medien z.B. durch Rundfunkanstalten, die mittels gezielter Spendenaufrufe in Funk und Fernsehen als Sponsoren auftreten.
Bildung und Wissenschaft
Dieser Bereich bezieht sich auf Aus- und Weiterbildungen, Umschulungen in Schulen, Ausbildungsstätten oder Hochschulen sowie Erwachsenenbildung und wissenschaftliche Forschung. Die 4 typischen Erscheinungsformen sind hierbei:
- die Ausstattung von Ausbildungseinrichtungen - umfasst die Bereitstellung von Lehrmaterial, Stipendien, Finanzierung von Dozenten und Lehren etc. ;
- die Förderung von Forschungsprojekten, die aus Finanz- und Sachmitteln bestehen kann z.B. die Gewährung von Druckkostenzuschüssen für wiss. Arbeiten;
- die Gründung und Finanzierung unternehmenseigener Forschungsinstitutionen - vorrangig größere Unternehmen widmen sich so selbstausgewählten Forschungsschwerpunkten z.B. Shellstudie;
- die Ausschreibung von Wettbewerben zur Förderung von Forschung und Lehre d.h. Unternehmen stiften Forschungspreise und erzielen durch die Verbindung mit ihrem Namen einen werbewirksamen Effekt.
2.6 Steuerrechtliche Grundlagen
Im Gegensatz zur Spende ist das Sozialsponsoring für soziale Organisationen eine steuerpflichtige Einnahme - folglich sind Spenden rechnerisch natürlich attraktiver. Für die Unternehmen hingegen liegt der Vorteil klar beim Sponsoring, denn solang dies nachweislich der Werbung dient können die Firmen die Zuwendungen als Betriebsausgaben geltend machen. Jedoch genau dies veranlasst die Finanzverwaltungen, zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen, dazu Sponsoringeinnahmen der sozialen Organisationen zu versteuern. Nimmt also eine Organisation eine Unterstützung als Sponsoring an, gilt sie bei den Finanzbehörden nach § 14 der Abgabenverordnung als „wirtschaftlicher Geschäfts- betrieb“ der steuerpflichtig ist. Genauer gesagt sind Sponsoringgelder aber erst dann wirklich steuerpflichtig, wenn der Gesamtumsatz den Freibetrag von jährlich 60.000,-DM über- schreitet. Jedoch gilt für Vereine, die die Freigrenze überschreiten die Möglichkeit einen zusätzlichen Freibetrag von jährlich 7.500,-DM in Anspruch zu nehmen. Zudem können Betriebsausgaben die unmittelbar mit dem Sponsoring getätigt würden, abgezogen werden. Abschließend scheint das sinnvollste für eine soziale Organisation ein Sponsoring-Spenden Mix zu sein d.h. beispielhaft, wenn eine Organisation zur Finanzierung eines größeren Projektes viel Geld benötigt, sollte sie einerseits eine große Spendenaktion starten und sich zudem nach einer kleineren Sponsoringsumme umsehen, die unter dem Freibetrag liegt, damit vom benötigten Geld nicht noch notwendiges abgeführt werden muss.
3. Planungsprozess eines Sponsorships
Im folgenden werde ich nun auf den für mich wichtigsten und zugleich umfangreichsten Teil dieser Arbeit eingehen - den Planungsvorgang.
Um einen effektiven und sinnvollen Sponsorship zu gewährleisten sind für die Beteiligten Mitarbeiter einer sozialen Organisation einige Gesichtspunkte zu beachten. Die nachfolgende Übersicht stellt einen beispielhaften Stufenplan (Schiewe 1995, S.73) dar, der als Orientierungshilfe dienen und ein Überblick über ein mögliches Vorgehen bei der Organisation eines Sponsorships geben soll - im weiteren werde ich diesen Schritt für Schritt erläutern.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.1 Situationsanalyse
Eine Situationsanalyse sollte 3 Punkte beinhalten: eine Grundsatzentscheidung darüber, ob ein Sponsorship überhaupt sinnvoll ist, die Beschreibung des zu sponsernden Projektes und die Klärung, ob man die Hilfe einer Sponsoringagentur benötigt.
Grundsatzentscheidung
Am Anfang sollte die Frage stehen, ob ein Sponsoring für die Organisation eine geeignete Finanzierungsmaßnahme darstellt - sinnvoll ist es hierbei, sich in die Lage des Unternehmens zu versetzen und zu prüfen, ob das geplante Projekt für den Sponsor neu, interessant oder wichtig sein könnte bzw. inwiefern sich wirtschaftliche Interessen damit umsetzen lassen. Viel wichtiger ist aber ein objektives abwägen von Vor- und Nachteilen eines möglichen Sponsorships. Genauer gesagt ist hierbei zu prüfen:
- ob es für Träger und Mitarbeiter generell tragbar ist, dass das sponsernde Unternehmen einen wirtschaftlichen Nutzen aus seiner Unterstützung zieht und inwiefern dies mit dem Selbstverständnis der Organisation vereinbar ist,
- ob die soziale Organisation finanziell wie auch inhaltlich ihre Unabhängigkeit bewahren kann,
- welche Formen der Mischfinanzierung, ob der Gefahr der Mittelkürzung durch staatl. Stellen, wünschenswert und möglich sind,
- welche Erwartungen oder Befürchtungen die Gesponserten bei Öffentlichmachung der Förderung haben d.h. beispielhaft, ob sich womöglich ein negatives Image des Unternehmens demotivierend auf die Mitarbeiter auswirkt (aufgrund fehlender Identifikation).
Wichtig für die Situationsanalyse ist zudem, die Stärken und Schwächen der Organisation und ihrer Arbeit einzuschätzen um auf einer realistischen Basis an den Sponsor herantreten zu können. Abschließend sollte ein ungefährer Finanzbedarf zu ermittelt werden, welcher dem Sponsor für dessen Kalkulation mitgeteilt werden kann.
Projektbeschreibung
Um dem Sponsor das geplante Projekt als Angebot zu unterbreiten ist es sinnvoll, dies in einer Broschüre o.ä. zusammenzufassen. Inhalt dieser Broschüre sollte nach Möglichkeit eine Vorstellung der Organisation, des Trägers und des Kontextes der erbrachten sozialen Arbeit, Idee und Zielgruppe, Leitung, Termine und Kosten sein. Alles in allem sollte sich der Sponsor durch die Beschreibung einen Überblick über das Vorhaben verschaffen können.
Einbezug einer Sponsoringagentur
Im Vorfeld des Planungsvorgangs sollte geprüft werden, ob die Organisation grundsätzlich auch in der Lage ist einen Sponsorship allein vorzubereiten oder ob es eventuell sinnvoll sein könnte, die Unterstützung einer Sponsoringagentur in Anspruch zu nehmen - wobei jedoch die dafür anfallenden Kosten bedacht werden sollten. Daher ist dies oftmals nur zweckmäßig, wenn es sich um ein größeres Vorhaben mit entsprechend hohen Sponsoringsummen handelt.
3.2 Zielbestimmung
Um zu gewährleisten, dass der Sponsorship nicht hauptsächlich nur dem Unternehmen Vorteile verschafft, ist es besonders wichtig die, später in die vertraglichen Vereinbarungen einfließenden, Ziele und Erwartungen klar zu bestimmen.
Eigene Ziele und Erwartungen
Die Zielbestimmung sollte genau beschreiben, wie viel Geld wofür gebraucht wird - dies umfasst präziser die Ermittlung des Bedarfs an Geld-, Sach- und Dienstleitungen sowie des mittel- bis langfristigen Anteils der Sponsoringeinnahmen an den Gesamteinkünften. Mögliche Projektziele könnten abschließend z.B. die Erweiterung des bisherigen Aufgabenbereiches oder die Schaffung neuer Hilfeangebote für bestimmte Zielgruppen sein.
3.3 Grundsätze
Vor dem Beginn der Vertragsverhandlungen ist es von besonderer Bedeutung, dass die Mitarbeiter und der Träger einer sozialen Organisation die Bedingungen und Grundsätze einer zukünftigen Kooperation klären.
Auswahl des Unternehmens
Bei der Vorauswahl des in Frage kommenden Unternehmens ist es sinnvoll der Entscheidung Kriterien wie z.B. Größe, Image, Produktpalette oder Standort des Unternehmens zu Grunde zu legen. Desweiteren sollte geprüft werden, inwiefern vielleicht schon bestehende Kontakte zu Unternehmen ausbaufähig sind oder ob im Projektfeld tätige Unternehmen (z.B. Lieferanten) möglicherweise in Frage kommen könnten. Zur Erleichterung der Auswahl kann zudem ein Beurteilungskatalog (Schiewe 1995, S.81) hilfreich sein. Dieser könnte z.B. folgende Kriterien enthalten:
- Akzeptanz der Mitarbeiter und des Leistungsprogramms
- Bedeutung des Unternehmens in der Region
- Höhe der Sponsorenbeträge
- Umfang materieller Unterstützung etc.
Anforderungen an Sponsoren
Zur Vorbereitung des Sponsorships ist es auch wichtig, rechtzeitig die genauen Anforderungen an den Sponsor und die Bedingungen für die Zusammenarbeit festzulegen.
Dazu gehören beispielsweise die Dauer des Engagements, die Art der Vertraglichen Bindung, die Anzahl der Sponsoren, die Vergabe eines Logos und Art und Umfang der Leistungen. Das Resultat dieser Festlegungen sollte als „Sponsoring-Grundsätze“ schriftlich niedergelegt werden, wodurch letztlich die Aufstellung einer „Sponsorenrangliste“ denkbar wäre.
3.4 Realisierung
Mit den bisher genannten 3 Stufen ist der grobe Rahmen für einen Sponsorship abgesteckt. Im folgenden werde ich nun genauer auf die Konkretisierung und Umsetzung eingehen.
Kontaktaufnahme
Um die entsprechenden Entscheidungsträger (Marketing-, Werbe- oder PR-Abteilungen) für einen Sponsorship zu gewinnen ist es wichtig, vorab einige Informationen über das Unternehmen zu sammeln (eventuell ist dies bei der Auswahl des Unternehmens schon geschehen), dies erleichtert womöglich den Einstieg in die Verhandlungen. Besonders wichtig ist, dass in den Gesprächen deutlich wird, warum dieses Unternehmen ausgewählt wurde und welchen Nutzen es aus einer möglichen Zusammenarbeit ziehen könnte. Da Unternehmen oftmals wenig über soziale Arbeit wissen, ist es sinnvoll das Vorhaben und damit verbundene Informationen über den Träger o.ä. auch für Laien verständlich darzustellen. Das wichtigste bleibt jedoch, den Nutzen für den Sponsor deutlich hervorzuheben.
Verhandlungen
Für die Verhandlungen mit dem potentiellen Sponsor sollte der dafür Verantwortliche der sozialen Organisation über gewisse Kenntnisse im Steuer- und Vertragsrecht sowie über Erfahrungen im Umgang mit Medien verfügen. Zudem sollten, aufgrund der unklaren Rechtsauslegung, im vorab alle wichtigen Fragen mit dem Finanzamt geklärt sein. Mittelpunkt der Verhandlungen sind Leistungen und Gegenleistungen d.h. einerseits die Kosten für das geplante Projekt und zum anderen die Angebote der sozialen Organisationen. Gegenleistungen sollten grundsätzlich nur Maßnahmen sein, die die Organisationen auch reell erbringen kann und will d.h. es ist sinnvoll schriftlich zu fixieren, wie viel Kommunikation- sarbeit seitens der Einrichtung zu erbringen ist und auszuschließen, dass der Sponsor inhaltlich in das Projekt eingreift.
3.5 Auswertung
Ziele und Wirkungen
Für die weitere Arbeit einer sozialen Organisation ist es ratsam am Ende des Sponsorships eine Evaluation durchzuführen und zu prüfen, welche Wirkungen das Sponsoring hatte und welche Ziele erreicht worden sind. Hierbei empfiehlt es sich beispielsweise einen Presse- spiegel über den Verlauf des Sponsorships zu erstellen um an Hand dessen zu prüfen, ob das Projekt erfolgreich war und in welcher Form ggf. die Öffentlichkeit darauf reagiert hat; zudem könnte sich eine solche Verlaufsübersicht hilfreich für andere, in der Planung befindliche, Einrichtungen erweisen.
Schlußteil
In Anbetracht ständig sinkender Zuschüsse und Förderungen durch staatliche Stellen und steigender sozialer Probleme ist es den sozialen Trägern immer weniger möglich adäquate und professionelle Arbeit zu leisten bzw. diese zu finanzieren. Insofern ist Sozialsponsoring eine sinnvolle Möglichkeit diesen Mehrbedarf an finanziellen und materiellen Aufwendungen zu decken, vor allem aufgrund des vergleichsweise geringfügigen „Kraftaufwandes“, der nötig ist um eine angemessene Gegenleistung für die Förderung zu erbringen.
Literaturverzeichnis
Schiewe, Kirstin; „Sozialsponsoring - Ein Ratgeber“, Lambertus Verlag 1995
Bruhn, Manfred; „Sozio- und Umweltsponsoring“, München 1990
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Arbeit über "Social Sponsoring"?
Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über Sozialsponsoring als eine zusätzliche Möglichkeit der Finanzierung sozialer Organisationen zu geben. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema wird als wichtig erachtet, da solche Finanzierungsarten aufgrund von Kürzungen im sozialen Bereich zunehmend an Bedeutung gewinnen könnten, wodurch mehr Freiräume für soziale Träger entstehen, die zu einer weiteren Professionalisierung der Sozialarbeit beitragen könnten.
Was versteht man unter Sponsoring im Allgemeinen?
Sponsoring beinhaltet die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten, die mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln oder Dienstleistungen durch Unternehmen zur Förderung von Personen und/oder Organisationen verbunden sind, um damit gleichzeitig Ziele der Unternehmenskommunikation zu erreichen. Es zielt auf einen Imagetransfer zugunsten des Sponsors ab, erfüllt für den Gesponsorten den Zweck der Mittelbeschaffung und ist Instrument der Unternehmenskommunikation. Es basiert auf dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung.
Wie unterscheidet sich Sozialsponsoring von Mäzenatentum und Spendenwesen?
Mäzenatentum basiert auf selbstlosen Motiven ohne kommerzielle Absichten. Spenden werden im Bewusstsein gesellschaftlicher Verantwortung geleistet, erfordern aber im Gegensatz zum Sponsoring keine explizite Gegenleistung (obwohl in der Praxis oft eine Form der Anerkennung stattfindet). Sozialsponsoring unterscheidet sich, da der Fördergedanke im Vordergrund steht, der Sponsor jedoch auch Wirkungen für seine Unternehmenskultur und -kommunikation erzielen will. Das Sponsoring ist ein Geschäft, während die Spende ein Geschenk ist.
Wie wird Sozialsponsoring definiert?
Sozialsponsoring bedeutet die Verbesserung der Aufgabenerfüllung im sozialen Bereich durch die Bereitstellung von Geld-, Sachmitteln oder Dienstleistungen durch Unternehmen, die damit auch (direkt oder indirekt) Wirkungen für ihre Unternehmenskultur und -kommunikation erzielen wollen. Der Sponsor erwartet eine Gegenleistung, hat aber keinen Einfluss auf die Ausgestaltung der gesponserten Arbeit.
Welche Motive haben soziale Organisationen für die Nutzung von Sozialsponsoring?
Soziale Organisationen nutzen Sozialsponsoring, um finanzielle Engpässe aufgrund von Kürzungen öffentlicher Mittel, sinkender Spendenbereitschaft und zunehmenden sozialen Problemen auszugleichen. Es ermöglicht ihnen, zusätzliche Mittel zu generieren, ohne gewinnorientiert arbeiten zu müssen.
Welche Motive haben Sponsoren, sich im Sozialsponsoring zu engagieren?
Unternehmen nutzen Sozialsponsoring, um direkten Käuferkontakt aufzunehmen, ihr Image zu verbessern, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, den Geförderten zu helfen und ihre Mitarbeiter zu motivieren.
Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich durch Sozialsponsoring?
Sozialsponsoring beugt finanziellen Notsituationen vor, erweitert den finanziellen Spielraum, ermöglicht die Übernahme neuer Aufgaben, die Schaffung neuer Arbeitsplätze, die Entwicklung neuer Konzepte und Methoden in der Sozialarbeit und die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Einrichtung.
Welche Voraussetzungen sollten vor dem Abschluss eines Sponsorships geklärt werden?
Es sollten die Art und der Umfang der Leistung (finanzielle Zuwendungen, Sachmittel, Dienstleistungen), die Anzahl der Sponsoren (Exklusiv- oder Co-Sponsorships) und die Art der Gegenleistung (aktive oder passive) geklärt werden.
In welchen Bereichen ist Sozialsponsoring hauptsächlich präsent?
Sozialsponsoring ist hauptsächlich im Bereich des Sozial- und Gesundheitswesens sowie in Bildung und Wissenschaft präsent.
Welche steuerrechtlichen Grundlagen sind beim Sozialsponsoring zu beachten?
Im Gegensatz zur Spende ist das Sozialsponsoring für soziale Organisationen eine steuerpflichtige Einnahme. Unternehmen können die Zuwendungen als Betriebsausgaben geltend machen, solange diese nachweislich der Werbung dienen. Sponsoringgelder sind erst dann steuerpflichtig, wenn der Gesamtumsatz den Freibetrag von jährlich 60.000,-DM überschreitet.
Welche Schritte sind bei der Planung eines Sponsorships zu beachten?
Der Planungsprozess umfasst eine Situationsanalyse (Grundsatzentscheidung, Projektbeschreibung, Einbezug einer Sponsoringagentur), Zielbestimmung (eigene Ziele und Erwartungen), Grundsätze (Auswahl des Unternehmens, Anforderungen an Sponsoren), Realisierung (Kontaktaufnahme, Verhandlungen) und Auswertung (Ziele und Wirkungen).
Was sollte eine Situationsanalyse beinhalten?
Eine Situationsanalyse sollte eine Grundsatzentscheidung darüber, ob ein Sponsorship überhaupt sinnvoll ist, die Beschreibung des zu sponsernden Projektes und die Klärung, ob man die Hilfe einer Sponsoringagentur benötigt, beinhalten.
Was sind wichtige Punkte bei der Zielbestimmung?
Bei der Zielbestimmung sollte genau beschrieben werden, wie viel Geld wofür gebraucht wird, einschließlich der Ermittlung des Bedarfs an Geld-, Sach- und Dienstleistungen sowie des mittel- bis langfristigen Anteils der Sponsoringeinnahmen an den Gesamteinkünften.
Was ist bei der Auswahl des Unternehmens zu beachten?
Bei der Vorauswahl des Unternehmens ist es sinnvoll, Kriterien wie Größe, Image, Produktpalette oder Standort des Unternehmens zu Grunde zu legen. Es sollte geprüft werden, inwiefern bestehende Kontakte ausbaufähig sind oder ob im Projektfeld tätige Unternehmen in Frage kommen könnten.
Was ist bei den Verhandlungen mit dem Sponsor zu beachten?
Der Verantwortliche der sozialen Organisation sollte über gewisse Kenntnisse im Steuer- und Vertragsrecht sowie über Erfahrungen im Umgang mit Medien verfügen. Es sollten alle wichtigen Fragen mit dem Finanzamt geklärt sein. Mittelpunkt der Verhandlungen sind Leistungen und Gegenleistungen.
Warum ist eine Auswertung am Ende des Sponsorships wichtig?
Eine Evaluation am Ende des Sponsorships ist ratsam, um zu prüfen, welche Wirkungen das Sponsoring hatte und welche Ziele erreicht worden sind. Es empfiehlt sich, einen Pressespiegel über den Verlauf des Sponsorships zu erstellen, um dessen Erfolg und die Reaktion der Öffentlichkeit zu prüfen.
- Quote paper
- Carsten Stender (Author), 2001, Sozial Sponsoring, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/102398