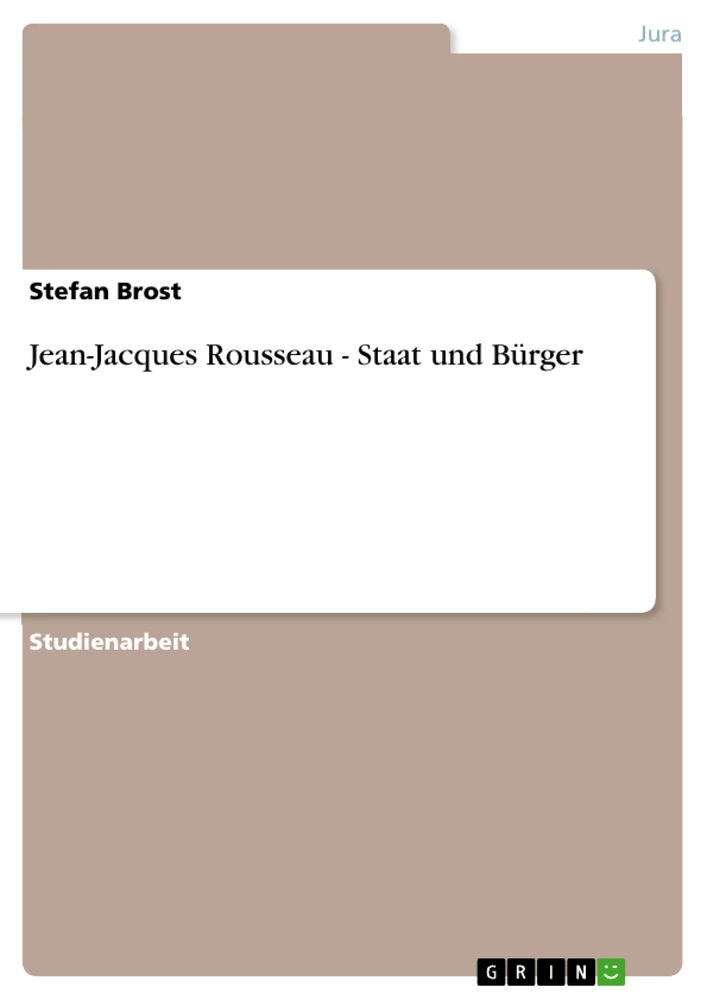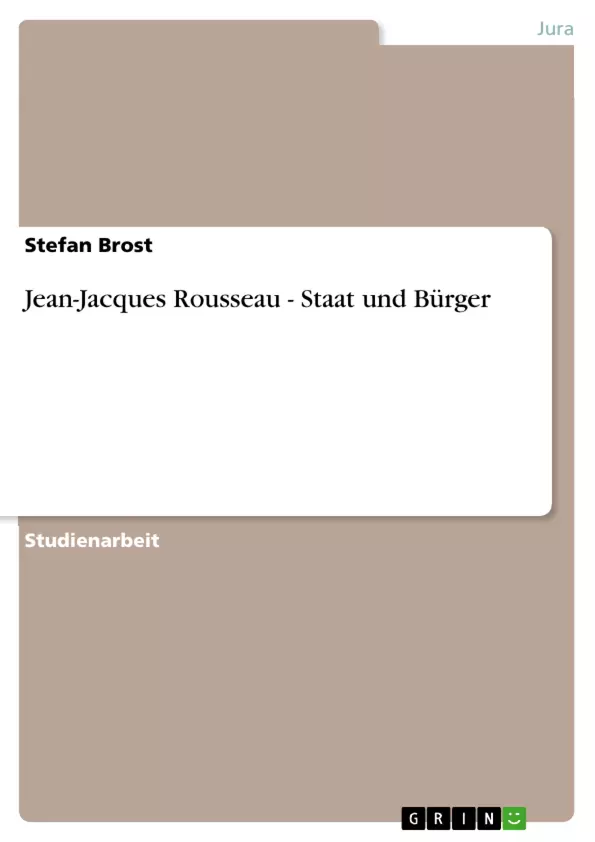Mit seinem 1762 in Amsterdam erschienenen Hauptwerk ,, Du contrat social ou principes du droit politique" hat der Schweizer Jean-Jacques Rousseau seiner Nachwelt den staatsphilosophischen Entwurf einer politischen Ordnung hinterlassen, der noch heute viele
Politikwissenschaftler, Philosophen, Historiker und Staatsrechtler durch seine logischnachvollziehbare Argumentation, aber gleichzeitige innere Widersprüchlichkeit zu sehr unterschiedlichen und gegensätzlichen Interpretationen verleitet.
In der nachfolgenden Arbeit möchte ich anhand der im Contrat Social (CS) verwendeten zentralen Begrifflichkeiten darstellen, wie sich Rousseau das Verhältnis des einzelnen Bürgers zum Staat und umgekehrt vorstellte.
Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit dem CS ist allerdings zunächst das rousseausche Menschenbild und seine persönliche Vorstellung davon, wie der Mensch von einem Natur- in einen staatlichen Zustand durch den Abschluß eines Gesellschaftvertrages gelangt ist ( II. Kapitel ).
Diese Vorbemerkungen sind wichtig für das Verständnis des CS und der Theorie eines allgemeinen Willens ( volonté générale ), deren zentrale Bedeutung für das gesamte Werk im III. Kapitel meiner Arbeit dargestellt wird. Dabei gehe ich zunächst der Frage nach, wie der allgemeine Wille in einer Gesellschaft zu bestimmen ist. Anschließend untersuche ich die verschiedenen Funktionen, die die volonté générale im rousseauschen System wahrnimmt.
Innerhalb dieses Kapitels gehe ich ferner auf die Rolle des Gesetzgebers und die der Zivilreligion ein. Der Allgemeinwille bildet auch die gedankliche Voraussetzung für einen zweiten Kernbegriff im CS, nämlich den der Souveränität, den ich im IV. Kapitel näher untersuchen werde. Im gleichen Kapitel stelle ich auch kurz die Regierungsformenlehre Rousseaus dar.
Abschließend beschäftige ich mich schließlich mit den inhaltlichen Widersprüchen des CS und der Kritik an Rousseaus politischer Theorie, die ihm von den verschiedensten Seiten entgegengebracht wurde.
GLIEDERUNG:
I. Einleitung
II. Ausgangslage und Grundproblem
1. Der Mensch im vorstaatlichen Zustand
2. Der Gesellschaftsvertrag
III. La volonté générale
1. Bezug und Bestimmung des allgemeinen Willens
2. Funktionen der volonté générale; Gesetzgebungsfunktion; Gleichheits- und Freiheitsgarantie; Ideelle Norm und Moralität
3. Vorrang der Mehrheit
4. Der Gesetzgeber und die religion civile; Der GesetzgeberDie Zivilreligion
IV. Der rousseausche Souveränitätsbegriff:
1. Unveräußerlichkeit
2. Unteilbarkeit
3. Grenze der Souveränität
4. Die Regierungsformen Demokratie, Aristokratie, Monarchie; Die gemischte und die gemäßigte Regierungsform
V. Kritik:
1. Das Konstitutionsproblem des Gesellschaftsvertrags
2. Totalitarismusvorwurf
3. Naturrecht und allgemeiner Wille
4. Wiederauferstehung der societas perfecta et completa ?
VI. Fazit:
LITERATURVERZEICHNIS:
Rousseau, Jean-Jacques; Der Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts, übersetzt und herausgegeben von Hans Brockard, Stuttgart 1977.
Sekundärliteratur:
Brandt, Reinhard; Rousseaus Philosophie der Gesellschaft, Stuttgart-Bad Cannstatt 1973. Derathé, Robert; Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris 1950. Fetscher, Iring; Rousseaus politische Philosophie, Neuwied 1960.
Glum, Friedrich; Rousseau Stuttgart
Groethuysen, Bernhard; Philosophie der Französischen Revolution
Hall, John C.; Rousseau - An Introduction to his Political Philosophy, Plymouth 1973.
Herb, Karl Friedrich; Rousseaus Theorie legitimer Herrschaft - Voraussetzungen und Begründungen, Würzburg 1989.
Isensee, Josef, Die alte Frage nach der Rechtfertigung des Staates, in: JZ 1998, S. 265-278. Kersting, Wolfgang; Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrags, Darmstadt, 1996. Maier, Hans; Die Klassiker des politischen Denkens, 2. Band, München 1968.
Maluschke, Günther; Philosophische Grundlagen des demokratischen Verfassungsstaates, Freiburg/München 1982.
Mayer-Tasch, Peter Cornelius; Hobbes und Rousseau, Aalen 1976.
Riley, Patrick; Rousseau´s General Will: Freedom of a Particular Kind, in: Political Studies 1991, p. 54ff.
ders.; A possible explanation of Rousseau´s general will, in: The American Political Science Review, Vol. 64 (1970), p. 87ff.
Ritzel, Wolfgang; Jean-Jacques Rousseau, Stuttgart 1959.
Russell, Bertrand; Philosophie des Abendlandes, Wien 1975.
Schmitt, Carl; Die Diktatur, München-Leipzig, 1928.
ders.; Verfassungslehre, Berlin 1928.
Talmon, J.T.; Die Ursprünge der totalitären Demokratie, Köln und Opladen 1961. Weinstock, Heinrich; Die Tragödie des Humanismus, 5. Auflage; Heidelberg 1967. Welzel, H. Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Göttingen 1962.
Willms, Bernard; Die politischen Ideen von Hobbes bis Ho Tschi Minh, Stuttgart-Berlin- Köln-Mainz 1971.
I. Einleitung:
Mit seinem 1762 in Amsterdam erschienenen Hauptwerk ,, Du contrat social ou principes du droit politique" hat der Schweizer Jean-Jacques Rousseau seiner Nachwelt den staatsphilosophischen Entwurf einer politischen Ordnung hinterlassen, der noch heute viele Politikwissenschaftler, Philosophen, Historiker und Staatsrechtler durch seine logisch- nachvollziehbare Argumentation, aber gleichzeitige innere Widersprüchlichkeit zu sehr unterschiedlichen und gegensätzlichen Interpretationen verleitet.
In der nachfolgenden Arbeit möchte ich anhand der im Contrat Social (CS) verwendeten zentralen Begrifflichkeiten darstellen, wie sich Rousseau das Verhältnis des einzelnen Bürgers zum Staat und umgekehrt vorstellte.
Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit dem CS ist allerdings zunächst das rousseausche Menschenbild und seine persönliche Vorstellung davon, wie der Mensch von einem Natur- in einen staatlichen Zustand durch den Abschluß eines Gesellschaftvertrages gelangt ist ( II. Kapitel ).
Diese Vorbemerkungen sind wichtig für das Verständnis des CS und der Theorie eines allgemeinen Willens (volonté générale), deren zentrale Bedeutung für das gesamte Werk im
III. Kapitel meiner Arbeit dargestellt wird. Dabei gehe ich zunächst der Frage nach, wie der allgemeine Wille in einer Gesellschaft zu bestimmen ist. Anschließend untersuche ich die verschiedenen Funktionen, die die volonté générale im rousseauschen System wahrnimmt. Innerhalb dieses Kapitels gehe ich ferner auf die Rolle des Gesetzgebers und die der Zivilreligion ein. Der Allgemeinwille bildet auch die gedankliche Voraussetzung für einen zweiten Kernbegriff im CS, nämlich den der Souveränität, den ich im IV. Kapitel näher untersuchen werde. Im gleichen Kapitel stelle ich auch kurz die Regierungsformenlehre Rousseaus dar.
Abschließend beschäftige ich mich schließlich mit den inhaltlichen Widersprüchen des CS und der Kritik an Rousseaus politischer Theorie, die ihm von den verschiedensten Seiten entgegengebracht wurde.
II. Ausgangslage und Grundproblem:
1. Der Mensch im Natur- und Gesellschaftszustand:
Rousseaus neues Bild vom Menschen und seine Lehre vom Naturzustand unterscheiden sich grundlegend von der Konstruktion eines Thomas Hobbes[1]: War für Hobbes der Mensch
zugleich des Menschen Wolf, geht Rousseau davon aus, daß der Mensch von Natur aus gut ist[2]. Zwar verkennt auch er nicht, daß zwischen den Menschen Ungleichheit besteht und der Mensch dazu neigt, über die anderen herrschen zu wollen. Der Grund für diese faktische Ungleichheit liegt für Rousseau aber im gesellschaftlichen und nicht im natürlichen Zustand.
Denn der Gesellschaftszustand bedeutet für ihn nichts anderes als die Korruption des Naturzustandes[3].
Um Rousseaus Ansicht nachvollziehen zu können, muß man seinen Entwurf eines Naturzustandes des Menschen näher betrachten.
Der Mensch in seinem Urzustand ist für Rousseau ein instinktives, nur potentielles Vernunftwesen[4], das nicht von einem Vernunft voraussetzenden Naturrecht, sondern von zwei sich ergänzenden Gefühlsprinzipien, der natürlichen Selbstliebe (amour de soi) und dem Mitleid (pitié) geleitet wird[5]. Die Selbstliebe des Naturmenschen dient in erster Linie seiner individuellen Selbsterhaltung. Das Mitleid bestimmt den Menschen ferner als sensibles und
sentimentales Wesen gegenüber seinen Mitmenschen und dient dadurch der Erhaltung der Gattung Mensch. In der hier erwähnten ersten Phase des rousseauschen Naturzustandes ist der einsame, für sich selbst lebende Ur-Mensch zudem durch seine natürliche Unabhängigkeit (indépendance), Gleichheit und Freiheit gekennzeichnet. Jedoch ist dem Menschen sein natürliche Unabhängigkeit noch nicht bewußt. Dazu fehlt ihm im Urzustand das Vermögen des Selbstbewußtseins[6]. Der Mensch im Urzustand lebt ungesellig für sich, verhält sich gleichgültig gegenüber allen anderen Menschen und kennt so weder moralische Beziehungen noch Pflichten[7]
Ein Selbstbewußtsein erlangt der Mensch erst beim Übergang in den geselligen Zustand. Diesen Schritt macht der Mensch bei Rousseau nicht von sich aus, sondern er wird durch äußere Umstände, wie Klimaänderungen oder die wachsende Population, dazu gezwungen, sich mit seinen Mitmenschen zusammenzuschließen[8]. Mit der unfreiwilligen Sozialisation des ehemals isoliert lebenden Urmenschen erlangt auch erstmals die natürliche Ungleichheit des Menschen Bedeutung (s.o.). Durch den Kontakt mit anderen Menschen beginnen die einzelnen Individuen, sich miteinander zu vergleichen. Es entsteht beim Einzelnen der Wunsch sich zu unterscheiden, sich z.B. durch Privateigentum vom anderen abzuheben. Aus Neid und Eifersucht entwickelt sich so die natürlichen Selbstliebe des Menschen durch das gesellschaftliche Zusammenleben in ein neues, künstliches Gefühl - die Selbstsucht (amour propre).
Mit dem soeben beschriebenen gesellschaftlichen Zusammenschluß hat der Mensch allerdings noch keinen staatlichen Zustand erreicht. Rousseau unterscheidet im Gegensatz zu früheren
Denkern vielmehr zwei verschiedene Stadien eines vorstaatlichen Zustands: Zum einen ein paradiesisches Urmenschen-Dasein und zum anderen eine durchaus der hobbesianischen Konzeption ähnliche Konkurrenz- und Wettbewerbsgesellschaft[9].
2. Der Gesellschaftsvertrag:
Der freie, unabhängige Urzustand ist für Rousseau nach dem Besagten durch die menschliche Entwicklung für immer verloren. Die Geschichte der Menschen ist so zwangsläufig zu einer Geschichte der menschlichen Leidenschaften und Partikularinteressen geworden.
Wie kann der Mensch vom Natur- in einen staatlichen Zustand gelangen, wenn aufgrund der amour propre jeder sein eigenes Interesse zu verfolgen sucht ? Ähnlich wie Hobbes macht sich Rousseau gerade dieses Selbstinteresse der Vielen zu Nutzen. Er sieht darin die Antriebskraft für einen Sozialvertrag. Denn ohne einen solchen müßte jeder Einzelne um seine Selbsterhaltung fürchten. Nur durch die künstlich-politische Überwindung des Naturzustandes kann sich somit der Mensch vor seinem eigenen Untergang retten[10]
Da der Mensch im Urzustand frei und unabhängig ist[11], stellt sich mit dem Übertritt in den staatlichen Zustand für Rousseau aber ein grundlegendes Problem (problème fondemental), das. er im CS wie folgt formuliert: ,,Finde eine Form des Zusammenschlusses, die mit ihrer ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes einzelnen Mitglieds verteidigt und schützt und durch die doch jeder, indem er sich mit allen vereinigt, nur sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor" [12] .
Die Lösung des Problems soll für Rousseau wie bereits erwähnt in einem Gesellschaftsvertrag liegen, der durch eine freiwillige Übereinkunft aller Individuen zustande kommt. Die natürliche Freiheit (indépendance naturelle) des Einzelnen will Rousseau durch ,,die völlige Entäußerung (aliénation totale) jedes Mitglieds mit allen seinen Rechten an das Gemeinwesen als Ganzes" mit Vertragsschluß durch eine bürgerliche (liberté civile) und sittliche Freiheit (liberté morale) ersetzen[13]. Zusätzlich zu dieser neuen gemeinschaftlichen Freiheit[14] gewinnt jedes Mitglied des Zusammenschlusses, ,,da jeder sich voll und ganz gibt", [15] auch noch eine rechtliche Gleichstellung, da durch die vorbehaltlose Entäußerung kein Mitglied mehr zu fordern hat ein anderes. Wäre diese rechtliche Gleichheit nicht das automatisches Produkt des Zusammenschlusses - könnten Einzelne also weiter Sonderrechte geltend machen - dann würde der Naturzustand fortdauern und der Zusammenschluß wäre für Rousseau ,,tyrannisch oder inhaltslos" [16].
Durch den Akt des Zusammenschlusses tritt somit an die Stelle der einzelnen Individuen eine
,,sittliche Gesamtkörperschaft". Diese politische Gesamtkörperschaft (corps politique) definiert Rousseau als Republik, die von ihren Mitgliedern Staat genannt wird, wenn sie passiv ist und Souverän, wenn sie eine aktive Rolle spielt. Die Vertragsschließenden werden in ihrer Gesamtheit durch den Vertragsschluß zum Volk. Der Einzelne trägt bei einer aktiven Teilhabe an der Souveränität fortan den Namen Bürger (citoyen), als lediglich den Gesetzen der Gemeinschaft unterworfenes Individuum ist er gleichzeitig Untertan (sujet). Damit ist jeder Einzelne wechselseitig, in doppelter Hinsicht verpflichtet; als Teil des Souveräns gegenüber dem Einzelnen und als Glied des Staates gegenüber dem Souverän[17].
Den Übertritt des nicht mehr ursprünglichen Naturmenschen in den staatlichen Zustand muß man sich mit Rousseau als einen Vergeistigungs- und Versittlichungsprozeß vorstellen, bei dem jeder Einzelne sich selbst von einem fühlenden, instinktiv-triebhaft handelnden Urmenschen seinem ganzen Wesen nach in einen rationalen, vernünftigen ( Staats- )Bürger verwandelt[18]. Erst nachdem der depravierte Mensch des Naturzustandes Staatsbürger geworden ist, fängt er für Rousseau wieder an Mensch zu sein[19].
Mit dem Gesellschaftsvertrag Rousseaus steht der Einzelne nicht mehr wie bei Hobbes einem Staatskörper, dem Souverän als Unterworfener und Gehorsamspflichtiger gegenüber, sondern jeder ist zugleich Teil des Souveräns und dem allgemeinen Willen als Letztinstanz[20]unterworfen. Ein Individuum muß somit dem allgemeinen Willen passiv Folge leisten, aber das gleiche Individuum ist ebenso aktiver Teilhaber, da sein Wille Teil des allgemeinen Willen ist[21]
III. La volonté générale:
Die Theorie des allgemeinen Willens bei Rousseau baut wie gezeigt auf einer reziproken Entäußerung der individuellen Freiheit eines jeden Einzelnen zugunsten der Gemeinschaft auf. Mit der abstrakten[22] Idee des allgemeinen Willens gibt Rousseau seiner Ansicht nach die
legitime und gerechte Lösung für die Vereinbarkeit von individueller Autonomie und staatlichem Rechtszwang.
1. Bezug und Bestimmung des allgemeinen Willens
Den ursprünglich von Diderot[23] geprägten Begriff der volonté générale[24], der auf eine die ganze Menschheit umfassende société générale gerichtet war, wendet Rousseau nur noch auf einen corps politique, einen Einzelstaat oder ein einzelnes Volk an[25].
Insofern ist der Allgemeinwille zunächst souveräner Wille eines Staates, der auf die Selbsterhaltung und das Wohl des ganzen politischen Körpers und seiner Teile gerichtet ist. Er stellt für den einzelnen Bürger die Regel für das Gerechte und Ungerechte dar[26] und ist
Quelle der Gesetze, da er in seinen Äußerungen auf die Bürger immer richtig ist[27].
Nur wer zu jener politischen Körperschaft gehört, kann von der Allgemeinheit geschützte Rechte beanspruchen. Ein Fremder gehört nicht zur Gemeinschaft; er ist als bloßer Mensch in den Augen des Bürgers nichts[28]. Denn der Einzelstaat setzt sich gegen die Gemeinschaft aller Menschen ab. Sein Allgemeinwille ist somit im Bezug auf andere Staaten und deren Bürger nur Partikularwille und hat als solcher seinen Maßstab der Gerechtigkeit im Naturgesetz[29]. Da Rousseau aber im allgemeinen Willen die Letztinstanz der Gerechtigkeit im durch den Gesellschaftsvertrag entstandenen corps politique sieht, der eben nicht dem Naturgesetz
unterworfen sein soll, schuldet der Bürger nur dem Mitbürger gegenüber Uneigennützigkeit und andere zwischenmenschliche Tugenden[30].
Für Rousseau kann allein der Allgemeinwille die Kräfte des Staates gemäß dem Zweck seiner Errichtung, nämlich dem Gemeinwohl, leiten[31]. Daher ist er nicht als einfache Summe der Eigeninteressen der Einzelnen Bürger zu verstehen. Denn sein Sonderinteresse (volonté particulière) verfolgt der Einzelne ohne Rücksicht auf das Gemeinwohl[32]. Zwar enthält jeder
Einzelwille neben einem rein individuellen Interesse auch ein Stück Allgemeininteresse; addiert man jedoch alle Partikularwillen, so erhält man als Summe nur einen Gemeinwillen (volonté des tous), d.h. einen Willen aller, der für eine staatliche Willensbildung ohne Belang
ist, weil er nicht in erster Linie das Gemeinwohl verfolgt[33]. Zur Bestimmung des allgemeinen
Willens, ist es daher nötig, aus den Partikularwillen des Einzelnen, das ihnen allen gemeinsame Allgemeine herauszufiltern[34]. Bei diesem Filterungsprozeß sollen Abstimmungen als die willensfindenden Katalysatoren fungieren (s.u.). Um wirklich die
Aussage des allgemeinen Willens zu bekommen, ist es für Rousseau außerdem wichtig, daß es im Staat keine Parteien gibt und jeder Bürger nur seine eigene Meinung vertritt[35]. Wenn es denn nicht zu vermeiden ist, daß sich in einem Staat Parteien bilden, muß dafür gesorgt werden, daß es so viele Parteiungen wie möglich gibt, damit sich die Vielzahl verschiedener
Sonderinteressen gegenseitig aufheben.
Der allgemein Wille muß somit nicht von allen faktisch gewollt sein, sondern er muß sich auf das Gemeinwohl und nicht auf den Vorteil von Einzelnen oder einer Gruppe abzielen. Was
nämlich ,,den Willen zu einem allgemeinen macht, ist weniger die Anzahl der Stimmen, als das sie einigende Gemeininteresse [36]".
[...]
[1] vgl. Willms, Die politischen Ideen von Hobbes bis Ho Tschi Minh, S. 50f..
[2] Groethuysen, Philosophie der französischen Revolution, S.88; Maier, Klassiker des politischen Denkens, S.121, der aus einem Brief Rousseaus an seinen Kritiker, den Erzbischof Beaumont, zitiert: ,, Le principe fondemental de toute morale ..est que l´homme est un être naturellement bon, aimant la justice et l´ordre" und ,, (...) que tous les vices qu´on impute au coeur humain ne lui sont point naturels".
[3] Willms, S. 51.
[4] Maluschke, Philosophische Grundlagen des demokratischen Verfassungsstaates, S. 73. 5 Maier, S. 122.
[6] Maluschke, S. 73f.. 7 Maier, S. 122.
[8] Maluschke, S. 74.
[9] Maluschke, S. 75.
[10] CS, Buch I, Kap.: ,, (...) Dann kann der ursprüngliche Zustand nicht weiterbestehen, und das Menschengeschlecht würde zugrunde gehen, wenn es die Art seines Daseins nicht änderte. Da die Menschen keine neuen Kräfte hervorbringen, sondern nur die vorhandenen vereinen und lenken können, haben sie kein anderes Mittel, sich zu erhalten als durch Zusammenschluß eine Summe von Kräften zu bilden, ... , und diese aus einem einzigen Antrieb einzusetzen und gemeinsam wirken zu lassen."
[11] CS, I, 1: ,, Der Mensch wird frei geboren, aber überall liegt er in Ketten"; CS, I, 4; ,, (...) sie werden als Mensch und frei geboren. (...) Auf seine Freiheit verzichten heißt auf seine Eigenschaft als Mensch,... verzichten. (...) Ein solcher Verzicht ist unvereinbar mit der Natur des Menschen.".
[12] CS, I, 6.
[13] CS, I, 6 und 8.
[14] vgl. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique des son temps, S. 368., der das Begriffspaar ,, liberté commune" und ,, liberté individuelle" gegenüberstellt.
[15] CS, I, 6.
[16] CS, I, 6.
[17] vgl. CS, I, 7.
[18] vgl. Ritzel, Jean-Jacques Rousseau, S. 104.
[19] Fetscher, Rousseaus politische Philosophie, S. 117.
[20] CS, I, 6; über die Beschränkung des Gesellschaftsvertrages: ,,Gemeinsam stellen wir alle, jeder von uns seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Richtschnur des Gemeinwillens; und wir nehmen, als Körper, jedes Glied als untrennbaren Teil des Ganzen auf."
[21] vgl. Hall, Rousseau - An Introduction to his Political Philosophy, p. 101.
[22] a.A. Brandt, Rousseaus Philosophie der Gesellschaft, S. 86, nachdem der Allgemeinwille eine reale Vereinheitlichung der Willen in dem wirklichen Willen des corps politique ist.
[23] 1755 in dem Artikel ,,Droit naturel" für die Encyclopédie erstmals aufgetaucht.
[24] Im Sinne einer von Gott gegebenen, jedem Menschen innewohnenden naturgesetzlichen Ordnung.
[25] Fetscher, S. 114.; Brandt, S. 85.
[26] Herb, S. 108.
[27] Kersting, Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrags, S. 175. 28 Ritzel, S. 101.
[29] Fetscher, S. 114.
[30] Ritzel, S. 101; Fetscher, S. 114.
[31] CS, II, 1.
[32] Welzel, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, S. 124. 33 Maier, S. 130.
[34] CS, II, 3, ,, (...) aber nimm von eben diesen (- dem Sonderwillen) das Mehr und das Weniger weg, das sich gegenseitig aufhebt, so bleibt als Summe der Unterschiede der Allgemeinwille."
[35] CS, II, 3.
[36] CS, II, 4.
- Quote paper
- Stefan Brost (Author), 1999, Jean-Jacques Rousseau - Staat und Bürger, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/102365