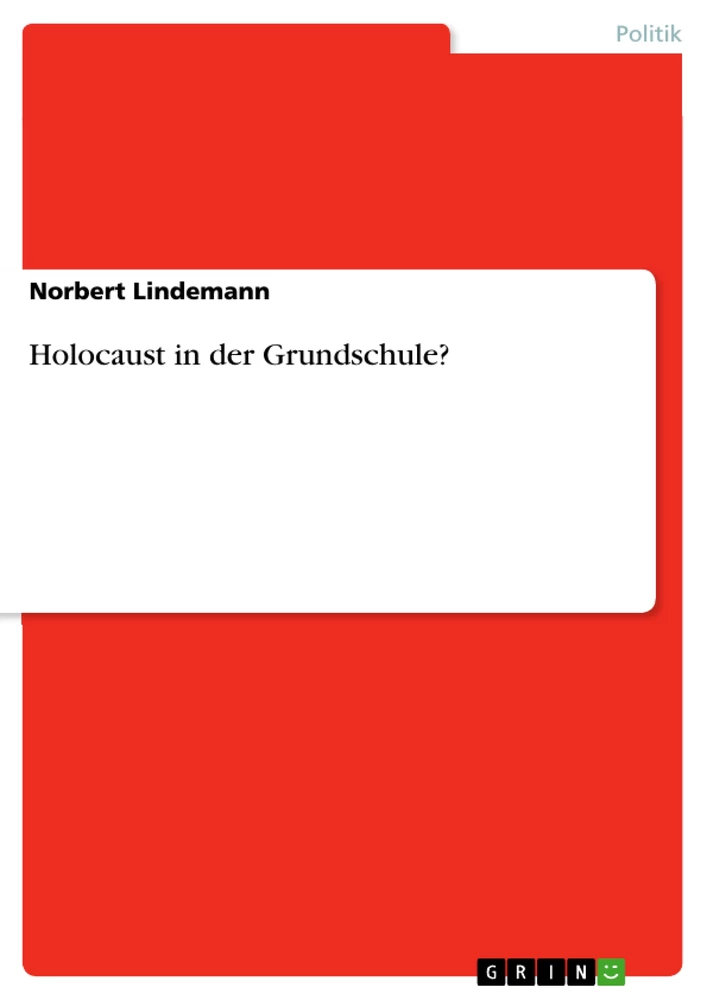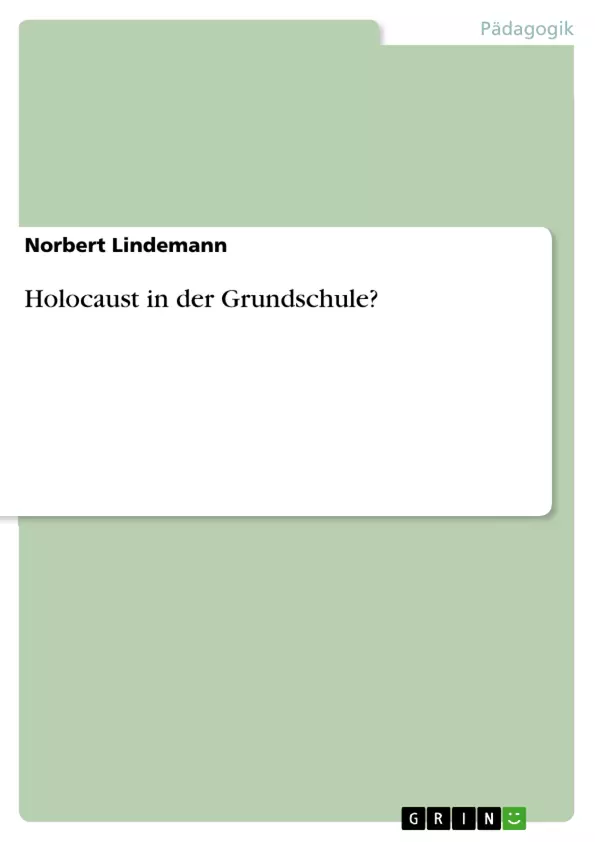Was, wenn die Vergangenheit plötzlich im Klassenzimmer steht? Diese fesselnde Analyse dringt tief in die Frage ein, wie wir unseren Kindern die dunkelsten Kapitel der Geschichte vermitteln können. Am Beispiel des Holocaust, einer der größten Tragödien des 20. Jahrhunderts, erkundet dieses Werk die Herausforderungen und Chancen, die sich ergeben, wenn wir uns dem Thema im Kontext der Grundschule nähern. Es ist ein Balanceakt: Wie vermitteln wir die Grausamkeit und das Leid, ohne die jungen Leser zu traumatisieren? Wie schaffen wir einen Raum für Empathie und Verständnis, der gleichzeitig historisch akkurat und altersgerecht ist? Dieses Buch bietet keine einfachen Antworten, sondern einen reichen Fundus an Perspektiven, Unterrichtsideen und Materialien, die dazu anregen, sich kritisch mit der Thematik auseinanderzusetzen. Von der Bedeutung der Gedenkstättenarbeit bis hin zur Analyse von Kinder- und Jugendbüchern, von Zeitzeugenberichten bis hin zu Unterrichtsentwürfen rund um Anne Frank – die Leser erhalten einen umfassenden Einblick in die vielschichtigen Aspekte des Holocaust und dessen Relevanz für die heutige Gesellschaft. Dabei wird auch die Frage aufgeworfen, wie wir mit den Fragen der Kinder umgehen, wenn sie durch Medien oder Erzählungen mit dem Thema konfrontiert werden. Das Buch plädiert für eine offene und altersgerechte Auseinandersetzung, um Verunsicherungen vorzubeugen und eine fundierte Meinungsbildung zu fördern. Es ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Pädagogen, Eltern und alle, die sich der Verantwortung bewusst sind, die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten und die Lehren daraus an zukünftige Generationen weiterzugeben. Entdecken Sie, wie historisches, politisches und soziales Lernen am Beispiel des Holocausts zu einer tiefgreifenden Erfahrung für Kinder werden kann und wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der sich solche Gräueltaten niemals wiederholen. Die Auseinandersetzung mit Themen wie Antisemitismus, Rassismus, Judenverfolgung, Konzentrationslager, Nationalsozialismus, Schoah und Völkermord wird hierbei auf eine Art und Weise behandelt, die sowohl informativ als auch ethisch verantwortungsvoll ist. Ein Buch, das zum Nachdenken anregt und Mut macht, sich den schwierigen Fragen unserer Zeit zu stellen.
Thema: HOLOCAUST
Historisches, politisches und soziales Lernen am Beispiel eines Schlüsselproblems Auswertung der Forschungswerkstatt und der Präsentation der Forschungsergebnisse
CHRONOLOGIE DES HOLOCAUST
1933
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Entrechtung und Ausgrenzung der jüdischen (1933 etwa 500 000 Menschen) und anderer unerwünschter Minderheiten
(Sinti und Roma, Asoziale, Behinderte, Homosexuelle)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1935
erste Inhaftierungen in Konzentrationslager (KZ)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1938
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
7. November Attentat auf deutschen Botschaftssekretär E. VOM RATH in Paris (aus Protest gegen die Austreibung von etwa 17.000 Juden polnischer Nationalität aus Deutschland in das nicht aufnahmewillige Polen) / E. VOM RATH stirbt am 9. November an den Folgen des Attentats)
9./10. November Reichspogromnacht (NS-offiziell ,,Reichskristallnacht") - weitüber 1000 Synagogen brennen / Gebetshäuser und zahlreiche jüdische Friedhöfe werden zerstört / 7500 jüdische Wohn- und Geschäftshäuser werden verwüstet - 91 Menschen finden den Tod / mehr als 30 000 werden verhaftet, viele von ihnen werden in KZ gebracht
Berufsverbot für jüdische Ärzte und Anwälte / kollektive Sondersteuer für Juden als
,,Sühnesteuer" / Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftssystem / völlige Entrechtung der Juden im Deutschen Reich
1939
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1940
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ab 1941
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1942
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
bis November 1944 (fordert mindestens 3 Mio. Opfer)
1945
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Insgesamt fielen, vor allem zwischen 1941 und 1944, etwa 6 Mio. europäischer Juden dem Holocaust zum Opfer
Teil 1: Planung
Vorüberlegungen
,,Historisches, politisches und soziales Lernen im Sachunterricht am Beispiel eines Schlüsselproblems" (z.B. Thema ,,Holocaust") - so hieß das Thema der ,,Arbeitsgruppe Holocaust". Die grundsätzliche Fragestellung, die sich der Arbeitsgruppe stellte, lautete:
Ist ,,Holocaust" ein Thema für die Grundschule?
Diese kontrovers zu diskutierende Fragestellung ließ sich in unserer Arbeitsgruppe nicht uneingeschränkt mit Ja oder Nein beantworten, weshalb es uns wichtig erschien, diese zentrale Frage auch gemeinsam mit den Seminarteilnehmern zu diskutieren. Wenn man der Meinung ist, ,,Holocaust" sei bereits ein Thema für Kinder im Grundschulalter, so müssen sich daran Fragen vor allem der Didaktik anschließen: ,,Wie kann (muss) das Thema behandelt werden, wenn es sich an der Lebenswirklichkeit und dem Entwicklungsstand der Kinder orientieren soll? Wie kann man es anschaulich gestalten und dabei gleichzeitig den Blick für historische und politische Fakten bewahren?" Und schließlich die Frage: ,,Wie kann man Unterricht so gestalten, dass dieser handlungsorientiert ist?" Verneint man eine Thematisierung des ,,Holocaust" in der Grundschule, so darf dies nicht unbegründet erfolgen und vor allem muss man sichüber die Konsequenzen im Klaren sein:
,,Wie geht man mit Fragen der Kinder zu diesem Thema um? Was ist zu tun, wenn Kinder aus Büchern, aus dem Fernsehen oder aus Erzählungen etwasüber das Thema erfahren haben und sie mehr darüber wissen wollen?"
Am Anfang der Planung stand ein Brain-Storming innerhalb der Arbeitsgruppe. Dabei wurde bereits deutlich, dass dieses Thema viele verschiedene Möglichkeiten der Auseinandersetzung bietet. Gleichzeitig wurde aber auch die Schwierigkeit deutlich, ein so sensibles Thema kindgerecht zu behandeln, ohne dabei die Verbrechen, die Morde und die Millionen von Opfern zu verschweigen.
Die Präsentation der Forschungsergebnisse durch die Arbeitsgruppe war bewusst so angelegt, dass sich Vorträge zum Thema und Zeit zur eigenständigen Auseinandersetzung mit den Materialien abwechseln.
0. Bereits vor der Seminarsitzung wurden die Tische der letzten Sitzreihe mit Davidsternen versehen. Damit sollte versucht werden, bei den Seminarteilnehmern Reaktionen, Fragen oder Bemerkungen zu diesem Sachverhalt und seiner Bedeutung zu provozieren. Hintergrund war ein Bericht eines Zeitzeugenüber die sog. ,,Judenbank" in den Klassenzimmern zur Zeit des Nationalsozialismus. Weitere Anknüpfungspunkte wären die Kennzeichnungspflicht für Juden oder die Bedeutung des Davidsterns allgemein. Dieübrige Gestaltung des Seminarraumes mit Stellwänden und Tischen sollte eine Ausstellung aller Bilder, Dokumentations- und Arbeitsmaterialien ermöglichen.
1. Um das Thema angemessen behandeln und diskutieren zu können schien es uns wichtig, jedem einzelnen Seminarteilnehmer zum Einstieg die Möglichkeit zu geben, sich in einem Brain-Storming Gedankenüber seine Sichtweise, seine Fragen und Erwartungen zum Thema zu machen. Die Ergebnisse wurden für alle sichtbar ausgestellt.
Die Definition des Begriffes ,,Holocaust" oder ,,Schoah" nach einem geschichtlichen Lexikon sollte zusätzlich zur Klärung bzw. Erweiterung des Begriffes dienen.
Um eine einheitliche Diskussionsgrundlage zu schaffen war es unserer Meinung nach unbedingt notwendig, die historischen und politischen Fakten darzustellen. Die auf einer Zeitleiste festgehaltenen wichtigsten Daten des ,,Holocaust" wurden durch eine ausführlichere Chronologie der Geschehnisse zwischen 1933 und 1945 ergänzt.
2. Mit diesem historisch-politischen Hintergrundwissen sollten sich die Seminarteilnehmer nach eigenem Interesse mit den vielfältigen Materialien beschäftigen, die nach Ansicht der Arbeitsgruppe alle in einer gewissen Weise als erster Zugang zum Thema geeignet schienen.
3. Eine Möglichkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema ,,Holocaust" bietet die Geschichte rund um ,,Das Tagebuch der Anne Frank". Exemplarisch sollte hierzu ein Unterrichtsentwurf vorgestellt werden, Arbeitsmaterial angeboten werden, aus einem Erfahrungsbericht einer Lehrerin zitiert werden und ein Filmausschnitt gezeigt werden, der zu weiteren Fragen und Diskussionspunkten anregen könnte.
4. Die abschließende Diskussion sollte neben allgemeinen Stellungnahmen insbesondere der Annäherung an die Ausgangsfrage ,,Holocaust" - ein Thema für die Grundschule?" dienen. Der Arbeitsgruppe ging es dabei um die kritische Beurteilung der vorgestellten Arbeitsmaterialien sowie um ergänzende Vorschläge und Anregungen.
Teil 2: Durchführung
Verlauf der Seminarsitzung (05.07.1999)
0. Gestaltung des Seminarraumes
- Stellwände mit Zeitleiste, Bildern, Dokumentations- und Arbeitsmaterial
- Tische mit Büchern, Dokumentations- und Arbeitsmaterial
- Davidsterne auf den Tischen der letzten Sitzreihe (,,Judenbank")
- TV- / Video-Gerät
1. Einstieg in das Thema
- Brain-Storming zum Thema ,,Holocaust"
Die Seminarteilnehmer sollenüber den Begriff ,,Holocaust" nachdenken und Gedanken, Schlagwörter, Namen, Daten usw., die sie mit dem Begriff verbinden, auf Papier bringen. Diese Begriffe werden gesammelt und ergänzend zur vorbereiteten Zeitleiste ausgestellt.
Folgende Begriffe wurden (z.T. mehrfach) genannt:
_Antisemitismus _Auschwitzlüge _Davidstern _Holocaust-Denkmal _Judenverfolgung
_Konzentrationslager _Nationalsozialismus _Rassismus _Reichskristallnacht
_Vergangenheitsbewältigung _Vernichtung der Juden, Sinti und Roma,... _Völkermord
_Zwangsarbeit
- Definition des Begriffes ,,Holocaust" / ,,Schoah" (siehe Anlagen)
- Chronologie des ,,Holocaust" von 1933 - 1945 (siehe Anlagen)
2. Ausstellung aller Bilder, Dokumentations- und Arbeitsmaterialien zum Thema
Den Seminarteilnehmern stehen zur Verfügung:
- Zeitleiste zum Thema ,,Holocaust"
- Kinder- und Jugendbücher zum Thema ,,Nationalsozialismus" (siehe Literaturliste)
- Unterrichtsmaterial zum Thema ,,Anne Frank"
- Berichte von Zeitzeugen / Bildmaterial (siehe Anlagen)
- Bilder von Künstlern aus der Zeit von 1933 - 1945
- Informationsmaterial zum Thema ,,Emslandlager" (siehe Anlagen)
- Informationsmaterial zur Gedenkstättenarbeit in Niedersachsen
- Aktuelle Zeitungsberichte zum Thema ,,Holocaust-Denkmal" (siehe Anlagen)
3. Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit dem Thema
- Unterrichtsentwurf zum Thema ,,Anne Frank"
- Arbeitsmaterial: ,,Das Tagebuch der Anne Frank" (Primärliteratur), Geschichten, Berichte, Bilder, Zeichnungen, usw. zum Thema (Sekundärliteratur)
- Erfahrungsbericht einer Lehrerinüber eine Unterrichtseinheit ,,Anne Frank"
- Filmausschnitt (ca. 20 Minuten)
4. Diskussion im Seminar
- Allgemeine Stellungnahmen
- Fragestellungen: Ist ,,Holocaust" ein Thema für die Grundschule?
Wenn Ja ! Wie kann/muss das Thema behandelt werden
Wenn Nein ! Wie gehen LehrerInnen mit Fragen der Kinder zum Thema um?
Teil 3: Auswertung
Nachbetrachtung
Als Fazit kann die Arbeitsgruppe festhalten, dass das Thema ,,Holocaust" durchaus bereits in der Grundschule behandelt werden kann. Die Thematisierung sollte jedoch nicht uneingeschränkt erfolgen und bedarf einer sorgfältigen und sensiblen Planung.
Wenn man das Thema vor Grundschülern verschließen will, widerspricht man damit den Ansprüchen der Kinder an ihre Umwelt und vor allem an die Schule. Durch ihren täglichen Umgang mit Fernsehen und Büchern oder aus Gesprächen ergeben sich Fragen, die sie unbedingt beantwortet wissen wollen. Zu Themen wie Mensch, Natur oder Technik ebenso wie zu den Begriffen Davidstern, Judenverfolgung oder Konzentrationslager. Kinder wollen verstehen, was um sie herum geschieht und warum es passiert. Mit dieser Erwartungshaltung kommen sie in die Schule - die Institution, die ihnen die Welt erklären soll. Wenn die Frage eines Kindes, das in einem Bericht z.B. von Konzentrationslagern gehört hat, nach Sinn und Zweck dieser Lager unbeantwortet bleibt oder vom Lehrer zurückgestellt wird (etwa mit dem Hinweis, dass dies erst ein Thema für den Geschichtsunterricht der 5. Klasse sei), dann sucht es möglicherweise nach eigenen - unvollständigen, verfälschten - Erklärungsmustern. Diese ,,individuelle Wahrheit"über Sachverhalte später durch eine andere, historisch korrekte Darstellung zu ersetzen, kann beim Kind zu Verunsicherung führen. Deshalb sollten die Fragen der Kinder - auch zu schwierigen Themen - bereits in der Grundschule zumindest in Ansätzen beantwortet werden, damit alle weiteren Informationen zu diesem Thema vom Kind entsprechend aufgenommen und verarbeitet werden können.
- Wennüber das Thema ,,Holocaust" gesprochen werden soll, dann muss dies in einem anderen Rahmen geschehen als wennüber Wohnen, Kleidung oder Geld geredet wird. Der Einstieg war aus diesem Grund so gewählt, dass sich jeder Seminarteilnehmer zunächst Gedankenüber den Begriff ,,Holocaust" machte und sich so auf dieses sensible Thema vorbereitete. Die Ergebnisse dieses Brain-Storming wurden ausgestellt. Anhand der vielen verschiedenen - von der Arbeitsgruppe durchaus erwarteten - Begriffe wurde deutlich, dass jeder zunächst etwas anderes mit dem Thema verbindet. Dies liegt entweder an den unterschiedlichen Interessen oder am jeweiligen Allgemeinwissen der Seminarteilnehmer. Um für Letzteres eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, hielten wir es für wichtig, zunächst eine allgemein gültige Definition des Begriffes ,,Holocaust" zu bieten und anschließend eine Chronologie der Ereignisse von 1933 bis 1945 vorzustellen. Diese wurde durch eine vorbereitete Zeitleiste mit den wichtigsten Daten ergänzt und sollte als Veranschaulichung des historischen Hintergrundes dienen.
- Für den Unterricht in der Grundschule wäre es denkbar, dass der Begriff ,,Holocaust" in einem für das Alter geeigneten Lexikon von den SchülerInnen nachgeschlagen und heraus geschrieben wird (z.B. als Plakat). Die in diesem Zusammenhang auftauchenden Begriffe wie Judenverfolgung oder Nationalsozialismus müssten dann ebenfalls geklärt werden. Die Aufarbeitung dieser historisch-politischen Fakten könnte in einem handlungsorientierten Unterricht so aussehen, dass sich je nach Interesse verschiedene Arbeitsgruppen bilden, die sich mit einzelnen Begriffen befassen und diese dann der gesamten Gruppe vorstellen.
- Um diesen Teil der Zeitgeschichte anschaulicher zu gestalten, wäre eine Zeitleiste mit den wichtigsten Daten hilfreich. Diese könnte, wiederum gruppen- und abschnittweise, nach Erforschung von Lexika und Geschichtsbüchern erstellt werden und dauerhaft im Klassenraum plaziert werden. Die Vorstellungskraft der SchülerInnen würde möglicherweise zusätzlich gesteigert, wenn eine individuelle Zeitleiste erstellt werden kann, die durch persönliche Daten wie Geburtstag, Einschulung, Hochzeit oder Fotos der (Eltern) Großeltern, Onkel oder Tanten ergänzt wird. Diese Erfahrungen aus erster Hand wären auch deshalb wichtig, weil die Generation, die den Nationalsozialismus noch miterlebt hat, heute zu derältesten unserer Gesellschaft zählt und nicht mehr lange von Erlebnissen berichten kann, die sie am eigenen Leib erfahren hat.
Die besondere Gestaltung des Seminarraumes mit Stellwänden und Tischen ermöglicht allen Seminarteilnehmern, sich auf individuelle Art und Weise mit allen zur Verfügung stehenden Bild-, Dokumentations- und Arbeitsmaterialien zu befassen. Eine solche Ausstellung bietet die Chance der Differenzierung, da die Reihenfolge und die Intensität der Betrachtung der Materialien allein durch das Interesse jedes einzelnen bestimmt werden. Außerdem bedeutet eine Veränderung der räumlichen Lehr-Lernumgebung eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag für SchülerInnen und LehrerInnen.
- Die Davidsterne auf den Tischen der letzten Sitzreihe verfehlten bei den Seminarteilnehmern ihre erhoffte, aber auch nicht unbedingt erwartete Wirkung. Wenn Schulkinder eines Tages auf ihrem Platz einen gelben Stern finden würden, hätten sie gewiss einige Fragen. Und genau diese Fragen wären dann Ansatzpunkte, um sich dem Thema ,,Holocaust" zu nähern. Sie würden möglicherweise nach der Bedeutung des Davidsterns fragen, warum und seit wann Juden ihn tragen mussten, wieso die Judenüberhaupt verfolgt wurden und von wem und weshalb es in den Klassenräumen sog. ,,Judenbänke" gab?
- Die große Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern zum Thema Nationalsozialismus weckte das Interesse aller Seminarteilnehmer. Diese Reaktion würden wir auch bei Grundschülern erwarten, zumal die Bücher von gleichaltrigen Kindern handeln, deren Geschichte zur Zeit des Nationalsozialismus spielt. Die SchülerInnen können einen Bezug zur Identifikationsfigur herstellen, was den Zugang zum Buch und damit zur Zeitgeschichte erleichtert. Sie entdecken möglicherweise Dinge, die ihnen aus ihrem Alltag vertraut sind. Möglicherweise entwickeln sie Fragestellungen,über die eine Auseinandersetzung mit dem Thema stattfinden kann: ,,Ist das damals wirklich so geschehen? Warum konnte esüberhaupt dazu kommen? Wäre so etwas heute auch noch denkbar?" In Kleingruppen könnten verschiedene Bücher erarbeitet werden und anschließend der gesamten Gruppe in Form von Dialogen oder Rollenspielen vorgestellt werden.
- Exemplarisch wurde von der Arbeitsgruppe das Thema ,,Anne Frank" ausgewählt. Anhand eines Unterrichtsentwurfes, ergänzenden Arbeitsmaterialien, dem ,,Tagebuch der Anne Frank" und einem Filmausschnitt sollten Möglichkeiten gezeigt werden, wie im Unterricht ein erster Zugang zum Thema geschaffen werden könnte. Die Lektüre des Buches könnte im Rahmen fächerübergreifenden Unterrichts geeignete Anlässe zum Lesen und Schreiben bieten. Der Film könnte darüber hinaus die Problematik noch verdeutlichen und möglicherweise auch bei den Kindern, die heute nur noch schwerüber Bücher zu erreichen sind, das Schicksal der Anne Frank zu einem interessanten Thema machen.
- Bilder und Berichte von Zeitzeugen - selbst Schulkinder zur Zeit des Nationalsozialismus - schildernähnliche Schicksale wie das der Anne Frank. Sie erzählen von Freundschaften, die zerbrachen, von Lehrern und Mitschülern, die jüdische SchülerInnen terrorisierten und von den Erfahrungen, als Kind in ein Konzentrationslager verschleppt zu werden. Diese authentischen Erfahrungsberichte von Personen, die z.T. heute noch leben, dürften jedem Leser verdeutlichen, dass sich diese Schicksale tatsächlich abgespielt haben und auch noch in unserer Zeit für das Zusammenleben von großer Bedeutung sind. Erzählungen beispielsweise der Großeltern hinterlassen bei Kindern (und Erwachsenen) vermutlich einen besonders starken Eindruck.
- Um einen regionalen Bezug zum Thema herstellen zu können, wurde Informationsmaterial zu den ,,Emslandlagern" angeboten. Dadurch, dass es auch in der näheren Umgebung Überreste ehemaliger Konzentrations-, Strafgefangenen- und Arbeitslager gibt, kann das Interesse an der Vergangenheit geweckt werden. Gedenktafeln, Hinweisschilder und Gebäude
- wenn auch vereinzelt und als ehemalige Lager heute nicht mehr erkennbar - geben Zeugnisüber die Geschichte ab und ermöglichen es, einen direkten Bezug zwischen Vergangenheit und Gegenwart herzustellen. Gerade dadurch kann bei den SchülerInnen ein Stück Geschichtsbewusstsein geweckt werden. Gelegentlich finden sich in direkter Umgebung zum Wohnort Gedenksteine, Mahnmale oder Bilder, die den Kindern unmittelbar Fragen entlocken und für deren Beantwortung sich der Unterricht anbietet. Auch Gedenktage oder besondere Veranstaltungen können Anlässe sein, nach deren Bedeutung zu fragen. Über die Region hinaus wurde dieser Themenbereich durch Informationen zur allgemeinen Gedenkstättenarbeit in Niedersachsen ergänzt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Dokuments?
Das Hauptthema des Dokuments ist der Holocaust, speziell im Kontext von historischem, politischem und sozialem Lernen. Es untersucht, ob der Holocaust ein geeignetes Thema für den Grundschulunterricht ist und wie es kindgerecht aufbereitet werden kann.
Welche zeitlichen Schwerpunkte werden im Dokument behandelt?
Das Dokument enthält eine Chronologie des Holocaust von 1933 bis 1945, die wichtige Ereignisse wie die Entrechtung der Juden, die Reichspogromnacht, Deportationen und die Vernichtungslager abdeckt.
Welche Fragen werden im Hinblick auf den Grundschulunterricht aufgeworfen?
Das Dokument stellt die zentrale Frage, ob der Holocaust ein Thema für die Grundschule ist. Wenn ja, wie kann das Thema altersgerecht behandelt werden, um die Lebenswirklichkeit und den Entwicklungsstand der Kinder zu berücksichtigen. Wenn nein, wie geht man mit den Fragen der Kinder um, wenn sie durch Medien oder Erzählungen mit dem Thema konfrontiert werden?
Welche Materialien und Methoden werden für die Auseinandersetzung mit dem Thema vorgeschlagen?
Das Dokument schlägt verschiedene Materialien und Methoden vor, darunter eine Zeitleiste, Kinder- und Jugendbücher, Berichte von Zeitzeugen, Bilder von Künstlern aus der Zeit des Nationalsozialismus, Informationsmaterial zu Gedenkstätten und aktuelle Zeitungsberichte. Außerdem wird der Einsatz des Tagebuchs der Anne Frank als Unterrichtsmaterial sowie Filmausschnitte und Diskussionsrunden empfohlen.
Wie wurde die Seminarsitzung zum Thema gestaltet und durchgeführt?
Die Seminarsitzung umfasste eine Gestaltung des Seminarraumes mit Zeitleiste, Bildern und Davidsternen, ein Brainstorming zum Thema, die Definition des Begriffs Holocaust, eine Chronologie der Ereignisse und die Auseinandersetzung mit verschiedenen Materialien. Abschließend fand eine Diskussion über die Eignung des Themas für die Grundschule statt.
Was ist die Schlussfolgerung der Arbeitsgruppe bezüglich der Thematisierung des Holocaust in der Grundschule?
Die Arbeitsgruppe kommt zu dem Schluss, dass das Thema Holocaust durchaus bereits in der Grundschule behandelt werden kann, jedoch eine sorgfältige und sensible Planung erfordert. Es wird betont, dass Kinder Fragen zu diesem Thema haben und die Schule eine Rolle bei der Beantwortung dieser Fragen spielen sollte.
Welche konkreten Unterrichtsideen werden vorgestellt?
Es werden konkrete Unterrichtsideen vorgestellt, wie die Erstellung einer Zeitleiste, das Nachschlagen des Begriffs "Holocaust" in Lexika, das Arbeiten in Gruppen zu verschiedenen Aspekten des Themas und die Nutzung regionaler Bezüge wie die Emslandlager. Auch die Auseinandersetzung mit dem Thema "Anne Frank" wird als Möglichkeit aufgezeigt.
Welche Bedeutung haben Zeitzeugenberichte und regionale Bezüge?
Zeitzeugenberichte und regionale Bezüge, wie die Emslandlager, werden als wichtige Elemente betrachtet, um das Thema greifbarer und persönlicher zu gestalten. Sie ermöglichen es, einen direkten Bezug zwischen Vergangenheit und Gegenwart herzustellen und das Geschichtsbewusstsein der Schüler zu wecken.
Was war das Ziel der Gestaltung des Seminarraumes mit Davidsternen?
Die Davidsterne auf den Tischen der letzten Sitzreihe sollten Reaktionen, Fragen oder Bemerkungen provozieren und an die sogenannte "Judenbank" in Klassenzimmern zur Zeit des Nationalsozialismus erinnern. Es sollte ein Anstoß sein,über die Bedeutung des Davidsterns, die Verfolgung der Juden und die Gründe für die Diskriminierung nachzudenken.
- Arbeit zitieren
- Norbert Lindemann (Autor:in), 2000, Holocaust in der Grundschule?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/102023