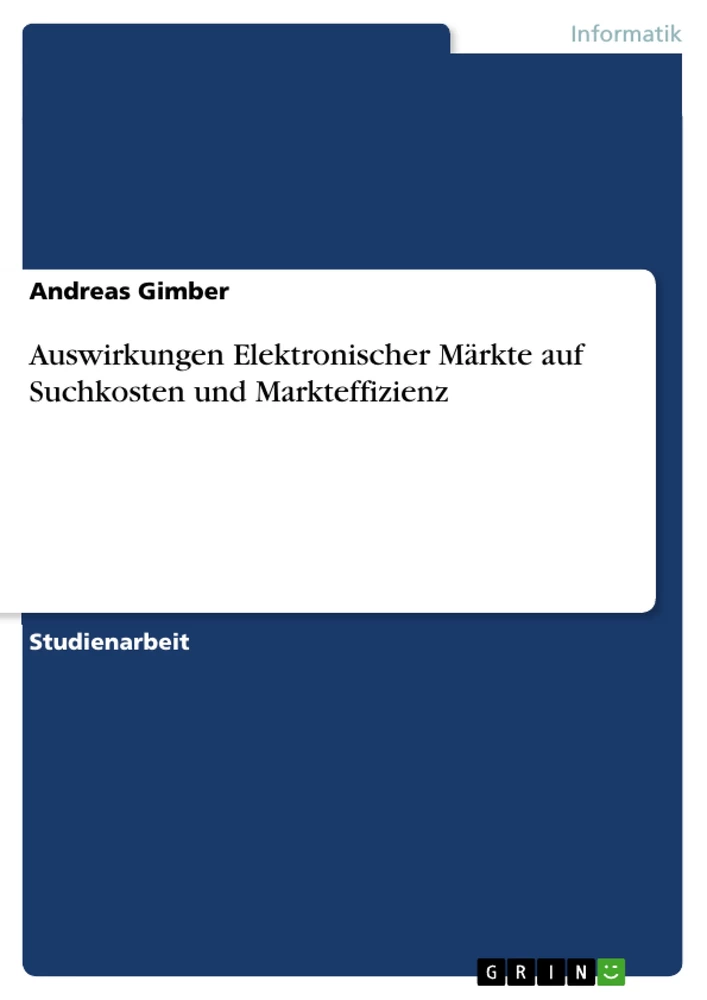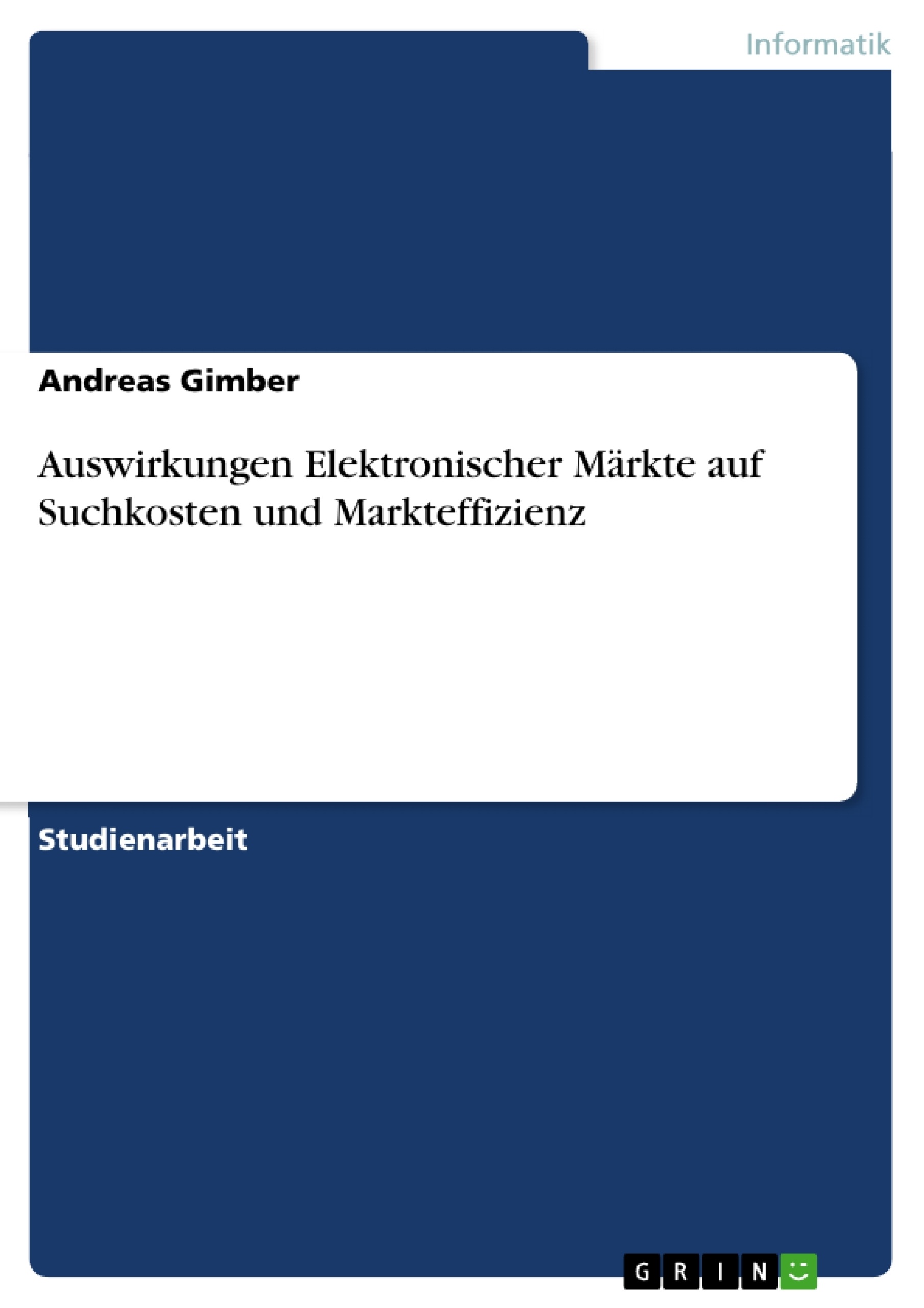Auswirkungen Elektronischer Märkte auf Suchkosten und Markteffizienz
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einleitung
Mit der immer weiter fortschreitenden Entwicklung des Internet und Elektronischer Märkte stellt sich die Frage, wie diese sich auf die Markteffizienz auswirken. Ein interessanter Ansatzpunkt für solche Untersuchungen ist die Suchkos- tentheorie. Aufbauend auf einer Arbeit von Bakos wird hier dargestellt, wie die sinkenden Suchkosten, die durch Elekt- ronische Märkte verursacht werden, die Markteffizienz beeinflussen können. Dazu werden als erstes die Implikationen für Märkte mit homogenen, dann die für Märkte mit heterogenen Gütern dargestellt. Daraufhin wird besprochen, wel- che Anreize es für Anbieter und Nachfrager gibt, in Elektronische Märkte zu investieren. Als letzter Kernpunkt wird dann gezeigt, wie Suchkosten nach Preis- und Produktinformation aufgetrennt werden können, bevor als letztes ein kurzes Resümee gezogen wird.
Suchkosten auf Märkten mit homogenen Gütern
Auf Märkten mit homogenen Gütern bieten alle Anbieter identische Produkte an, daher versuchen die Nachfrager, den Anbieter mit dem günstigsten Preis zu finden. Wählt ein Nachfrager dafür eine sequentiell-rationale Suchstrategie, so sucht er so lange weiter, bis die erwartete Verbesserung durch eine erneute Suche kleiner als deren Kosten wird. Das Vorhandensein von Suchkosten kann daher dazu führen, dass Anbieter zu Preisen über dem Konkurrenzpreis verkaufen können: je höher die Suchkosten sind, um so höhere Preise können von ihnen gesetzt werden. Elektronische Märkte erleichtern dem Kunden die Information über die Existenz und den Preis eines Anbieters und senken damit die Such- kosten. Dies führt zu sinkenden Preisen bei den Anbietern und zu vermehrter Suche durch die Nachfrager. Die Einfüh- rung von Elektronischen Märkten kann somit Preiskriege zwischen den Anbietern auslösen, welche die Preise immer mehr an den Gleichgewichtspreis bei vollkommener Konkurrenz bzw. das Bertrandgleichgewicht im Oligopol annä- hern, was ein verbessertes Marktergebnis zur Folge hat.
Besonders auf Märkten mit homogenen Gütern ist es sehr wahrscheinlich, dass Anbieter versuchen, die Einführung solcher Systeme zu verzögern, zu verhindern, oder sie zu kontrollieren, um ihre Überrenditen zu verteidigen.
Suchkosten auf Märkten mit differenzierten Gütern
Es existieren nur wenige Märkte mit homogenen Gütern, meistens gibt es sowohl aufgrund heterogener Kundenpräfe- renzen als auch höheren Gewinnmöglichkeiten für die Anbieter einen gewissen Grad an Produktdifferenzierung. Bakos hat die Auswirkung von Suchkosten auf solchen Märkten anhand eines Modells untersucht.
Während bei homogenen Gütern Preisinformationen für den Kunden ausreichen, benötigt der Kunde bei differenzierten Produkten neben diesen auch Produktinformationen, um den Grad der Übereinstimmung mit seinen persönlichen Präfe- renzen beurteilen zu können. Bakos bildet Produkteigenschaften mit Hilfe eines sogenannten „unit circle“ oder „city around the lake“ Modells ab, in dem die Produkte der Anbieter sowie die Kundenpräferenzen auf einem Einheitskreis positioniert werden: jeder Anbieter hat auf diesem Kreis eine Lage, die die Eigenschaften seiner Produkte darstellt, jeder Kunde hat ein Idealprodukt, welches ebenfalls als Punkt auf diesem Kreis dargestellt werden kann. Betrachtet ein Kunde das Produkt eines Anbieters, so berechnet er dessen „Preis“ aus dem Kaufpreis plus einen gewichteten Nutzen- verlust (fit costs), der sich aus der Entfernung des eigenen Idealpunkts von den tatsächlichen Produkteigenschaften ergibt. Zusätzlich entstehen für den Kunden Suchkosten, die bei jedem Suchvorgang anfallen, dessen Ergebnis die Posi- tion und der Preis eines Anbieters ist.
Entscheidet sich ein Kunde, in den Markt einzutreten, sucht er so lange, bis er ein akzeptables Produkt gefunden hat. Wenn die Suchkosten sinken, steigen seine Ansprüche und er sucht länger, er erwartet demnach auch ein Produkt, das noch näher bei seinem Idealpunkt liegt. Werden die Suchkosten null, so gibt es einen einheitlichen Preis für alle Anbie- ter, der von den fit costs und der Anzahl der Anbieter abhängig ist, und der Kunde kauft das Produkt, das am ehesten seinen Vorstellungen entspricht. Aufgrund der fit costs können die Anbieter selbst in diesem Fall noch Gewinne über 0 machen.
Existieren Suchkosten, und ein Kunde hat schon einen brauchbaren Anbieter gefunden, so wird er nur von einem An- bieter in einem bestimmten Intervall um diesen herum kaufen. Er wird, nachdem er diesen gefunden hat, nur dann wei- tersuchen, wenn die erwartete Verbesserung bei einer erneuten Suche die Suchkosten übersteigt. Jeder Anbieter sowie jeder Nachfrager hat, abhängig von den fit costs und den Suchkosten, einen bestimmten Bereich um seine Position herum, in dem er verkauft bzw. kauft. Wenn ein Anbieter seinen Preis anhebt, schrumpft das Segment aus dem Kreis, aus dem er Nachfrager bekommen kann. Es gibt aufgrund einer fallenden Nachfragekurve und sinkenden Grenzerlösen außerdem einen optimalen Preis p*, zu dem er sein Produkt allen Nachfragern anbietet. p* ist ein Gleichgewichtspreis,
der für alle Anbieter gleich, und abhängig von den Suchkosten sowie von den fit costs ist.
Wenn die Suchkosten hoch genug sind, kann es sein, dass Kunden nicht in den Markt eintreten, eventuell selbst dann, wenn der Preis null ist. Das passiert, wenn der Kaufpreis, die fit costs und die Suchkosten zusammen den Reservationspreis des Nachfragers übersteigen. Hohe Suchkosten können damit im schlimmsten Fall sogar zu einem Zusammenbruch des Marktes führen.
Anreize für Nachfrager, Anbieter und Intermediäre, in Elektronische Märkte zu investieren
Auf dem Modell für differenzierte Güter aufbauend untersucht Bakos die Gründe, welche die unterschiedlichen Marktteilnehmer veranlassen könnten, in Elektronische Märkte zu investieren. Er nimmt an, dass Investitionen nötig sind, um Suchkosten zu beeinflussen. Ausgehend von einer wohlfahrtsmaximierenden Investition x*, die Marktineffizienzen (Suchkosten und Nutzenverlust der entsteht, wenn der Nachfrager ein Produkt erhält, das nicht seinen idealen Vorstellungen entspricht) reduziert, wird jeder Teilnehmer analysiert.
Das Ergebnis ist, dass die Nachfrager mehr als die optimale Menge x* investieren, da sie neben den Marktineffizienzen auch den Preis senken wollen und sie durch eine höhere Investition einen noch höheren Nutzen für sich generieren können, der sich aber zu Lasten der Anbieter auswirkt.
Die Anbieter investieren in suchkostensenkende Technologien, wenn sie einen Anteil an den durch Effizienzsteigerung erzielten Gewinnen der Nachfrager abschöpfen können, z.B. durch Gebühren. Der durch die Einführung Elektronischer Märkte steigende Wettbewerb zwischen den Anbietern führt zu sinkenden Preisen, also zunächst zum Sinken seines Gewinnes, der Anbieter muss mindestens die Hälfte der Effizienzgewinne des Nachfragers erhalten, die ja zum Teil durch den Preisrückgang entstanden sind, sonst erzielt der Anbieter weniger Gewinn als vor Einführung und in diesem Fall tendieren sie nicht zur Implementierung Elektronischer Märkte, sondern versuchen sie sogar zu verhindern. Nur wenn sie alle Effizienzgewinne erhalten, investieren die Unternehmen wohlfahrtsoptimal. Erhalten sie weniger, dann sinken auch ihre Investitionen unter x*. Es existieren Situationen bei denen Anbieter, auch wenn sie nicht die gesamten Effizienzgewinne des Nachfragers abschöpfen können, zum optimalen Niveau x* investieren, nämlich dann, wenn sehr hohe Suchkosten existieren, wodurch die eigene Preisfestsetzung eingeschränkt ist oder der Markt deshalb vor dem Zusammenbruch steht, da zu viele Nachfrager wegen der hohen Kosten aus dem Markt ausscheiden.
Ähnliches gilt für Intermediäre. Diese können den Nachfrager für die Teilnahme an ihrem System, bis zur Höhe der durch niedrigere Preise und geringere Suchkosten eingesparten Kosten, mit Gebühren belasten. Abhängig von der Marktmacht und Verhandlungsstruktur der Intermediäre, erhalten diese ebenfalls einen Anteil an dem generierten Nutzenzuwachs des Nachfragers. Erhalten sie genau die Hälfte der Effizienzgewinne des Nachfragers, investieren sie optimal. Können die Intermediäre mehr abschöpfen, verhalten sie sich wie der Nachfrager und stecken mehr in die Elektronischen Märkte um ihre Gewinne zu maximieren, erhalten sie weniger, ist es genau umgekehrt.
Die Anbieter verschlechtern ihre Position durch Elektronische Märkte, wenn sie sich weniger als 50% aneignen können oder wenn diese durch die Nachfrager oder unabhängige Intermediäre eingeführt werden. Deshalb werden sie versu- chen, deren Einführung zu verhindern. Dies widerspricht allerdings der Beobachtung, dass in der Realität geschaffene Elektronische Märkte von Anbieterseite initiiert wurden. Für einen einzelnen Anbieter lohnt es sich nämlich, bei einer großen Anzahl von Konkurrenten in diese Märkte zu investieren, da in diesem Falle die Einnahmen für Nutzungsgebüh- ren der Systeme die Verluste an monopolistischer Rente übersteigen können. Die Anbieter befinden sich aber in einer verzwickten Lage: der zuerst einführende Anbieter kann hohe Gewinne erzielen, allerdings werden mit Einführung weiterer Systeme der anderen Anbieter nicht nur diese neuen Überschüsse reduziert, sondern auch die bisherigen nor- malen Gewinne.
Wenn eine Situation vorherrscht, in der wenige Anbieter sehr vielen Nachfragern gegenüberstehen, realisieren die An- bieter einen höheren Gewinn als die Nachfrager und sie tendieren eher zur Einführung Elektronischer Märkte, als die Nachfrager, bei denen die Anreizschwelle zu investieren sehr hoch ist, obwohl sie ja eigentlich der Nutznießer solcher Systeme sind. Außerdem stehen sich Nachfrager sehr oft einer Lage gegenüber, bei der einzelne Nachfrager die Vo rtei- le solcher Märkte genießen, auch wenn sie keine Investitionen tätigen. Dieser Effekt kann allerdings zu einer Situation führen, bei der die Einführung gänzlich unterbleibt. Auch ist es schwierig, genügend Nachfrager zu finden, um über- haupt eine solche, oft kostspielige Investition zu tätigen. Dieser Sachverhalt macht es den Anbietern einfacher, die Ent- wicklung Elektronischer Märkte zu unterbinden.
Unterschiedliche Suchkosten für Preis- und Produktinformation
In differenzierten Märkten existieren zwei Arten von Suchkosten, zum einen die für Preisinformationen, zum anderen die für Produktinformationen.
Zuerst wird der Fall betrachtet, dass nur Produktinformationskosten existieren. Ergebnis ist, dass es bei einer grossen Zahl von Anbietern für einen einzelnen Anbieter von Vorteil sein kann, vom Gleichgewichtspreis p* abzuweichen, da er in diesem Falle höhere Gewinne erzielen kann, weil sich durch den niedrigeren Preis sein Absatzintervall vergrößert und er dadurch mehr Nachfrager erreicht. Der höhere Absatz kompensiert den Verlust durch den niedrigeren Preis. Allerdings ziehen die anderen Anbieter nach und die Konsequenz ist, dass der Gleichgewichtspreis gleich 0 sein muss. Sind die Suchkosten für die Produktinformation sehr klein, können die Anbieter trotzdem einen positiven Preis verlan- gen, der sich aber mit zunehmender Anzahl an Konkurrenten 0 annähert. Produktinformationskosten haben im Ver- gleich zu Suchkosten für Preisinformation einen stärkeren Einfluss auf das resultierende Gleichgewicht. Sind die Kos- ten für Produktinformation der dominierende Teil der Suchkosten, dann haben Anbieter eher einen Anreiz mit ihrem Preis von p* abzuweichen.
Die zweite Situation, die Bakos untersucht, ist das Vorhandensein von Preisfindungskosten bei minimalen Suchkosten für Produktinformationen. Im Gleichgewicht mit Preis p* ist es für den Interessenten eines Produktes optimal, zuerst denjenigen Anbieter zu suchen, der das beste Produktangebot aufweist, da ja diese Kosten 0 sind und im Gleichgewicht alle Preise gleich. In diesem Gleichgewicht entsprechen die Preise dem monopolistischen Preis, da sonst die Anbieter ihre Preise erhöhen würden, ohne Reduzierung ihrer Einnahmen. Auch rücken sie von ihrem monopolistischen Preis nicht ab, da kein zusätzlicher Nachfrager gewonnen werden könnte. Im Gleichgewicht kauft der Nachfrager vom idea- len Anbieter, des halb reduzieren sich seine fit costs zum niedrigsten möglichen Level. Andererseits entfernen sich man- che Nachfrager aus dem Markt, wenn der Preis ihnen zu hoch ist, und es entsteht ein Wohlfahrtsverlust. Dieser Wohl- fahrtsverlust fällt mit steigender Anbieterzahl oder mit fallenden Preisfindungskosten und verschwindet gänzlich, falls die Anzahl der Anbieter groß genug ist. Um zu verstehen, wie dieses Ergebnis zustande kommt, ist es nötig die Motiva- tion des Nachfragers genauer zu betrachten. Denn er ist nicht nur bestrebt, einen niedrigeren Preis zu finden, sondern auch ein besseres Produkt. Wenn er schon vorher weiß, welches Produkt seinen Präferenzen am besten entspricht und wo er dieses erhält, dann ist sein Anreiz zu suchen reduziert.
Mögliche Strategien
Auf lange Sicht ist es für Unternehmen nicht möglich den Verlust von Marktmacht zu verhindern, denn wenn sie die Entwicklung Elektronischer Märkte unterbinden, veranlassen sie Nachfrager und Intermediäre, selber solche Systeme einzuführen. Die beste Strategie ist es, die Einführung solcher Systeme zu kontrollieren und möglichst die Produktsuche zu fördern, da dies zum einen die eigenen Gewinne erhöhen kann und es zum anderen eine Eintrittsbarriere für andere Unternehmen darstellt. Weiter können Preisvergleiche durch Schaffen sehr unübersichtlicher Preisangebote erschwert werden. Eine dritte Möglichkeit ist es, eine größere Produktdifferenzierung in Verbindung mit einem hohen Informati- onsservice.
Falls ihnen die notwendigen Ressourcen fehlen, haben die Nachfrager die Möglichkeit, sich zu Koalitionen zusammen- zuschließen und eigene Systeme einführen oder mit anderen Parteien zusammenarbeiten, die das nötige Wissen und Kapital besitzen.
Fazit
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Auswirkungen elektronischer Märkte auf Suchkosten und Markteffizienz?
Die Entwicklung elektronischer Märkte und des Internets beeinflusst die Markteffizienz, insbesondere durch die Senkung von Suchkosten. Dies führt zu veränderten Marktbedingungen für homogene und heterogene Güter, Anreizen für Investitionen und neuen Strategien für Anbieter und Nachfrager.
Wie beeinflussen elektronische Märkte Märkte mit homogenen Gütern?
Auf Märkten mit homogenen Gütern senken elektronische Märkte die Suchkosten, da Kunden leichter Informationen über Preise finden können. Dies führt zu niedrigeren Preisen, verstärktem Wettbewerb und Preiskriegen, was die Preise an das Niveau vollkommener Konkurrenz annähert und die Markteffizienz verbessert. Anbieter könnten versuchen, die Einführung solcher Systeme zu verzögern, um ihre Gewinne zu schützen.
Wie wirken sich Suchkosten auf Märkten mit differenzierten Gütern aus?
Auf Märkten mit differenzierten Gütern benötigen Kunden sowohl Preis- als auch Produktinformationen. Sinkende Suchkosten führen dazu, dass Kunden höhere Ansprüche haben und länger suchen, um ein Produkt zu finden, das ihren Vorstellungen entspricht. Wenn die Suchkosten null sind, gibt es einen einheitlichen Preis, der von den Fit-Kosten und der Anzahl der Anbieter abhängt. Hohe Suchkosten können im schlimmsten Fall zu einem Zusammenbruch des Marktes führen.
Welche Anreize haben Nachfrager, Anbieter und Intermediäre, in elektronische Märkte zu investieren?
Nachfrager investieren in elektronische Märkte, um Preise zu senken und ihren Nutzen zu maximieren. Anbieter investieren, wenn sie einen Anteil an den durch Effizienzsteigerung erzielten Gewinnen der Nachfrager abschöpfen können. Intermediäre können Gebühren für die Teilnahme an ihrem System erheben. Die Investitionen hängen von der Verteilung der Gewinne zwischen den Marktteilnehmern ab.
Wie können Suchkosten nach Preis- und Produktinformation aufgeteilt werden?
In differenzierten Märkten gibt es Suchkosten für Preis- und Produktinformationen. Wenn nur Produktinformationskosten existieren, kann es für Anbieter von Vorteil sein, vom Gleichgewichtspreis abzuweichen. Wenn nur Preisfindungskosten existieren, entspricht der Gleichgewichtspreis dem monopolistischen Preis, und es entsteht ein Wohlfahrtsverlust, wenn Kunden den Markt verlassen.
Welche Strategien können Unternehmen anwenden, um mit den Auswirkungen elektronischer Märkte umzugehen?
Unternehmen können die Einführung elektronischer Märkte kontrollieren, die Produktsuche fördern, Preisvergleiche erschweren und eine größere Produktdifferenzierung in Verbindung mit einem hohen Informationsservice anbieten. Nachfrager können sich zu Koalitionen zusammenschließen, um eigene Systeme einzuführen.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse über die Auswirkungen elektronischer Märkte?
Elektronische Märkte liefern Informationen zu Preisen und Produkten. In homogenen Warenmärkten verringern sinkende Suchkosten die Marktmacht und Gewinne der Unternehmen. In differenzierten Märkten können Suchkosten zusätzliche Gewinne generieren. Insgesamt ermöglichen sie dem Kunden, ein für ihn ideales Produkt zu finden und vermindern damit Allokationsineffizienzen.
- Quote paper
- Andreas Gimber (Author), 2001, Auswirkungen Elektronischer Märkte auf Suchkosten und Markteffizienz, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/101522