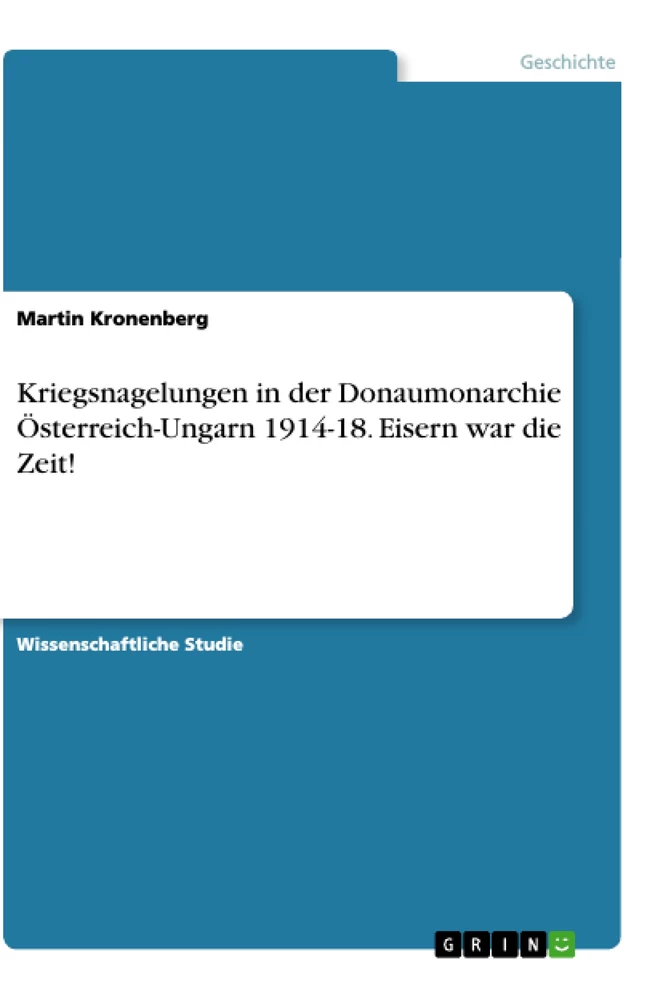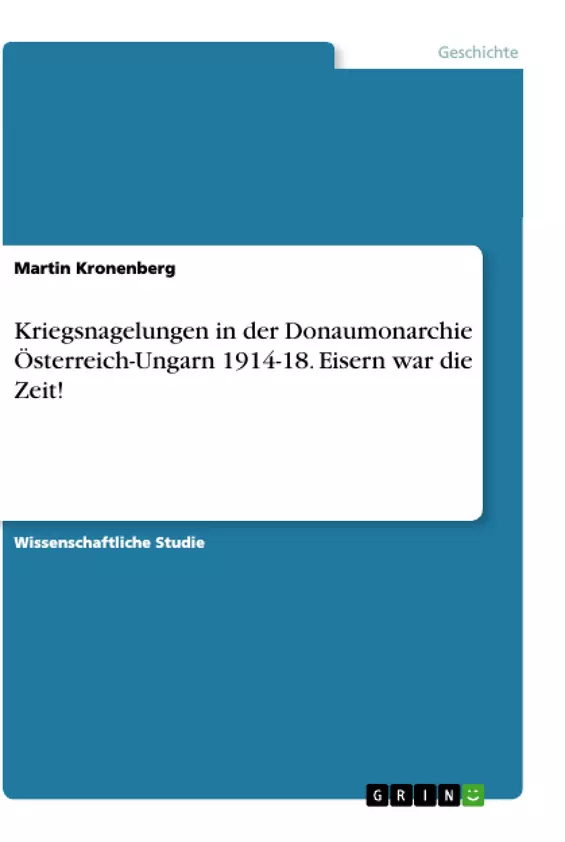Während die Zahl der Veröffentlichungen zum Ersten Weltkrieg nahezu unübersehbar ist, thematisieren nur einige wenige Autoren die Kriegsnagelungen in der Donaumonarchie Österreich-Ungarn. Deshalb wird in diesem Buch der Frage nachgegangen, mit welcher Zielsetzung, in welchem Umfang und mit welchem Erfolg Kriegsnagelungen durchgeführt worden sind.
Untersucht wird auch, welche Bedeutung das Militär, die Katholische Kirche und die Schulen für die Nagelungen hatten, welche Objekte benagelt wurden und wie die Einweihungsfeierlichkeiten verliefen. Mit diesem Buch wird erstmals eine Gesamtdarstellung der österreich-ungarischen Nagelungsaktionen im Ersten Weltkrieg vorgelegt. Sie enthält unter anderem eine katalogähnliche Zusammenstellung von etwa 1000 dokumentierten Nagelungsaktionen und 700 Bilder.
Die eigentliche Geschichte der Kriegsnagelungen beginnt am 6. März 1915 mit der feierlichen Einweihung des "Wehrmanns in Eisen" auf dem Schwarzenbergplatz in Wien. Dort hatte man eine mittelalterliche überlebensgroße Ritterfigur aus Lindenholz des Bildhauers Josef Müllner aufgestellt, in die jedermann gegen Zahlung eines bestimmten Betrages Spendennägel einschlagen konnte.
Die Nagelungsaktion, deren Erlös man für die Unterstützung der Witwen und Waisen verwendete, wurde ein großer Erfolg und breitete sich Epidemie artig in Österreich und Deutschland aus. Nahezu jede größere Gemeinde, viele karitativ tätige Vereine, wie zum Beispiel das 'Rote Kreuz' und das 'Silberne Kreuz', militärische Verbände, Kirchengemeinden und Schulen sowie Privatpersonen griffen den Gedanken auf und errichten Kriegswahrzeichen, um die kommunalen Sozialfonds aufzufüllen und Kriegsopfer unterstützen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Allgemeine Nagelungen – Ursprünge und Entwicklung
- Kriegsfürsorge
- Der k. k. Österreichische Militär‐Witwen‐ und Waisenfonds
- Unterstützungsvereine
- Forschungsstand und Quellenlage
- Überregional durchgeführte Nagelungsaktionen
- Wehrmänner, Wehrschilde und andere Spendenobjekte
- Der Wiener „Wehrmann in Eisen“ und andere Wehrmänner
- Der Wehrschild für den Bezirk Tulln und andere Wehrschilde
- Nagelungsobjekte (nicht Wehrschilde und Wehrmänner)
- Nagelungsähnliche Spendenaktionen
- Verzeichnis der Nagelungen
- Städte und Dörfer in alphabetischer Reihenfolge
- Nagelungen im Ausland
- Die Bedeutung des Militärs für die Spendennagelungen
- Nagelungen in Kasernen
- Militärische Nagelungen für die Öffentlichkeit
- Militärische Nagelungen an der Front
- Polnische Legionen
- Die Bedeutung der Kirche für die Nagelungen
- Die katholische Kirche als Initiator bzw. Veranstalter von Benagelungsaktionen
- Teilnahme an kommunalen und militärischen Nagelungen
- Aufbewahrung von Kriegswahrzeichen in bzw. an Kirchen
- Die Bedeutung der Schulen für die Nagelungen
- Interne Schulnagelungen
- Schulnagelungen, an denen auch die Öffentlichkeit teilnahm
- Teilnahme von Schulen an kommunalen und militärischen Nagelungen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch "Eisern war die Zeit!" von Martin Kronenberg befasst sich mit den Spendennagelungen in der Doppelmonarchie Österreich‐Ungarn während des Ersten Weltkriegs. Das Werk analysiert die Entstehung, Verbreitung und Bedeutung dieser Aktionen und beleuchtet dabei die unterschiedlichen Motivationen der Beteiligten, die Rolle der beteiligten Organisationen und Institutionen sowie die Bedeutung der Spendenaktionen für die Kriegsfürsorge.
- Die Entstehung und Entwicklung der Spendennagelungen
- Die vielfältigen Formen und Motive der Nagelungsobjekte
- Die Rolle der Kirche, des Militärs und der Schulen bei der Organisation und Durchführung von Spendennagelungen
- Die ideologische Bedeutung der Spendenaktionen für die ‚Heimatfront‘
- Die finanziellen Ergebnisse der Spendenaktionen und die Verwendung der Spendengelder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt zunächst in die allgemeine Geschichte der Kriegsnagelungen ein und erläutert die Unterschiede zur Benagelung von Kriegswahrzeichen in der Antike und im Mittelalter. Anschließend werden die wichtigsten Organisationen und Institutionen vorgestellt, die sich in der Kriegsfürsorge engagierten, insbesondere der k. k. Österreichische Militär‐Witwen‐ und Waisenfonds. Abschließend werden die Forschungsfragen und die Quellenlage der Arbeit vorgestellt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den überregional durchgeführten Spendenaktionen, wie z. B. der Aktion „Wehrmann in Eisen“ in Wien, der Wehrschildaktion für Schulen und der Aktion „Gold gab ich für Eisen“ des Österreichischen Silbernen Kreuzes.
Kapitel drei bietet einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Formen und Motive der benagelten Kriegswahrzeichen, wie z. B. die „Wehrmänner in Eisen“, „Wehrschilde“ und „Kriegstische“. Neben der Beschreibung der wichtigsten Nagelungsobjekte werden auch die Gestaltungsmotive und Schildformen der jeweiligen Objekte beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem wichtigen Phänomen der österreichisch‐ungarischen Kriegsfürsorge – den Spendennagelungen. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Jahre 1914‐18 und beleuchtet die verschiedenen Facetten dieser komplexen Aktion. Dabei werden die wichtigsten Akteure wie das Militär, die Kirche und die Schulen vorgestellt und ihre Rolle bei der Organisation und Durchführung von Spendennagelungen untersucht. Darüber hinaus werden die ideologischen und sozialen Bedeutungen der Spendenaktion sowie die Verwendung der Gelder für die Kriegsfürsorge beleuchtet. Die Arbeit verwendet zeitgenössische Quellen, vor allem Zeitungsberichte, um einen möglichst detaillierten und umfassenden Einblick in die Geschichte der Kriegsnagelungen zu geben.
- Quote paper
- Dr. Martin Kronenberg (Author), 2021, Kriegsnagelungen in der Donaumonarchie Österreich-Ungarn 1914-18. Eisern war die Zeit!, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1014845