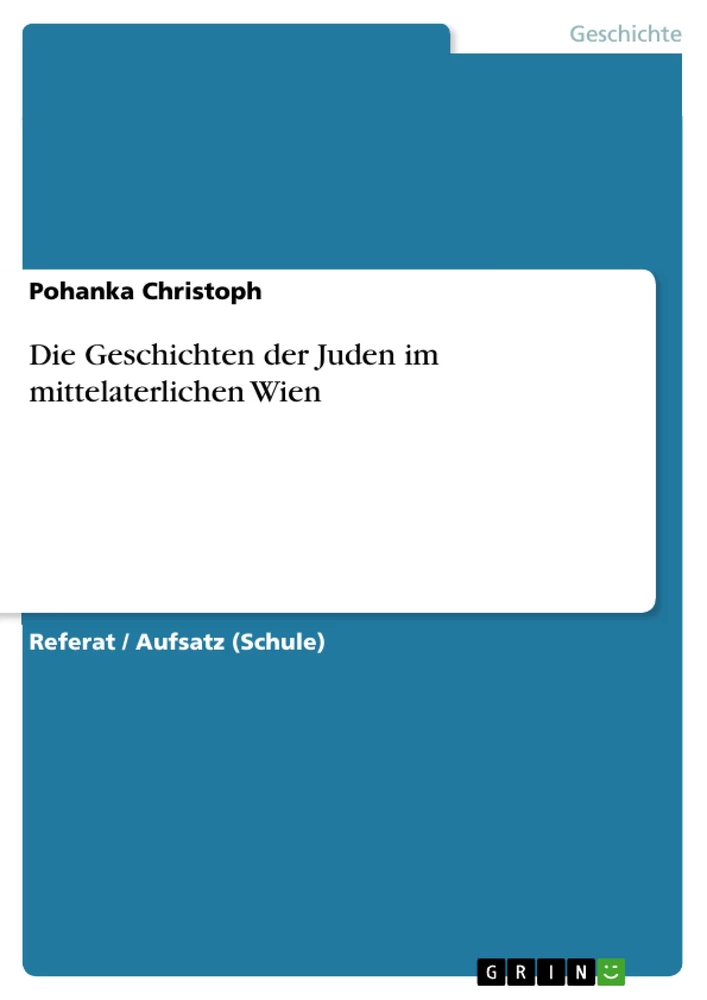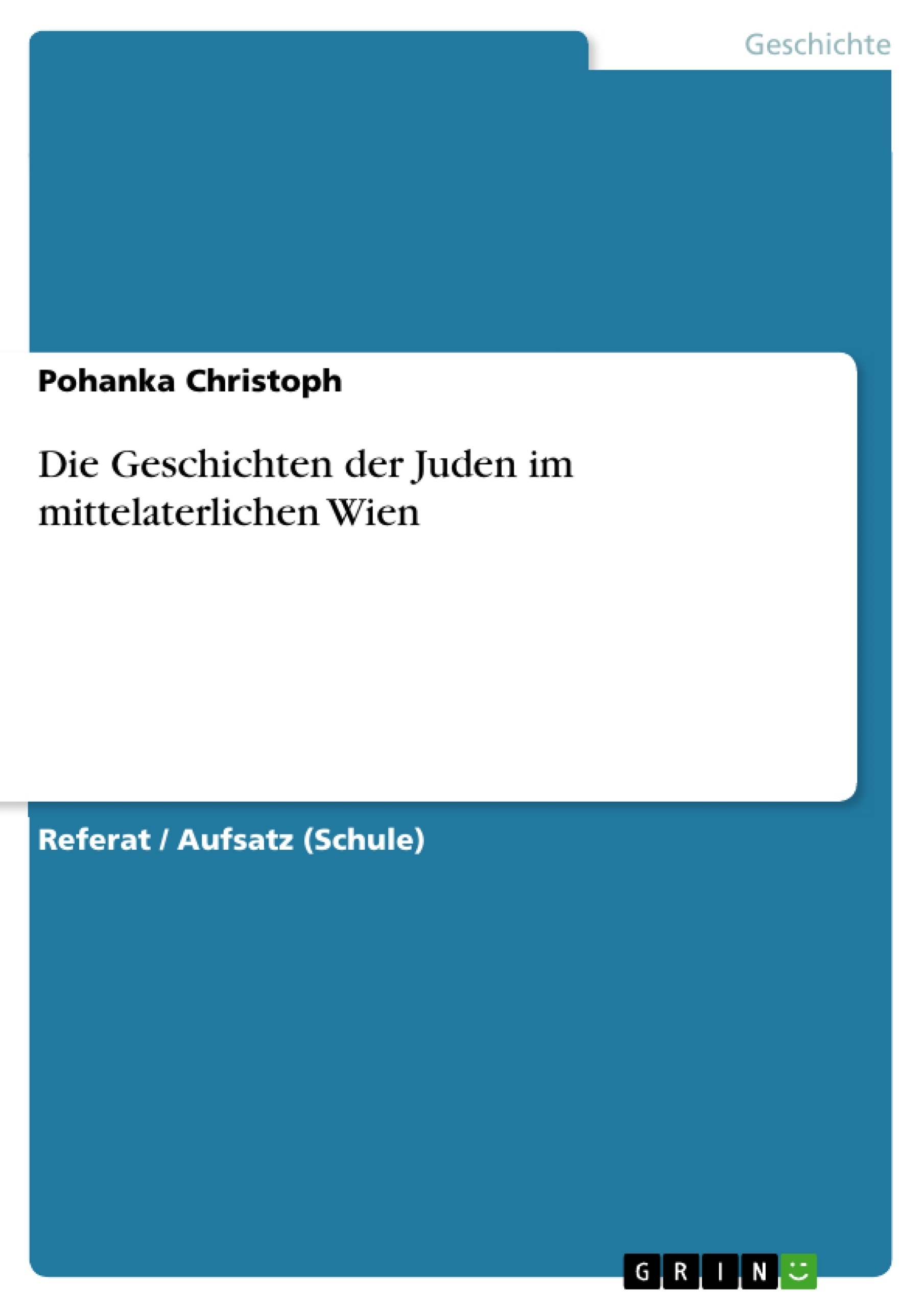Stellen Sie sich vor, Sie wandern durch die verwinkelten Gassen des mittelalterlichen Wiens, wo sich hinter unscheinbaren Fassaden eine pulsierende jüdische Gemeinde verbirgt, deren Geschichte reich an kultureller Blüte, religiöser Hingabe und wirtschaftlicher Bedeutung ist. Dieses Buch öffnet ein Fenster in eine faszinierende Epoche, in der Wiener Juden, vom angesehenen Münzmeister Schlom unter den Babenbergern bis zur tragischen Vernichtung der Gemeinde in der Wiener Geserah von 1421, das soziale, wirtschaftliche und religiöse Leben der Stadt maßgeblich prägten. Erforschen Sie die Organisation der Gemeinde, von der prächtigen Wiener Synagoge, deren Grundmauern unter dem Judenplatz wiederentdeckt wurden, bis hin zu den rituellen Bädern (Mikwe) und dem Friedhof vor den Toren der Stadt. Tauchen Sie ein in den Alltag der Wiener Juden, ihre Bildung, Erziehung, Kleidung, Speisen und Feste, und gewinnen Sie Einblicke in ihre Beziehungen zu Christen, ihre Frömmigkeit und ihren Aberglauben. Entdecken Sie die wirtschaftlichen Grundlagen der Gemeinde, vom Geldhandel und Fernhandel bis zum Handwerk, und verstehen Sie, wie die Juden als Geldverleiher, Händler und Gewerbetreibende zum wirtschaftlichen Aufstieg Wiens beitrugen. Lernen Sie die "Österreichischen Weisen" kennen, Rabbiner wie Rabbi Issak Or Sarua und Rabbi Meir ben Baruch Segal, deren Schriften das europäische Judentum nachhaltig beeinflussten, und erfahren Sie mehr über die Besonderheiten des Wiener Ritus und die vielfältigen Bräuche und Traditionen, die das jüdische Leben in Wien auszeichneten. Beleuchtet werden auch die Schattenseiten dieser Epoche: der mittelalterliche Antijudaismus, der Vorwurf der Hostienschändungen, die Pestpogrome und schließlich die Vertreibung und Vernichtung der Wiener Juden in der Geserah von 1421, ein tragisches Ereignis, das die jüdische Gemeinde Wiens für fast ein Jahrhundert auslöschte. Dieses Buch ist eine fundierte und bewegende Darstellung des jüdischen Lebens im mittelalterlichen Wien, die auf umfangreichen historischen Quellen basiert und ein lebendiges Bild einer vergessenen Welt zeichnet. Es ist ein unverzichtbares Werk für alle, die sich für die Geschichte Wiens, des Judentums und des Mittelalters interessieren, und bietet neue Perspektiven auf das Zusammenleben von Juden und Christen und die Ursachen und Folgen des Antijudaismus. Keywords: Wiener Juden, Mittelalter, Geschichte, Wien, Geserah, Synagoge, Judenplatz, Judentum, Antijudaismus, Rabbiner, Gemeinde, Kultur, Wirtschaft, Religion, Pogrom, Österreich, Mittelalterliches Wien, Jüdische Geschichte, Wiener Geserah, Rabbi Issak Or Sarua, Juden im Mittelalter, Geschichte der Juden, Wiener Synagoge, Mittelalterliche Geschichte, Österreichische Geschichte, Jüdische Kultur, Stadtgeschichte Wien.
INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung
Vorwort
A. GESCHICHTE DER JUDEN IN WIEN
A.1. Die Wiener Juden unter der Babenbergern
A.1.1. Die ersten Wiener Juden
A.1.2. Die Juden zwischen Herzog Friedrich II. und Kaiser Friedrich II.
A.2. Die Juden unter Ottokar Przemysl, König von Böhmen
A.2.1. Antijüdische Gesetzgebung unter Ottokar
A.3. Die Zeit der frühen Habsburger
A.3.1. Der Vorwurf der Hostienschändungen
A.3.2. Albrecht II.
A.3.3. Der Hostienfrevel von Pulkau
A.3.4. Die Pest von 1349/50
A.3.5. Rudolf IV. der Stifter
A.3.6. Albrecht III.
A.4. Die Wiener Geserah und die Vernichtung der jüdischen Gemeinde von Wien
B. DIE GEMEINDE DER JUDEN IN WIEN
B.1. Organisation
B.2. Die Bauwerke
B.2.1. Die Wiener Synagoge
B.2.2. Die Mikve
B.2.3. Der Friedhof
B.3. Die Mitglieder der Gemeinde
B.3.1. Der Kantor
B.3.2. Der Synagogendiener (Schammes)
B.3.3. Die Leitung der Gemeinde - Gemeindevorstand, Rabbiner und Judenmaister
B.4. Die Aufgaben der Gemeinde
B.4.1. Steuern und Abgaben
B.4.2. Das Rabbinatsgericht ( Bet Din )
B.5. Die Religion
B.5.1. Das Rabbinat
B.5.1.1. Die Österreichischen Weisen ( Chachme Österre ich )
B.5.1.1.1. Rabbi Issak Or Sarua
B.5.1.1.2. Rabbi Avigdor b. R. Elija Ha-Kohen
B.5.1.1.3. Rabbi Meir b. Baruch Segal
B.5.1.2. Der Ritus und seine Wiener Besonderheiten
B.5.1.2.1 Die Mesusa
B.5.1.2.2. Schaufäden (Zizit)
B. 5.1.2.3. Lesung aus der Thorarolle und von den Propheten.
B. 5.1.2.4. Segenssprüche
B.5.1.2.5. Gebete
B.5.1.2.6. Ikuv Ha-Tefilla
B.5.1.3. Die Feste
B.5.1.3.1. Das Pessach Fest
B.5.1.3.2.Omer Zählung
B.5.1.3.3.Der Fasttag Tischa Be-Av
B.5.1.3.4. Das Neujahrsfest (Rosch Ha-Schana )
B.5.1.3.5. Der Versöhnungstag ( Jom Kippur )
B.5.1.3.6. Das Laubhüttenfest ( Sukkot )
B.5.1.3.7. Das Tempelweihfest ( Chanukka )
B.5.1.3.8. Das Losfest ( Purim )
B.5.1.4 Speisevorschriften
B.5.1.5 Persönliche Vorschriften
B.5.1.5.1. Familienvorschriften ( Taharat Ha-Mischpacha )
B.5.1.5.2. Beschneidung ( Brit Mila )
B.5.1.5.3. Zehent aus Einkünften
B.5.1.5.4. Trauervorschriften
B.5.1.5.5. Heirat und Scheidung
C. DAS JÜDISCHE LEBEN IN WIEN
C.1. Bildung
C.2. Erziehung
C.3. Die Judenstadt und ihre Häuser
C.4. Kleidung
C.5. Essen und Trinken
C.6 Der S habbat
C.7. Familienfeste
C.8 Spiele
C.9. Volks- und Aberglaube
C.10. Verbrechen
C.11. Beziehungen zu Nichtjuden
C.12. Getaufte Juden
D. WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN
D.1. Der Geldhandel
D.2. Der Handel
D.3. Das Gewerbe
E. SCHLUSSWORT
F. GLOSSAR
G. BIBLIOGRAPHIE
H. BILDNACHWEIS
Mödling, am 13. Februar 2000
VORWORT
Für das Thema „Die Wiener Juden im Mittelalter“ begann ich mich in den Jahren 1998 und 1999 zu interessieren. In den Sommermonaten dieser Jahre war ich als Aufseher im „Jüdischen Museum der Stadt Wien“ beschäftigt. Dies weckte in mir die Neugier, über das jüdische Volk und vor allem über die Wiener Juden mehr zu erfahren.
Doch alle Exponate des Museums kamen aus der Zeit nach dem Mittelalter. Warum war das so? Auf Grund erster Nachforschungen entdeckte ich das Fehlen von jedweder Literatur zum Thema „Juden im Mittelalter“. Allerdings war ich mir sicher, dass sie existiert hatten, und so machte ich mich auf die Suche nach den spärlichen Spuren, die sie hinterlassen haben.
Im Laufe meiner Nachforschungen fand ich heraus, dass gerade das Mittelalter reich an jüdischer Kultur gewesen war und dass die Wiener Gemeinde zu einer der bedeutendsten in Europa gehört hatte. Diese Arbeit ist das Ergebnis jener Spurensuche, die ich unternommen habe, um über ein Kapitel österreichisch-jüdischer Geschichte mehr zu erfahren.
EINLEITUNG
Die Geschichte der Wiener Juden im Mittelalter ist, verglichen mit der Dauer der Besiedelung Wiens im Mittelalter, nur kurz. Knapp 230 Jahre lang können wir die Existenz einer jüdischen Gemeinde nachweisen, von Leopold V. um 1190 bis zur Vernichtung der jüdischen Gemeinde Wiens in der Geserah im Jahre 1421.
In dieser Zeit, die in Österreich und auch in Europa eine Zeit des Umbruchs war - in Österreich erfolgte der Wechsel der Dynastien von den Babenbergern zu den Habsburgern, in Europa herrschte der Streit zwischen dem Kaisertum und dem Papst - entstand in Wien eine blühende jüdische Gemeinde, die bald zu den größten und wegen ihrer Gelehrsamkeit zu den berühmtesten Europa gehörte.
Erst vor wenigen Jahren konnten die Reste der Synagoge der Gemeinde, der Mittelpunkt ihres sozialen und religiösen Lebens, unter dem Pflaster des Wiener Judenplatzes wiedergefunden werden, ein kleiner, eher einfacher Bau, der aber dennoch eine der größten Synagogen im mittelaterlichen Europa gewesen ist. Erhalten hat sich davon kaum etwas, nur die untersten Schichten der Grundmauern haben dem Hass der Wiener im Jahre 1421 widerstanden, als man die Synagoge abriss, um das Andenken an die Juden völlig aus der Stadt zu tilgen.
Das Leben der Juden im Wien des Mittelalters war sicher nicht einfach. Zwar für fast 200 Jahre geachtet wegen ihrer Künste als Bankiers und Finanziers, verachtet wegen ihrer fremden Sitten und Bräuche, missverstanden in ihrer religiösen Anschauung und am Schluss gehasst, weil man ihnen nachsagte, Verbrechen gegen Christen zu begehen. Daneben konnte man aber lange Zeit in Wien nicht auf die Juden verzichten, die Finanzkraft der Stadt, ihrer Bürger und auch des Landesherren hing oftmals von ihren Finanzkünsten und auch von ihren Steuern ab, die sie zu zahlen hatten, nur um in der Stadt leben zu dürfen.
Mit der Vernichtung der jüdischen Gemeinde Wiens in der Wiener Geserah von 1421, die im Übrigen kein singuläres Ereignis für Wien, sondern zu dieser Zeit nur eines von vielen Pogromen war, die in Europa geschahen, kam für fast 100 Jahre das Ende der jüdischen Besiedelung Wiens, kein Jude wollte in „Erez Hadamim“ , dem Blutland, leben. Trotz aller Tragik der Wiener Geserah und aller Grausamkeiten, welche die Wiener ihren jüdischen Mitbürgern angetan haben, darf man den mittelalterlichen Antijudaismus in keinem Falle mit dem Antisemitismus der Nationalsozialisten im 20. Jahrhundert gleichsetzen. Der mittelalterliche Antijudaismus war stets religiös verstanden, änderte ein Jude seine Religion, konvertierte er zum Christentum, so war er ab diesem Zeitpunkt von jeder Verfolgung ausgenommen. Anders als unter den Nazis kennt das Mittelalter keine rassistische Verfolgung von Juden, für den mittelalterlichen Menschen und die Kirche zählt das Bekenntnis zum Christentum allein, die Reihe der Ahnen oder die Abstammung ist egal.
Trotz der Vorteile, die im Mittelalter eine Konversion zum Christentum für die Juden mit sich brachte, hören wir in den Dokumenten kaum davon, Zeichen dafür, dass sich die Juden ihrer Stellung als besondere Gruppe bewusst waren und sehr wohl ihre Religion und Tradition achteten. Das, was für die Wiener Bürger vielleicht das Fremde war, der enge Zusammenhalt in der Gemeinschaft, das Beharren auf ihren strengen Regeln und fremden Bräuchen war die Klammer, welche eine Gemeinschaft zusammenhielt, die sich in einer nicht immer freundlich eingestellten Umwelt zu behaupten hatte.
Wenn es heute aber möglich ist, dass der Wiener Kardinal Schönborn am Judenplatz eine Tafel enthüllt, in deren Text sich die Kirche zu ihrer Mitverantwortung für den Antijudaismus des Mittelalters bekennt, so ist das ein Zeichen, dass die Existenz der Gemeinde im Mittelalter nicht vergebens war. Hier wurde im Kleinen das Zusammenleben geprobt, hier wurde auch die Katastrophe des 20. Jahrhunderts, die Shoah, geprobt, hier wurde aber auch die Grundlage des Verständnisses für das Verstehen von Christen und Juden gelegt, die in Wien für 230 Jahre die selbe enge Stadt geteilt und miteinander auszukommen hatten.
Die Probleme bei der Darstellung des mittelalterlichen Judentums in Wien hat Klaus Lohrmann genau beschrieben:
„ Die Geschichte der Juden in Wien lässt sich nicht in Form einer fortlaufenden Erzählung darstellen. Der Grund dafür ist nicht etwa eine besondere methodische Problematik, der man sich als Geschichtsschreiber gegenübersteht, sondern die Einsicht, dass nur bestimmte Bereiche der jüdischen Gesellschaft durch zeitgenössische Erzählungen und Urkunden genügend erhellt werden und anderes für uns unverständlich und unbekannt bleibt. Zu großsind die Lücken der Ü berlieferung, zu stark veränderten sich die Fragestellungen an die Vergangenheit im Laufe der letzten 100 Jahre, um ein befriedigendes Verständnis aus einer bloßen Erzählung zu gewinnen, die immer wieder vom Eingeständnis des Nichtwissens unterbrochen sein müsste. “ 1
A. GESCHICHTE
A.1. Die Wiener Juden unter den Babenbergern
A.1.1. Die ersten Wiener Juden
Der erste urkundlich bezeugte Jude Wiens war Schlom (Salomon), der unter Herzog Leopold V. (1177-1194) um 1193/94 nach Wien kam, wo ihn der Herzog zu seinem Münzmeister ernannte. In dieser Funktion hatte er die Münzherstellung als unabhängige Kontrollinstanz für den Herzog, der diese den Hausgenossen, einem Gremium von Wiener Bürgern, übergeben hatte, zu überwachen. Die Einrichtung der Wiener Münzstätte unter Leopold V. und damit auch die Berufung Schloms dürfte mit der Auszahlung des Lösegelds für den englischen König Richard Löwenherz, den Leopold einige Jahre zuvor gefangengenommen hatte, zusammengefallen sein.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1 : Erste Erwähnung von Münzmeister Schlom
Seit dem frühen Mittelalter wurden Juden von christlichen Fürsten und Herrschern als Münzmeister und zur Verwaltung des Staatshaushaltes herangezogen, da sie als Träger einer aus der Antike stammenden Wirtschaftstradition Kenntnisse des Geldwesens und technische Ü berlegenheit in Handelsfragen besaßen und ihre Verwendung in den finanziellen Zweigen des Staatswesen günstig war , sobald in den neuen Staaten die primitivsten Stufen reiner Naturalwirtschaftüberwunden waren. 2
In seiner Eigenschaft als angesehenes Mitglied der herzoglichen Landesverwaltung durfte Schlom auch als Jude, entgegen den im Deutschen Reich herrschenden Vorschriften, christliche Hausangestellte haben und Grund und Boden erwerben.
Das Privileg auf Grundbesitz ist durch einen Rechtsstreit Schloms mit dem Kloster Formbach um einen Weingarten dokumentiert, bei dem Schlom zwar verlor, dies aber nicht aufgrund von mangelnder Besitzfähigkeit, sondern da der Herzog nicht gegen das Kloster entscheiden konnte, wenn einer der Streitpartner Jude war.
Es ist aber bezeichnend, dass selbst der herzogliche Schutz nicht ausreichte, um Schlom in den judenfeindlichen Wirren, die dem Aufruf zum 3 Kreuzzug folgten , zu beschützen. Ephraim Jakob, jüdischer Chronist des Mittelalters, schreibt am Ende des Jahres 1196 über Schloms Tod:
Ein christlicher Dienstbote des Juden hatte seinen Herren bestohlen und war dafür ins Gefängnis geworfen worden. Die Frau des Diebes beschwerte sich bei durchreisenden Kreuzfahrern, dass ihr Mann wegen eines Juden eingesperrt sei, woraufhin die aufgebrachten Pilger in Schloms Haus eindrangen und ihn sowie 15 weitere Juden erschlugen. 3
Friedrich I. (1195-1198) ließ daraufhin die Kreuzfahrer hinrichten, obwohl diese unter dem päpstlichen Schutz standen. Dies geschah aber wahrscheinlich eher aufgrund der Tatsache, dass Schlom Mitglied des herzoglichen Hofes und nicht weil er Jude war und das Verbrechen kein religiöses Motiv hatte.
Schloms soziale Stellung im Wien der Babenberger lässt aber deutlich erkennen, dass der erste nachgewiesene Wiener Jude ein angesehener Mann war der in seinen Rechten gegenüber seinen christlichen Mitmenschen gleichgestellt war.
Auffallend ist, dass Schlom in Wien erheblichen Grundbesitz vorzuweisen hatte. Er besaß vier Häuser, die alle um die „Schola Judeorum“, der Wiener Synagoge, gelegen waren. Bemerkenswert deshalb, da den Juden ursprünglich weder das Wohnen unter Christen noch der Erwerb von Häusern und Baugrund gestattet war. Die Ausnahme für Schlom ist eventuell dadurch zu erklären, dass es in Wien zur Zeit Herzog Leopolds V. nur eine geringe jüdische Bevölkerung gab und die Juden somit in den Augen der Bürgerschaft noch keine Konkurrenz auf wirtschaftlichem Gebiet darstellten..4
Die Juden, die um 1200 in Wien wohnten, waren Spezialisten, die hohe öffentliche Ämter innehatten und somit auch dem Schutz des Herzogs unterstellt waren.
Ihre Funktion am Herzogshof fand auch Ausdruck in der Wahl des Areals der Judenstadt nördlich der herzoglichen Residenz am Platz Am Hof rund um den heutigen Judenplatz. Durch diese Konzentration der jüdischen Gemeinde wurde einerseits die Absonderung der Juden in den kommenden Jahrhunderten gefördert bzw. vereinfacht, da sie ja schon in einem eigenen Bereich der Stadt lebten, anderseits war die Konzentration auch Schutz vor einer judenfeindlichen Umwelt. Auf dem Judenplatz befand sich später auch die Wiener Synagoge die im Zuge der Wiener Geserah von 1421 zerstört wurde.
Als nächster nachweislich bekannter Jude in Wien wird Teka genannt, der im Friedensvertrag zwischen Herzog Leopold VI. und König Andreas von Ungarn als Bürge genannt wird. Teka war ein reicher und einflussreicher Jude im Dienste des Herzoges und besaß als „Pächter der Einkünfte der königlichen Kammer“ den Titel „Comes“ oder Graf, sein Reichtum wird durch die Summe von 2000 Silbermark dokumentiert, die er als Pfand beim Friedensschluss hinterlegen musste.5
A.1.2. Die Juden zwischen Herzog Friedrich II. und Kaiser Friedrich II.
Unter Herzog Friedrich II. (1230-1246) gestaltete sich das Zusammenleben zwischen Juden und Christen in Wien ohne Probleme. Obwohl es den Juden laut kanonischem Recht verboten war christliche Bedienstete zu beschäftigen, wurde dies in Wien toleriert, da die Juden in Wien zur sozialen Oberschicht zählten und dadurch bestimmte Sonderrechte hatten, waren sie rechtlich dem Kaiser untertänig, was aber im täglichen Umgang nicht unbedingt beachtet wurde. Die rechtliche Stellung der Juden in Wien war damit wesentlich besser als die ihrer deutschen Glaubensgenossen. Sie besaßen in großen Teilen des täglichen Lebens Autonomie und so konnten sich, besonders ab dem 13. Jahrhundert, die jüdischen Gemeinden in Österreich ungehindert entwickeln.
Während der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wanderten immer mehr Juden aus dem Rheinland und aus Italien nach Wien zu, dies stand wohl im Zusammenhang mit der Entwicklung des Fernhandels und den damit immer größeren benötigten Summen an Bargeld. Da Friedrich II. in zahlreiche Kriege verwickelt war, in den sechzehn Jahren seiner Herrschaft befehdete sich der kämpferische Herzog mit all seiner Nachbarn, kirchlichen Würdenträgern, dem deutschen Kaiser, einigen Ministerialen sowie der Stadt Wien, und einen stets steigenden Geldbedarf hatte, förderte er die Ansiedlung von Juden in Wien. In der Erkenntnis der Bedeutung der jüdischen Bevölkerung in Bezug auf ihre Steuerleistung und ihre Finanzkraft, die er braucht, um seine Kriege finanzieren zu können, sowie in der Leistung der Juden als Träger des Fernhandels, erließ er das so genannte „Fridericianum“, die erste österreichische Judenordnung, welche die Rechte und Pflichten der Juden eindeutig festlegte.6
Das „Fridericianum“, welches für alle weiteren Judenordnungen Vorbild wurde, geht auf den Konflikt zwischen Herzog Friedrich II. mit Kaiser Friedrich II. zurück, in dessen Folge der Kaiser große Teile Österreichs eroberte und unter anderem auch die Stadt Wien einnahm. In seinem Bemühen die Bürger für sich zu gewinnen, die sich gegenüber den von Herzog Friedrich II. geschützten Juden benachteiligt fühlten, ließ der Kaiser eine weitere Verordnung in das Wiener Stadtrecht aufnehmen, die es keinem Juden gestattete, ein öffentliches Amt auszuführen. Grund für den Passus war, dass immer mehr Christen in bisher jüdisch besetzte hohe Verwaltungsämter vorstießen und sich unliebsamer Konkurrenz auf diesem einfachen Weg entledigen wollten. 1238 zerfiel allerdings die Allianz gegen Herzog Friedrich II. und der kaiserliche Reichsstatthalter kontrollierte nur mehr einen kleinen Landstrich um Wien.
Das führte dazu, dass nun Kaiser Friedrich die Gunst der Wiener Juden und ihre Finanzkraft brauchte, um seinen im Schwinden befindlichen Einfluss in Österreich zu sichern. Im Zuge einer Aufwertung der jüdischen Gemeinden erließ er daher eine Judenordnung, die sich nicht von jener unterschied, die er 1236 im Reich ausgestellt hatte. Damit konnte er den judenfreundlichen Herzog Friedrich II. seiner wichtigsten Geldquelle berauben, denn nun standen die Juden unter Reichsrecht und nicht mehr unter herzoglichem Recht, dies bedeutet, dass die Steuern der Juden an den Kaiser abzuführen waren und diese von ihm im Gegenzug daher Schutz erwarten konnten. Als es im Dezember 1239 zur Aussöhnung zwischen Herzog und Kaiser kam und 1240 der Herzog auch wieder in Wien einziehen konnte, wurden die Juden wieder der Herrschaft Herzog Friedrichs II. unterstellt, der im Gegenzug für ihre Unterstützung ihre Privilegien im „Fridericianum“ von 1244 festschreiben ließ.7
Der Inhalt des „Fridericianum“ und seine Auswirkung auf die jüdische Gemeinde in Wien bestimmten bis zur Übernahme Österreichs durch die Habsburger das Leben der Juden in Österreich.
Primär wurde die Judenordnung Kaiser Friedrichs II. offiziell aufgehoben. Eine der Konsequenzen war nun, dass auch Juden wieder öffentliche Ämter besetzen durften.
Des weiteren, und dies ist der wichtigste Passus, wurde ihnen nun der Status von Geldverleihern zugewiesen und ihr früherer Status als Kaufleute so gut wie aberkannt: „ In nicht weniger als elf Artikeln wird von ihren Darlehensgeschäften gesprochen, und nur ein einziger erinnert in bescheidener Weise an ihre frühere Stellung als Kaufleute hin “ 8. Dies wird auch in späteren Judenprivilegien übernommen und keine Urkunde späteren Datums verzichtete darauf, dieses Faktum nicht besonders hervorzuheben. Damit wird der Ausschluss der Juden von allen Gewerben im Spätmittelalter vorbereitet und ihre Tätigkeit auf den Status des Geldhandels reduziert, welcher den Christen wegen des kirchlichen Zinsverbotes nicht erlaubt sein sollte. Dies führte in der Folge zum Topos des jüdischen Wucherers ohne zu bedenken, dass der Geldhandel und das Kreditgeschäft zu den wenigen erlaubten jüdischen Tätigkeiten zählten, und dies führte in weiteren Konsequenz immer wieder zu Pogromen unter der jüdischen Bevölkerung bis hin zur Auslöschung ganzer Gemeinden in Europa im 15. Jahrhundert.
Doch der weitaus größere Teil des „Fridericianums“ beschäftigt sich mit dem Recht und dem Rechtsanspruch der Juden in Wien und in anderen Städten.
Die Urkunde besagt, dass Juden in jüdischen Angelegenheiten nur in der Synagoge vor Gericht zu stellen seien und dass sie in der städtischen Rechtssprechung nur dem so genannten „Judex Judeorum“ (Judenrichter), einem dafür bestimmten christlichen Richter, unterliegen und nicht den Stadtrichtern wie die christlichen Bürger der Stadt.
Die autonome jüdische Gerichtsordnung wird im „Fridericianum“ zwar nicht erwähnt, es ist aber bekannt, dass der Herzog die Urteile, die von den rein jüdischen Gerichten betreffend Streitigkeiten unter Juden gefällt wurden, anerkannte.
Der Schutz der Juden gegenüber christlichen Übergriffen wurde ausgebaut, so wurden schwere Geldstrafen angedroht, falls jemand jüdische Sakralgegenstände entweihte oder schlecht über die Synagoge sprach, für den Fall, dass jemand den jüdischen Friedhof verwüsten sollte, wurde sogar die Todesstrafe angedroht.
Von Juden geschworene Eide wurden denen eines Christen gleichgestellt, allerdings nur dann, wenn keine der beiden Streitparteien in einem Prozess Zeugen oder Beweise vorlegen konnte. Die Zeugen mussten von der klagenden Partei gestellt werden und mussten sowohl christliche als auch jüdische Mitglieder beinhalten, ebenso wurden jüdische Urkunden und Siegel vom Gericht als Beweismittel anerkannt.
Der Schutz der Juden wurde auch auf das Hehlerrecht ausgedehnt, das vorsah, dass sie nicht bestraft werden konnten, wenn sie gestohlenes Gut kauften und weiterverkauften, wenn sie durch einen Eid bezeugten, dass sie nicht wussten, dass es gestohlen sei.9
A.2. Die Juden unter Ottokar Przemysl, König von Böhmen
Friedrich II. starb am 15. Juni 1246 in der Schlacht an der Leitha gegen die Ungarn, damit erlosch die männliche Linie der Babenberger und das Reichslehen fiel an den Kaiser zurück. Kaiser Friedrich II., in jener Zeit unter Kirchenbann stehend, hatte nicht die Macht im weit entfernten Österreich seine Ansprüche auf die Neuvergabe Österreichs als Lehen durchzusetzen, was zum Interregnum in den Babenbergischen Besitzungen führte. In der Folge versuchten verschiedene Herrscher aus umliegenden Reichen bzw. babenbergische Secundogenituren sich Österreichs zu bemächtigen, bis sich im Herbst 1251 der böhmische und mährische König Ottokar Przemysl, seine Ansprüche resultierten aus seiner Heirat mit Margarete, der Tochter Leopolds VI., mit Hilfe des österreichischen Kleinadels und der Wiener Bürgerschaft durchsetzen konnte. Ottokar wurde vor allem von den Städten freudigst begrüßt, da besonders der Wiener Fernhandel im Weiterverkauf nach Norden und Osten orientiert war und man sich Handelsvorteile erhoffte, Opposition kam vor allem vom Großadel, der traditionell nach dem Deutschen Reich hin orientiert war.
Doch solange das Interregnum, das eingetreten war, als der letzte Stauferkaiser Konrad IV und sein Sohn Konradin 1268 gestorben waren, anhielt, hatte Ottokar in Österreich keine ernstzunehmende Opposition zu befürchten, er konnte sich im Gegenteil begründete Hoffnungen auf den deutschen Kaiserthron machen.10
Die Rechte und Pflichten der Juden wurden von Ottokar nicht angegriffen. Es kam zu einer Blütezeit der „Weisen“ in Österreich, einer Gruppe von Rabbinern und Thoragelehrten, die wohl auch schon unter den Babenbergern tätig gewesen waren, aber erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts in ihrer Lehrtätigkeit und in ihren Publikationen ihre Blütezeit erreichten.
Ottokar förderte die Juden in Wien natürlich nicht uneigennützig. Der böhmische König brauchte zur Festigung seines Machtbereiches im Südosten seiner Stammlande große Summen Geldes und diese bekam er von den Juden, die dafür Privilegien erhielten.
So stellt er den Juden 1254 ein weiteres Privileg aus, das dem „Fridericianum“ Friedrichs des II. sehr ähnlich ist. Er erweitert den Kreis jener Personen, die unter seinem Schutz stehen als „ dominus regni Boemie, dux Austrie et marchio Moravie “ und stellt die Urkunde „ iudeis universis in regno nostro et dominio constitutis “ , d.h. „ den Juden in unserer Herrschaft aus. “
Das Privileg enthält weiter das Verbot, dass die Juden des Blutopfers beschuldigte werden dürfen. Dies ist eine Reaktion auf eine Verordnung von Papst Innozenz IV. (1243-1254) indem Ottokar feststellt: „ ...das in Unserem Reiche keine Juden beschuldigt werden dürfen dass sie Menschenblut verwenden, da sich sämtliche Juden nach Vorschrift des Gesetzes von jeglichem Blut enhalten „ 11
Ein weiterer wichtiger Schritt neben diesem Privileg war aber die Einführung des Amtes des Kammergrafen, welches unter Ottokar auch an Juden vergeben wurde. Diese neue Instanz im mittelalterlichen Steuerwesen basierte darauf, dass ein Kammergraf das Steuerrecht vom Landesherrscher verpachtet bekam. Er führte dafür alle Steuern auf einmal an den Fürsten ab und musste die Steuern von den eigentlich Steuerpflichtigen selbst eintreiben.
Die ersten Kammergrafen Ottokars waren die jüdischen Brüder Lublin und Nekelo aus Eisenburg im Burgenland, Söhne des ungarischen Kammergrafen Henuk.
Somit hatten die Juden eine weitere sehr wichtige Position in der Finanzpolitik des mittelalterlichen Österreich gewonnen, was auch im Privileg von 1255 festgehalten wurde, 1262 erfolgte die völlige Freigabe des Zinsfußes für jüdische Kredite, die sich damit christlichen Kreditgebern gleichstellen konnten.
A.2.1. Antijüdische Gesetzgebung unter Ottokar Przemysl von Böhmen
Behindert wurde die Emanzipation des mittelalterlichen Judentums unter Ottokar durch die bereits 1215 am VI. Laterankonzil festgelegte soziale und gesellschaftliche Trennung von Juden und Christen, die zwar bisher keine Bedeutung hatte, allerdings unter Papst Clemens IV. (1265-1268) forciert wurde. Dazu wurde vom 10. bis 12. Mai 1265 in Wien eine Provinzialsynode abgehalten, deren Beschlüssen sich auch Ottokar, der auf das Wohlwollen der Kirche angewiesen zu sein glaubte, anschloss. Damit verschlechtert sich die Lage der Juden in Wien und Österreich beträchtlich.
Auf der Provinzialsynode wurde festgelegt, dass sich die Juden an die im Jahre 1215 durch das Laterankonzil festgelegt Judenordnung zu halten hatten, die vorschrieb, dass Juden sich besonders zu kleiden hätten und keine öffentliche Ämter bekleiden dürften.
In seinem Versuch, die Kirche für sich zu gewinnen, reagierte Ottokar, indem er seine bisherigen Kammergrafen Lublin und Nekelo entließ und sie durch einen Wiener Bürger namens Paltram Vatzo ersetzte. Nachdem aber die Unterstützung der Kirche für Ottokars Pläne zur Gewinnung der deutschen Kaiserkrone ihm nicht ausreichend erschienen, erließ er im Jahre 1268 erneut eine Judenordnung, die der von 1262 in allen wesentlichen Punkten glich.
Außerdem gab er als Begründung an : „ Da sie (i.e. die Juden) zu Unserer Kammer gehören und ganz besonders Unserer Verteidigung und Unseres Schutzes bedürfen „ 12. 1273 musste Ottokar in seinen Bestrebungen um die Deutsche Kaiserkrone eine schwere Niederlage hinnehmen, als die sieben Kurfürsten Rudolf von Habsburg, einen kleinen Grafen aus Schwaben, als Rudolf I. zum Deutschen Kaiser wählten.
Ottokar weigerte sich in der Folge die Wahl anzuerkennen, da er die Kaiserkrone für sich beanspruchte, 1276 holte er zwar seinen Treueeid auf den Kaiser nach, musste aber auf Österreich, die Steiermark, Kärnten, Krain und das Egerland als Lehen verzichten und an Rudolf abtreten. Rudolf, dem bewusst war, dass Ottokar diese Lehen nicht freiwillig räumen würde, versuchte nun Verbündete zu gewinnen, auf die er im Kriegsfall zurückgreifen konnte. Er fand diese in der Bürgerschaft der Städte.13 So gab er 1276, als er gerade Wien belagerte, Tulln ein neues Stadtrecht, mit einem Passus, der es jedem Juden verbot, mehr als einen Pfennig Zins von einem Schilling Kredit pro Woche zu nehmen.
Mit der Eroberung Wiens 1276 änderte er auch hier die bestehende Judenordnung von Ottokar und griff wieder auf die von Friedrich II. dem Streitbaren von 1244 zurück, indem er im „Fridericanum“ lediglich Name, Adresse und Herrschaftsbezeichnung austauschen ließ.14
Rudolf bringt damit die Kontinuität landesfürstlicher Herrschaft zum Ausdruck, die er weiterführen will um die Vorteile aus der Judengesetzgebung möglichst ungestört zu genießen. Auch unterscheidet sich diese Judenordnung von der im restlichen Reich gültigen dadurch, dass die Stellung und das Recht des Deutschen Königs in der Judengesetzgebung vernachlässigt wird. In einem einzigen Punkt folgt Rudolf jedoch seinem kaiserlichen Vorgänger Friederich II: Er lässt in Wien alle Juden von öffentlichen Ämtern ausschließen und zieht damit einen Teil der Bürgerschaft auf seine Seite.
Mit Ottokars Niederlage und Tod am Schlachtfeld von Dürnkrut und Jedenspeigen am 26 . August 1278 kann Rudolf von Habsburg endgültig seinen Anspruch auf Österreich durchsetzen. Damit endet auch für die Juden in Wien jene Phase ihrer Geschichte, in der sie unter den Babenbergern und unter Ottokar Przemysl immer wieder zum Spielball wechselnder Mächte und deren politischen und finanziellen Interessen geworden waren.15
A.3. Die Zeit der frühen Habsburger
Nach seinem Sieg über Ottokar übergibt Rudolf die nun herrenlosen österreichischen Lehen an seine Söhne Albrecht I (1296-1308) und Rudolf, deren Belehnung 1282, nach dem Tode Rudolfs I. (1281) durch König Adolf von Nassau bestätigt werden.
Zu dieser Zeit kommt es zu einem Novum in der Wiener Judenpolitik. Herzog Albrecht I von Österreich hat 1295/96 in Österreich einen Aufstand niederzuschlagen der von Leutpold von Kuenring angeführt wurde. Dieser richtete seine Angriffe und Plünderungen auch gegen die Juden und musste, als er geschlagen war, versprechen, diesen ihr geraubtes Eigentum zu restituieren. Nun hatte Leutpold von Kuenring aber auch von den Juden reguläre Kredite aufgenommen um seine Raubzüge zu finanzieren, und damit hatte ein Lehensherr erstmals nachweisbar bei den Juden Kredite aufgenommen um damit seine Kriege und Raubzüge gegen den Landesfürsten und auch seine Kreditgeber zu finanzieren.16
A.3.1. Der Vorwurf der Hostienschändungen
Mit der Machtübernahme durch die Habsburger beginnen für die österreichischen Juden ruhige Zeiten. Anders als im deutschen Reichsgebiet, in dem im Jahre 1298 durch eine angebliche Hostienschändung und durch ein darauffolgendes Hostienwunder die Rintfleisch-Pogrome, benannt nach dem Rädelsführer Rintfleisch, auslöst werden, genießen die Wiener Juden den Schutz der jeweiligen Landesherren.
Zwar griff König Albrecht I . hart durch und ließ den Fleischermeister Rintfleisch festsetzen und aufhängen. Städte, in denen Juden getötet wurden, mussten hohe Geldstrafen an den König zahlen, dennoch wurden die behaupteten Hostienschändungen zum stehenden Topos der antijüdischen Beschuldigungen und griffen 1306 auch auf Österreich über, als es zu einer Beschuldigung wegen Hostienschändung in St. Pölten kam. Hier griff allerdings Albrecht I. zugunsten der Juden tatkräftig durch, da in St. Pölten die jüdische Familie Paltram lebte, die den Hauptteil ihrer Geschäfte mit den Wiener Ritterbürgern und dem Adel abschloss und so auch zu einem der größten Geldgeber geworden war, auf die der Kaiser zurückgreifen konnte.
Albrecht verhängte das Belagerungsrecht über St. Pölten und wollte die Stadt dem Erdboden gleichmachen und an anderer Stelle wieder aufbauen, wurde aber vom Bischof von Passau von diesem Plan wieder abgebracht.
Er begnügte sich schließlich mit einer Geldstrafe für die Bürgerschaft von 3500 Pfund Pfennigen und zog, nachdem er die jüdischen Bürger unter seinen Schutz gestellt hatte, wieder ab. Weiters bemühte sich der Habsburger immer mehr um den Judenschutz, da die Verfolgung sich nicht mehr aufgrund von finanziellen Problemen manifestierte, sondern immer öfter in religiösen Gründen ihren Ursprung hatte.17
Als Albrecht I 1308 ermordet wurde und Heinrich VII. sein Nachfolger als deutscher König schon 1313 auf seiner Krönungsreise nach Italien starb, kam es zum Thronstreit zwischen dem Habsburger Friedrich I.(1308-1330) und dem Wittelsbacher Ludwig von Bayern, bis Friedrich schließlich 1322 in der Schlacht von Mühlhof geschlagen wurde und von da an bis zu seinem Tod 1330 zurückgezogen lebte.
Für die Juden, die beide Konkurrenten mit Geld unterstützen, hatte sich dieser Thronstreit zu einer guten Geldquelle entwickelt. Es war dies der Anfang einer neuen Entwicklung im Geldgeschäft der Juden, da der Adel zur Deckung seiner Geldgeschäfte immer größere Geschäfte mit den Juden abschloss und sich so seine Abhängigkeit gegenüber den Juden vergrößerte. Als Ausgleich gegen die völlige Verschuldung des Adels und die daraus resultierende politische Abhängigkeit wurde das Finanzinstrument der „Tötbriefe“ eingesetzt. Diese Dokumente sind Ungültigkeitserklärungen von Geschäften mit den Juden und konnten von den jeweiligen Landesherren, meist als Gegenleistung für politische oder militärische Dienste ihrer Untertanen, ausgestellt werden. Waren die „Tötbriefe“ anfangs noch mit einer Rückzahlung der tatsächlichen Schuld verbunden, so musste später nicht einmal diese mehr zurückgezahlt werden. Dies führte einerseits dazu, dass durch das erhöhte Risiko jüdische Kredite nun teurer wurden und damit der Anteil jüdischer Kredite am allgemeinen Kreditvolumen und damit auch die jüdischen Steuern zurückgingen, andererseits wurden dadurch am Anfang des 15. Jahrhunderts zahlreiche jüdische Geldverleiher in den Ruin getrieben.18
A.3.2.Albrecht II.
König Ludwig belehnte 1313 Albrecht II. (1330-1358) , Otto und die Brüder Friedrich I. und Leopold I mit dem Herzogtum Österreich. Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutsche Reiches tritt er auch das Juden-Regal, also die Verfügungsgewalt über die Juden, an seine Lehensmänner ab, eine Regelung, die von da an beibehalten wird.
A.3.3. Der Hostienfrevel von Pulkau
1338 kam es im niederösterreichischen Pulkau zu einem angeblichen Hostienfrevel mit anschließendem Hostienwunder. Als Hostienfrevel wurden Verbrechen bezeichnet, bei denen Juden angeblich geweihte Hostien stahlen und mit Nadeln durchbohrten, um zu sehen, ob die Hostie wirklich der Leib des Herrn sei, da sie dann ja bluten müsste. Das Hostienwunder besteht dann darin, dass die Hostie zu bluten beginnt und sich als Leib des Herrn erweist, Es kam zu einer Flut von Pogromen in Pulkau und in über 30 Orten im Umland. In einzelnen Fällen reichte die Verfolgung von jüdischen Gemeinden bis nach Böhmen und Mähren; in Pulkau, Retz, Znaim, Horn, Eggenburg und Zwettl wurden alle Juden getötet.
Der Herzog wandte sich in Angst um seine wichtigste Steuerquelle an den Papst, der, es ist die Zeit des Schismas, in Avignon residierte, und er bat ihn um Hilfe bei der Beweisführung, dass diese Blutwunder nicht echt seien.
Der Papst reagierte sofort, man hatte in Avignon noch den Fall einer Bluthostie, die in Klosterneuburg von einem Geistlichen hergestellt wurde, in Erinnerung und wandte sich an den Bischof von Passau und an den Herzog mit der Aufforderung, das Wunder zu untersuchen, und, wenn sie herausfänden, dass auch nur ein geringer Zweifel an der Echtheit der Wunderhostie bestehe, diese sofort zu vernichten und die Anführer der Hostienbewegung zu verhaften seien.
Das Ergebnis der Untersuchungen ist nicht dokumentarisch überliefert, es kann aber davon ausgegangen werden, dass der Bischof die Hostie als unecht ansah und daher neben die Bluthostie eine zweite, geweihte Hostie legen ließ, um so dem Kult um die Hostie, der in den Augen der Kirche als Götzenkult zu bewerten war, Einhalt zu gebieten.
Der Eingriff des Herzogs in die Unruhen konnte die Pogromwelle nur mehr verlangsamen, sie zu stoppen war nicht mehr möglich. Sie breitete sich bis in den Herbst des Jahres 1338 in die Steiermark und nach Kärnten aus, wo 70 Juden ermordet wurden.19
Die Wiener Bürger nutzten die Angst der jüdischen Gemeinde vor Verfolgung nun soweit aus, dass sie von den Juden verlangten, den Zinsfuß von 8 Pfennig pro Pfund auf 3 Pfennig pro Pfund zu senken, um vor dem Pogrom verschont zu bleiben. Tatsächlich blieben die Wiener Juden von den Beschuldigungen unbehelligt ebenso wie die Juden aus Wiener Neustadt und Krems, wo ebenfalls Abmachungen dieser Art getroffen wurden.
Allerdings war Albrecht, so tatkräftig er auch den Juden während des Pogroms half, nach dem Ende der Verfolgungen durchaus daran interessiert, auch wieder den Ausgleich mit seinen christlichen Untertanen zu finden, und dies erreichte er dadurch, indem er Häuser der während des Pogroms getöteten Juden an das Kloster Klosterneuburg übergab und die Weingärten der Juden in Pulkau an die dort ansässige Bevölkerung verschenkte.20
A.3.4. Die Pest von 1349/51
Zu den größten und umfassendsten Judenverfolgungen in ganz Europa kam es im Mittelalter während der Pestepidemie von 1349 bis 1351.
Die Pest, eingeschleppt aus der russischen Krim von genuesischen Truppen nach Italien Anfang 1349, breitete sich rasend schnell in Europa aus und kostete etwa einem Viertel bis einem Drittel der europäischen Bevölkerung das Leben. Nach Wien kam die Seuche im Frühjahr 1350 und wütete bis zum Winter desselben Jahres und dürfte etwa 30 - 40 % der Wiener Bevölkerung, also etwa 10.000 - 12.000 Menschen, getötet haben.21 Da es der Medizin unbekannt war, dass die „Schwarze Pest“ oder Beulenpest durch den Biss des infizierten Rattenflohs übertragen wurde, und da keine Erklärung für ihre Verbreitung und Entstehung weder von der Wissenschaft noch von der Kirche geliefert werden konnte, wurden die Juden beschuldigt, dass sie Brunnen und Quellen mit einem Gemisch aus Kräutern, Menschenblut und Hostien vergiftet hätten, um so ihren angeblichen Verbündeten, den spanischen Mauren, den Weg nach Europa zu ebnen.
Diese Theorie entstand in Südfrankreich und verbreitete sich über Savoyen und die Schweiz schnell nach Deutschland und Österreich, wo sie vor allem beim gewöhnlichen Volk sofort als gültig anerkannt wurde.
Der Papst selbst hatte sich gegen diese Anschuldigungen ausgesprochen und die Pest zur Strafe Gottes erklärt, und auch verschiedene Chronisten standen der Theorie der Brunnenvergiftung skeptisch gegenüber, allein schon deswegen, da in den jüdischen Stadtteilen ebenfalls Menschen starben.
In Österreich kam es durch das Einschreiten des österreichischen Herzogs Albrecht II. zu keinen Ausschreitungen, außer in Krems, wo sich Bürger der Stadt, unterstützt von der Landbevölkerung, auf die jüdische Bevölkerung stürzten und sie in ihren eigenen Häusern verbrannten. Auch hier griff Albrecht hart durch, indem er sofort ein Heer aussandte, um die Schuldigen zu verhaften, er ließ die drei Anführer des Aufruhrs hinrichten, des weiteren mussten die Städte Krems, Stein und Mautern schwere Geldstrafen bezahlen.
Dies trug Albrecht den Zunamen eines „fauter iudeorum“ ,eines „Begünstiger der Juden“, ein, in Wahrheit dürfte aber die wirtschaftliche Situation ein wichtiger Grund für ihn gewesen sein, die Juden zu schützen.
Im Zuge der Pest kamen aus Deutschland und Ungarn Juden nach Österreich, die sich unter den Schutz Herzog Albrechts stellten, da man sie entweder aus ihren Gemeinden ausgewiesen hatte oder da sie aus Angst vor Pogromen von ihren angestammten Wohnsitzen flohen. Da sich der Schutz des Herzogs allerdings nur über die Gemeinden und Städte erstreckte, die sich in unmittelbarer Nähe um die herzogliche Residenz befanden, kam es in Kärnten und der Steiermark dennoch zu direkten Ausschreitungen gegen Juden, die nicht geahndet wurden und nur von lokalen Chronisten überliefert sind, nicht aber in den herzoglichen Dokumenten vermerkt wurden. Durch den Umstand, dass der Siedlungsschwerpunkt der österreichischen Juden in Wien und Umgebung lag, lassen sich aber auch durch diese Ausschreitungen keine besonderen Einschnitte in die Population der jüdischen Gemeinden, die über die Verluste durch die Pest hinausgingen, erkennen.22
A.3.5. Rudolf IV. der Stifter
Herzog Rudolf IV. (1358 - 1365 ), erlangte durch das „Privilegium maius“ eine der bedeutendsten Fälschungen österreichischer Geschichte, eine Sonderstellung, die sonst nur den deutschen Kürfürsten vorbehalten war.
Er hatte sich damit unter anderem auch das Judenregal gesichert, die alleinige Verfügungsmacht über die Juden in Österreich für sich und seine Nachfahren, ohne dass der Kaiser dagegen auftreten konnte.
Rudolf konnte nun in Judenfragen selbständig handeln, er besann sich aber immer darauf, die Juden in Steuerfragen nicht zu stark zu belasten, da er sie ja in Österreich als Wirtschaftsfaktor halten wollte. So nutzte er geschickt die Verschuldung der Adelsfamilien bei den Juden, um diese ruhig zu stellen oder sie für sich zu gewinnen, wie er es mit dem Grafen von Cilli machte, indem er ihm den zweitwichtigsten Juden als Steuerzahler auslieh. Der Graf konnte nun über die Steuerleistung dieses Juden bestimmen und blieb so Rudolf treu ergeben. Um eine Steuerflucht der österreichischen Juden zu verhindern, ließ Rudolf auch mit seinen Nachbarn Verträge schließen, die vorsahen, dass alle Juden, die aus Österreich in einen anderen Staat wechselten, aller Schuldverschreibungen verlustig gingen. Damit wollte man den ungehinderten Wegzug von finanzkräftigen Juden verhindern, der unter Rudolf zugenommen hatte.23
A.3.6. Albrecht III.
Albrecht III.. (1365-1395), Nachfolger Rudolfs als österreichischer Herrscher, kam durch die Erwerbungen des früheren Herzoges unter finanziellen Druck, da er den Bayern, denen Rudolf IV. Tirol durch seinen Erbvertrag mit Margarete Maultasch entrissen hatte, als Abfindung dafür 116.000 Gulden zu zahlen hatte.24
Diese Summe wurde, soweit es ging, auf die Juden abgewälzt, dazu kam noch die Finanzierung eines Krieges gegen Italien und die eines Ritterheeres zum Schutze Papst Urbans V.
In Folge dieser Kredite und Steuern gingen viele der jüdischen Geldverleiher bankrott, da sie die Steuerlast aus ihrem Gewinn nicht mehr begleichen konnten. 1377 schließlich ließ Albrecht diese einkerkern oder beschlagnahmte ihr Vermögen, ließ ihnen aber ihre Pfänder und Schuldscheine, so dass sie ihre Geschäfte fortführen konnten. Als schließlich die Einnahmen aus der Judensteuer drastisch zurückgingen, war Albrecht gezwungen zu handeln und lockerte viele seiner Beschlüsse, um die Juden nicht vollständig zu ruinieren und sich so einer einträglichen Steuerquelle zu berauben. Doch diese Politik hatte nicht lange Bestand, denn am 16. Oktober 1382 erließ er eine Verordnung, nach der die Wiener Bürger auf Schulden, die sie bei Juden hatten, keine Zinsen mehr zahlen mussten. Damit verloren die Juden ihre bedeutendste Einnahmequelle, da sie nun sehr oft weniger von ihrem Geld zurückbekamen, als sie verliehen hatten.
A. 4. Die Wiener Geserah und die Vernichtung der jüdischen Gemeinde von Wien
Nach den teilweise für die jüdische Gemeinde in Wien wirtschaftlich verheerenden Jahren der Herrschaft von Albrecht III.(1396-1404) kamen Albrecht IV. (1404-1406) und sein Onkel Wilhelm an die Macht.
Diese behandelten die jüdische Gemeinde besser als ihr Vorgänger und so kam es zu einer Phase relativer Ruhe in der Gemeinde in Wien. Es kamen aber aus anderen Teilen Österreichs immer mehr aus ihren Gemeinden vertriebene Juden nach Wien, da man sie beschuldigt hatte, Schuld an einer Dürrekatastrophe zu haben, die in den Jahre 1396 und 1397 über die Steiermark und Kärnten hereinbrach.
Dadurch stieg die Aggressivität der Wiener Bevölkerung den Juden gegenüber, und die Wiener konnten nur durch den Einsatz von Truppen davon abgehalten werden, in die Judenstadt einzufallen und die Juden zu ermorden. Zwei Schutzbriefe ermöglichten den Juden, sich frei innerhalb des Gebietes bis zur Enns und bis zum Semmering zu bewegen, des weiteren sollte ihnen geholfen werden ihre Schulden einzutreiben, und sie waren auf drei Jahre von allen Sondersteuerpflichten befreit.25
Mit dem Tod Albrechts IV. 1404 und Wilhelms 1406 fanden sich die Juden nun in einer für sie misslichen Situation wieder, denn der Sohn Albrechts IV., Albrecht V., war noch ein Kind und als solches nicht handlungsfähig, während als seinen Vormund die judenfeindlich gesinnten Stände Herzog Leopold IV. (1407-1411) bestimmten.
Als nun am 5. November 1406 in der Wiener Synagoge ein Brand ausbrach, der sich auf die ganze Judenstadt ausweitete, beschuldigten Wiener Studenten die Juden, dass sie die ganze Stadt niederbrennen wollten und riefen zur allgemeinen Plünderung der jüdischen Häuser auf, an welcher sich auch die Wiener Bürger beteiligten.
Im Gesamten sollen den Juden Besitztümer im Wert von über 100.000 Gulden verloren gegangen sein, die christlichen Schuldner verloren aber dabei alle Pfänder, da diese, sie waren ja bei den Gläubigern aufbewahrt, verbrannten. 1411 wurde Albrecht rechtmäßiger Herrscher Österreichs und er begann die Wirtschaft zu fördern, dazu verwendete er auf Vorschlag der Zünfte wieder das Geld der Juden. Der jüdische Handel in Wien hatte sich nach der Katastrophe von 1406 schnell wieder erholt und 1417 gehörten Juden, etwa ein Sechstel aller Häuser der Stadt.
Doch ging den Juden das wichtigste verloren bzw. es veränderte sich, und zwar der Kundenstamm. Waren früher Adelige die Großkunden der Juden, so wurden es jetzt immer mehr Bürger, die bei den Juden Darlehen und Kredite aufnahmen. Diese hatten aber nicht die Macht die Juden zu beschützen, sondern waren sogar mit den Juden auf geschäftlicher Basis konkurrierend. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sie nach und nach begannen, die Juden aus ihren Geschäften herauszudrängen und diese selbst zu übernehmen. Dazu kam noch ein für Albrecht unglücklich verlaufender Hussitenkrieg, der es für ihn nötig machte, sich nach weiteren Geldquellen umzusehen.26 Es kam ihm daher gerade recht, dass man im Frühsommer des Jahres 1420 eine Mesnerin beschuldigte, an die Juden konsekrierte Hostien verkauft zu haben, die diese dann entweihen und schänden wollten. Diese Beschuldigungen reichten für Albrecht V. aus im ganzen Land Judenverfolgungen zu beginnen und die Wiener Juden gefangenzunehmen.
Viele der Juden, die am Anfang glaubten, dass man sie der Zusammenarbeit mit den Hussiten, die gerade das Land verwüsteten, beschuldigte, verschanzten sich daraufhin in der Wiener Synagoge und begingen Selbstmord, als man ihnen die Kinder zur Zwangstaufe entreißen wollte. Der Rabbi der S. 52
Synagoge, Rabbi Jonah, setzte als letzter Überlebender daraufhin die Synagoge in Brand und starb inmitten der aufgehäuften Betpulte auf der Bima der Synagoge.
Die armen Juden, aus denen man kein Geld herauspressen konnte, wurden daraufhin auf der Donau in ruderlosen Booten ausgesetzt. Sie trieben die Donau bis nach Ungarn hinunter. Die Reichen aber blieben eingekerkert und wurden solange gefoltert, bis sie entweder den Ort ihrer vermutlichen Schätze preisgaben oder bis sie sich taufen ließen.
Jene Juden, die sich der Zwangstaufe widersetzten und nicht während der Folter starben, etwa 200 Menschen, wurden am 12. März 1421 auf die Gänseweide, die heutige Erdberger Lände, geführt und verbrannt. Nach der Wiener Geserah stimmten die Juden vor ihrem nahen Ende noch freudige Gesänge an, da sie nun bald Gott sehen würden. Nach ihrem Tode durchwühlten die Wiener Bürger und Studenten die Asche der Verbrannten, da man der Meinung war, die Juden hätten Gold und Wertsachen verschluckt.
Die Häuser der Judenstadt wurden vom Herzog eingezogen und entweder verkauft oder an politische Günstlinge vergeben, die Synagoge wurde bis zu den Grundmauern abgerissen und ihre Steine wurden zum Bau der Universität, deren Professoren sich in der Begründung des Pogroms besonders hervorgetan hatten, verwendet. Österreich wurde für die Juden Europas zum „Erez Hadamim“, dem Blutland, und bis in die Zeit Friedrichs III. (1463-1493) und Maximilians I. (1493- 1519) wollten sich keine Juden mehr in Wien ansiedeln.27
B. DIE GEMEINDE DER JUDEN IN WIEN
Unter dem Begriff Gemeinde ist hier die Gesamtheit aller Juden zu verstehen, die in einem abgegrenzten geographischen Bereich ihren festen Wohnsitz haben, sich unter einer bestimmten Herrschaft befinden undüber gemeinsame Einrichtungen verfügen. 28
In Wien war die älteste beurkundete jüdische Gemeinde Österreichs ansässig, sie wurde 1204 das erste Mal bezeugt und bestand bis zur Wiener Geserah von 1421.
In der Urkunde von 1204 findet sich schon die Angabe, dass es auf Wiener Boden eine
„Judenschul“ (Scola Judeorum) gäbe. Diese „Judenschul“ dürfte wohl die Wiener Synagoge gewesen sein, da in ihr auch gelehrt wurde.29
Das 13. Jahrhundert zeigt ein deutliches Wachstum der jüdischen Bevölkerung in Österreich, indem die Babenberger-Herzöge den Zuzug jüdischer Geschäftsleute, die vor allem aus Italien und aus dem Deutschen Reich kamen, förderten.
Die Ansiedlung der Juden erfolgte entlang der Haupthandelswege, entlang der Donau und in einigen Städten der Karnischen Alpen, von wo sie dann über Graz schließlich nach Wien kamen, wo sie ihren Hauptort in Österreich fanden.
Dies widerlegt eine ältere These, nach der die österreichischen Juden allein aus Deutschland stammten, von wo sie vertrieben wurden.
Die Größe und Struktur der jüdische Gemeinde in Wien zu bestimmen ist relativ schwer, da auf Grund fehlender Quellen Aussagen nicht mit absoluter Sicherheit getroffen werden können. Nur etwa 20 Familien betrieben ein umfangreiches Geld und Finanzgeschäft, weitere 400 Personen, darunter auch Frauen, befassten sich mit Hypothekdarlehen und Pfandleihen. Da sich sicher nicht alle jüdischen Geschäftsleute mit Geldgeschäften abgaben, muss die Wiener Gemeinde größer gewesen sein. Dazu kommen noch alltägliche Berufe wie Schlachter, Bader und Bäcker, ebenso Rabbiner, Thoragelehrte und Studenten.
Somit ergibt sich etwa eine Gesamtzahl von 300 jüdischen Familien in Wien. Diese Gemeinde löste sich nach der Wiener Geserah wieder auf.
B.1. Organisation
Die Organisation der jüdischen Gemeinde in Wien war ähnlich der großer Gemeinden in Deutschland, da viele deutsche Juden die Wiener Gemeinde aufbauten und daher auch die jüdischen Riten aus dem Deutschen Reich mitbrachten.
Der wichtigste Ort einer Gemeinde war immer die Synagoge, der Mittelpunkt des jüdischen sozialen und religiösen Lebens.
In ihr wurde gebetet, sie war aber auch der Sitz des Rabbinats-Gerichts, das alle internen Streitigkeiten in der jüdischen Gemeinde regelte, ebenso war sie der Platz, an dem öffentliche Beschlüsse, seien es die der jüdischen Gemeinde oder die des städtischen Magistrats, verkündet wurden.
In früheren Zeiten diente die Synagoge auch zum Thorastudium, weshalb sie in christlichen mittelalterlichen Texten oft als „Judenschul“ bezeichnet wird.
Die Synagoge war nach der Halacha, dem jüdischen Religionsgesetz, stets der Mittelpunkt der Gemeinde. Sie sollte in der Mitte der Judenstadt stehen und höher sein als alle anderen Häuser der Stadt. Allerdings verhinderten christliche Rechtsvorschriften die Höhenentwicklung der Synagogen sowie der Umstand, dass man mit dieser Bestimmung mit den gotischen Domen mit ihren über 100 Meter hohen Türmen konkurrieren hätte müssen. So beschränkte man sich darauf, dass die Synagoge nur höher sein sollte als die Häuser der Juden in einer Stadt, allerdings durfte die Synagoge nicht über die Giebel der Häuser hinausragen und musste so im Stadtbild unsichtbar bleiben, unter anderem auch einer der Gründe dafür, warum man im Mittelalter Synagogen oft in den Boden eingetieft baute.30
B.2. Die Bauwerke
B.2.1. Die Wiener Synagoge
Es wird angenommen, dass sich eine erste, heute nicht mehr nachweisbare Synagoge im Bereich der Seitenstettengasse, also in direkter Nachbarschaft des Berghofes, des damaligen Sitzes des jeweiligen Stadtherren, befunden hatte.
Erst unter Leopold V. scheint man jenen Teil der Stadt wiederbesiedelt zu haben, der heute rund um den Judenplatz liegt.
Den wesentlichsten Impuls zur Anlage des Platzes bildete die Verlegung der Residenz der Babenberger von Klosterneuburg nach Wien im Jahre 1156 unter Heinrich II. Jasomirgott (1141 - 1177), die am Platz Am Hof angesiedelt wurde. Unter seinem Sohn und Nachfolger Leopold V. (1177 - 1194) ist erstmals die Ansiedlung von Juden in Wien bezeugt, darunter der bereits erwähnte Münzmeister Schlom. Es kann angenommen werden, dass Leopold V. Schlom und seine Familie in der Nähe seiner Residenz ansiedelte und hier der Ursprung der späteren Judenstadt zu sehen ist, die S. 23 sich etwas nördlich der Babenbergerresidenz „Am Hof“ im Laufe des 13. Jahrhunderts entwickelt haben dürfte.
Der Judenplatz wird unter dem Namen „Schulhof“ oder „Schulhof der Juden“ 1294 erstmals urkundlich erwähnt und bildete den Mittelpunkt der älteren Judenstadt in Wien. Vermutlich fällt die Errichtung einer ersten, durch eine Mauer abgeschlossenen Judenstadt bereits in die Zeit der Wiener Herrschaft des Böhmenkönigs Ottokar II. Przemysl von 1251 bis 1276, in dessen Zeit vermutlich auch die erste Synagoge in der Nordwest-Ecke des Platzes errichtet wurde. Soweit aus den archäologischen Grabungen, durchgeführt von 1996 - 1998, ersichtlich, bestand die erste Synagoge am Judenplatz aus einem einfachen , annähernd quadratischen Raum mit den Maßen 10 x 7.5 m, der als Männerschul, Bet- und Lehrraum der Männer, gedeutet werden kann und an dessen Südseite sich eine rechteckige kleine Halle anschloss, die man entweder als Eingangshalle oder als Frauenschul bezeichnen könnte, an der Nordseite dürfte sich ein weiterer Raum angeschlossen haben. Eine kleine Nische an der Ostwand wird als Thoraschrein zur Aufbewahrung der Thorarollen gedeutet, auffallend ist, dass der Fußboden der Synagoge rund einen halben Meter unter dem damaligen Gehniveau liegt, eine Eigenart, die an zahlreichen Synagogen dieser Zeit zu beobachten ist.
Entlang der Ost- und Südseite der Synagoge liefen Straßen, die vermutlich von Holzhäusern gesäumt waren, an der Ostseite scheinen die anschließenden Gebäude einen größeren Abstand von der Synagoge gehabt zu haben und ließen einen kleinen Platz vor der Synagoge frei. Vermutlich sind höchstens einstöckige Holzhäuser auch an der Nord- und Westseite der Synagoge anzunehmen. Mit dem Bauende der ersten Stadtmauer Wiens in der Mitte des 13. Jahrhunderts entstehen an der Ostseite des Platzes vermutlich mehrere Steinhäuser, fassbar noch in einem 15 m tiefen Steinbrunnen, auch die Südseite des Platzes wird mit Steinhäusern verbaut, wobei die Fassaden dieser Häuser nur durch eine schmale Straße von der Synagoge getrennt waren.31 Gegen Ende des 13. Jahrhunderts, vermutlich aber noch vor 1294, wird die Synagoge durch einen wesentlich vergrößerten Neubau ersetzt. Vermutlich ist dieser Bau mit der Herrschaft des Böhmenkönigs Ottokar II. Przemysl in Wien zu sehen, der von 1251 bis 1276 Landesherr von Wien war und teilweise auf die Finanzierung seiner Bestrebungen, einer Wahl zum deutschen König, die er im Jahre 1273 angestrebt aber gegen Rudolf von Habsburg verloren hatte, auf die Geldmittel der jüdischen Bankiers angewiesen war. Ob der Bau bei seinem Tode in der Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen gegen Rudolf von Habsburg bereits fertiggestellt war, kann nicht gesagt werden, eine erste schriftliche Erwähnung der Synagoge datiert erst aus dem Jahre 1294.
Die Erweiterung der Synagoge erfolgte nach Osten und Westen, wobei die Männerschul, die nun 16 x 7.5 m misst, in eine zweischiffige, eingewölbte Halle, deren Gewölbe von zwei Pfeilern getragen wurde, umgestaltet wurde. Strebepfeiler stützten die Wände, an der Ostwand wird eine gemauerte Plattform für den Thoraschrein angelegt, in der Mitte des Raumes entstand zwischen den beiden Säulen auf einem ovalen Fundament die Bima, eine Plattform, auf der aus der Thorarolle vorgelesen wurde. In der Ansicht muss dieser sicher mit gotischen Stilelementen geschmückte Bau den vermutlich als Vorbild dienenden Synagogen von Worms, Regensburg und besonders der Altneuschul von Prag geglichen haben, wie der Vorgängerbau war sie in den Boden eingetieft um, wie es Vorschrift war, bei einer maximalen Gebäudehöhe nicht über die umstehenden Gebäude hinauszuragen. An der Nord- und Südseite schlossen sich nun rechteckige Hallen an, an der Westseite hat man mit einem kleinen Hof zu rechnen.
Mit dem Umbau der Synagoge, der sicher nur dadurch möglich war, dass dahinter die Finanzkraft einer der bedeutendsten und größten jüdischen Gemeinden in Österreich stand, wurden auch die Judenstadt und der Judenplatz baulich verändert.32
Im Ostteil der heutigen Platzfläche entstand ein Haus (heute als Haus des Rabbiners gedeutet), daran nach Westen anschließend, nur durch eine bereits im Mittelalter mit Donaukieseln gepflasterte Straße getrennt, befand sich die Synagoge mit einem nach Westen erweiterten Hof. Daran nach Norden anschließend (heute Judenplatz Nr. 10) wird das Judenspital angenommen, die Mikwe (Judenbad) dürfte sich am Beginn der Kleeblattgasse befunden haben. Nach älteren Grabungen (1907) dürften diese Gebäude nur durch schmale Gassen von weiteren Gebäuden der Judenstadt getrennt gewesen sein, ob eine im Süden des Judenplatzes ergrabene Mauer als Hausmauer oder als Begrenzungsmauer des zum Karmeliterkloster hinlaufenden Judengartens gehörte oder ob sich der Platz von der Synagoge nach Süden verbreiterte, kann derzeit nicht gesagt werden.
An der Westseite der Synagoge dürfte sich bereits im Mittelalter ein mit der Giebelfront nach Osten stehendes Haus befunden haben, welches bereits damals weiter nach Westen versetzt war, nach dem Plan von Jacob Hoefnagel von 1609 haben sich daran drei weitere Häuser nach Norden angeschlossen, deren Fassaden ebenfalls zum Platz gerichtet waren. Der Grund für den Rücksprung der Häuser aus der westlichen Bauflucht des Judenplatzes dürfte in der Lage der Synagoge zu suchen sein.
Um 1360, zur Zeit der Herrschaft Rudolfs IV. (1358-1365), der einer der aufgeschlossensten und tolerantesten Habsburger des Mittelalters war, dürfte es zu einer vermehrten Zuwanderung von Juden nach Wien gekommen sein, welche eine erneute Vergrößerung der Synagoge notwendig machte, eventuell erfolgte die Finanzierung durch David Steuss, den führenden Geldverleiher der Wiener jüdischen Gemeinde zu dieser Zeit. Vermutlich wurde zu dieser Zeit eine neue, nun sechseckige Bima über dem ovalen Fundament der älteren Bima errichtet, wahrscheinlich wurde auch der nun mit einer Sitzbank ausgestattete und als Jeschiva gedeutete Nordraum in dieser Bauphase vergrößert, an der Westseite wird der hier gelegene Hof („Schulhof“) durch den Bau eines neuen Nebenraumes um die Hälfte verkleinert. Die Synagoge, die in diesem Zustand bis 1421 verbleibt, ist mit einer Grundfläche von etwa 465 m² eine der größten bekannten Synagogen des Mittelalters.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2 :Die Lage der Wiener Synagoge
1406 werden bei einem Stadtbrand Teile der Judenstadt vernichtet, wobei die jüdische Gemeinde schwere finanzielle Verluste durch Plünderungen der Wiener Bürger erleidet, von der sie sich in der Folge nie wieder zur Gänze erholen sollte. Beim Brand der Judenstadt 1406 dürfte auch die Synagoge beschädigt worden sein. In der Folge scheint man versucht zu haben, die Synagoge vergrößert wieder aufzubauen, indem man an der Westseite einen Raum hinzufügte und eine neue Bima errichtete, fraglich scheint aber, ob der Bau auch wirklich fertiggestellt wurde oder ob die von den Archäologen als Abschluss einer Verlängerung der Männerschul nach Osten gedeutete Wand, welche nun leicht schräg zum Platz verläuft, als Abschlussmauer des Areals und der noch immer in Bau befindlichen Synagoge zum Platz hin oder als Ostwand der Synagoge zu deuten ist. 1420 kommt es durch die Beschuldigung eines Hostienfrevels und der Kollaboration mit den Hussiten zur Tragödie der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde in Wien und der Überlieferung der Wiener Geserah nach müssen sich schreckliche Szenen auf dem Platz zugetragen haben. Nachdem man einen Teil der Juden gegen Lösegeld hatte aus der Stadt ziehen lassen, wurde ein weiterer Teil der jüdischen Gemeinde in der Synagoge gefangen gehalten und die Juden beschlossen, ob der Aussichtslosigkeit ihrer Lage Selbstmord zu verüben, der letzte Überlebende, Rabbi Jonah, schlichtete dann die Betpulte der Synagoge in der Männerschul übereinander und setzte sie und sich in Brand, Spuren dieses Geschehens glauben die Ausgräber der Synagoge in einer Brandschichte auf den Fliesen der Bima zu erkennen.33
Nach der endgültigen Vertreibung und Vernichtung der jüdischen Gemeinde Wiens 1421 wurden die Synagoge und das Haus des Rabbiners abgetragen, der Überlieferung nach wurden die Steine zum Bau der Universität verwendet, deren Professoren zu den wesentlichen Initiatoren des Pogroms gezählt hatten. Die Häuser der Judenstadt wurden von Herzog Albrecht V. eingezogen und an Leute verkauft und verschenkt, die er aus politischen Gründen begünstigte.
Weitere Einrichtungen der jüdischen Gemeinde Wiens umfassten ein Schlachthaus in dem Tiere koscher geschlachtet und dann weiterverarbeitet wurden. Außerdem gab es ein „Hekdesch“ ,eine Art Gästehaus für mittellose durchreisende Juden, das aber auch als Spital Verwendung fand und das nach der Vertreibung der Juden 1421 als Pulver- und Munitionsmagazin genutzt wurde.34
B.2.2. Die Mikve
Besondere Beachtung verdient auch noch die Mikve, das rituelle Badehaus der jüdischen Gemeinde. Die Mikve war die Einrichtung, die in keiner jüdischen Gemeinde fehlte, einige reiche Wiener Bürger besaßen sogar ihre eigenen Mikve. Mikve und normales Badehaus waren oft getrennt, da die Frauen nach ihrer Menstruation dort ein reinigendes Tauchbad nehmen mussten. Mikve sind heute noch die am häufigsten erhaltenen Zeugnisse jüdischer Kultur und Niederlassungen des Mittelalters, da sie von Grundwasser gespeist werden mussten und daher oft tief in den Boden reichten, wo sie vor Zerstörung geschützt waren. Die mittelalterliche Mikve Wiens konnte bis heute nicht mit Sicherheit topographisch nachgewiesen werden, muss sich aber in unmittelbarer Nähe der Synagoge am Judenplatz befunden haben, archäologische Spuren deuten darauf hin, dass sie etwas nördlich davon gestanden hat, ein möglicher alternativer Ort liegt unter dem heutigen Haus Judenplatz Nr.4. Möglich wäre aber auch eine Lage östlich des Tiefen Grabens wegen der Nähe zum hier fließenden Ottakringbach.35
B.2.3. Der Friedhof
Der Friedhof der jüdischen Gemeinde Wien lag vor dem Kärntertor. Er stand unter dem Schutz des Landesherren und Grabschändungen wurden streng geahndet, zumindest solange eine jüdische Gemeinde in Wien ansässig war.
Als die Gemeinde 1421 gewaltsam aufgelöst wurde, verfiel auch der Friedhof. Die Grabsteine wurden abgetragen und der Platz wurde 1437 der Diözese Wien geschenkt, die ihn auch als Friedhof nutzte. Rund 10 jüdische Grabsteine und Grabsteinfragmente sind erhalten geblieben und befinden sich heute im Besitz des Historischen Museums der Stadt Wien.36
B.3. Die Mitglieder der Gemeinde
B.3.1. Der Kantor
Der Kantor war der Vorbeter der Gemeinde. Wien hatte wie alle größeren Gemeinden einen fix angestellten Kantor, dessen Aufgabe es war, den Gebetsritus genau nach den örtlichen Eigenheiten abzuhalten. Er war es auch, der den Leser der Thora bestimmte und der die Bibelstellen für den Shabbat aussuchte. Des weiteren waren er und der Synagogendiener (Schammes) jene Zeugen, die bei Gericht Verträge bezeugten und Schwüre abnahmen, wofür dieser noch extra bezahlt wurde. Des weiteren verdiente er sich ein Zubrot durch Hochzeiten und das Abhalten der für das Purimfest notwendigen Zeremonien.
B.3.2. Der Synagogendiener (Schammes)
Der Synagogendiener kümmert sich um alle Aufgaben, die mit der Synagoge im Zusammenhang stehen.
Er ist es, der die Gemeinde zum Morgengebet weckt und der die Urteilssprüche des Rabbinatsgerichtes liest.
Er stellt auch eine Verbindung zum Landesherren dar, der sich an ihn wendet, wenn er den Juden Gesetze und Verordnungen bekannt machen will, ebenso verkündete er den Beginn und das Ende des Shabbat.37
Andere Berufe, die im direkten Zusammenhang mit der jüdischen Gemeinde standen, waren in Wien auf Grund der Größe der Gemeinde ebenfalls ansässig wie der Thoraschreiber und der Schächter. Dem Thoraschreiber oblag die wichtige Aufgabe, alle offiziellen Dokument der Gemeinde, wie auch Scheidungsurkunden und Hochzeitsverträge, auszustellen
Der Schächter wiederum hatte die verantwortungsvolle Aufgabe die zahlreichen rituellen Schlachtungsvorschriften zur Gewinnung von koscheren Speisen zu beachten.38
B.3.3. Die Leitung der Gemeinde - Gemeindevorstand, Rabbiner und Judenmeister
Die Leitung der jüdischen Gemeinde hatte der Gemeindevorstand inne. Dieser war eine Versammlung der wichtigsten Vertreter der Gemeinde. Auf einem Dokument, das auf den 19. Juni 1338 datiert ist, wird der Wiener Gemeindevorstand als „Sammung“ betitelt, ein Ausdruck, der wohl eine verballhornte Form des Wortes Versammlung darstellt. Diese Versammlung setzt sich aus dem führenden Rabbi, dem Judenmeister und bedeutenden Geschäftsleuten zusammen, wobei der Judenmeister die Leitung der Geschäfte mit allen staatlichen Behörden innehatte. Ihm oblag auch die Eintreibung von Steuern und Abgaben und deren Ablieferung an den Landesherren. Ein Problem ergibt sich bei der Unterscheidung zwischen Rabbinern und dem Judenmeister. In christlichen Dokumenten erfolgt keine Trennung zwischen beiden, hier wurden sowohl der Rabbiner als auch der Judenmeister schlicht als „Maister“ betitelt.
Dies kommt daher, da die Christen nicht gewohnt waren, dass der geistliche Rabbiner die Oberhoheit über das Recht hatte und nicht ein weltlicher Richter.
Der eigentliche Leiter der jüdischen Gemeinde wurde in christlichen Dokumenten als „Zechmaister“ oder als „inhaber und verbeser der judenzech“ bezeichnet. Aus Wien ist nur ein einziger dieser Zechmeister namentlich bekannt, es war der Wiener Gemeindevorsteher Meisterlein, der 1420 im Zuge der Wiener Geserah den Tod fand.39
Die Aufgaben des Gemeindevorstehers waren folgende : Er musste sich vor allem um das Wohl der Armen und Kranken in der jüdischen Gemeinde kümmern. Sei es nun, dass er zinsenlose Darlehen an Mittellose vergab oder dass er den Neubau oder den Ausbau eines Spitals oder Armenhauses befahl. Er hatte keinen direkten Kontakt mit den Behörden der Stadt Wien, die alle Geschäfte mit dem Judenmeister regelte. Die Gemeindevorsteher erreichten im Wiener Mittelalter in der jüdischen Gemeinde großes Ansehen und wurden auch von den Rabbinern mit Vorzug behandelt.
So bekam der Wiener Gemeindevorsteher zum Laubhüttenfest stets den größten und schönsten „ Ertog “ , und Rabbi Isserlein erlaubte es sogar einem nicht näher bekannten Gemeindevorsteher anstatt des Synagogendieners den genauen Beginn des Shabbat festzulegen. In ganz Österreich, aber insbesondere in Wien, gab es ab dem 14. Jahrhundert die so genannten Judenmeister. Diese sind zwar nicht in jüdischen Chroniken belegt, aber ihre Unterschrift findet man auf so gut wie allen offiziellen Dokumenten der Gemeinde.
Es liegt daher die Vermutung nahe, dass sie von der Herrschaft eingesetzte Rabbiner waren. Auch interessant ist, dass beinahe alle österreichischen Rabbiner und Judenmeister miteinander verwandt oder verschwägert waren. Dies deutet darauf hin, dass sie eine geschlossene Schicht in der jüdischen Gemeinde bildeten, die ähnlich dem christlichen Adel nur untereinander heiratete. Es scheint so, als ob es bei den Wiener Juden eine herrschende Klasse gegeben hat, die sich aus reichen Handelsleuten, Rabbinern, Judenmeistern und deren Familien zusammensetzte.40
B.4. Die Aufgaben der Gemeinde
B.4.1. Steuern und Abgaben
Der Gemeindevorsteher hatte die Aufgabe für die Eintreibung der Steuern zu sorgen. Außerdem musste er für eine gerechte Verteilung der Steuerlast unter den Familien sorgen, da den Wiener Juden nur eine Gesamtsteuersumme vorgeschrieben wurde, die aufgebracht werden musste, aber nicht wie viel jeder Einzelne einzubringen hatte. Eine Einzelbesteuerung von Personen, wie im Deutschen Reich schon üblich, konnte sich in Wien nicht durchsetzen. Die Besteuerung war so geregelt, dass jeder Jude, der längere Zeit in Wien verblieb, seinen Anteil an der Steuerlast zu tragen hatte. Ob er hier nur über mehrere Monate ansässig war oder den Rest seines Leben verbringen wollte, war egal. Solange er hier lebte, waren Steuern zu entrichten. Dies galt auch für diejenigen, die unter widrigen Umständen nach Wien gekommen waren oder aus anderen Städten geflüchtet waren. Auch sie mussten sofort nach Eintreffen in der Stadt ihren Anteil an der Steuerlast begleichen. Die einzige Ausnahme war, wenn man weniger als 5 Wiener Pfund Vermögen besaß. Sobald man aber diese Grenze überschritten hatte, waren Steuern zu entrichten.
In Wien war es üblich, auch Schmuck und Wertgegenstände zu besteuern, da man so hoffte, ein Steuerschlupfloch zu schließen. Es gab aber keine Steuern auf Haushaltsgeräte und Bücher, weshalb viele reiche Juden ihr Geld oft in Tellern und Schüsseln aus Edelmetall anlegten. Ebenso gab es auf Bücher keine Steuer, trotz ihres enormen Wertes in jener Zeit, da man sich so erhoffte, den ständigen Büchermangel an den Jeschivot zu bekämpfen.
Ebenso wurden Geldbeträge von der Steuer ausgenommen, wenn sie für wohltätige Zwecke bestimmt waren. Einkommen, die aus Darlehen zustande kamen, wurden erst nach der vollständigen Rückzahlung der Darlehenssumme und Zinsen als steuerpflichtig erachtet.
Weitere Nachteile ergaben sich dadurch, dass die größten Kreditnehmer der Zeit, nämlich der Adel und der Klerus, oft für lange Zeit hre Darlehen nicht zurückzahlten und so den Kreditgeber in Verlegenheit brachten.
Als Grundlage für die Besteuerung diente eine eidliche Steuererklärung, die der Haushaltsvorstand den Bevollmächtigten des Gemeindevorstehers abgab. Probleme entstanden oft, wenn Behörden oder der Landesherr persönlich Juden Steuerprivilegien gaben. Diese Privilegien waren oft mit einem Schuldenerlass verbunden, so dass der Privilegierte den Anteil weniger Steuern zahlen musste, die er dem Landesherrn an Kreditrückzahlungen erließ. Das Problem ergab sich nun dadurch, dass nun weniger und nicht selten eher die ärmeren Juden eine höhere Steuerlast zu tragen hatten als die reichen Kreditgeber, die den Vorteil der landesfürstlichen Privilegien genossen.
Im Übrigen bleibt zu sagen, dass Rabbiner sowie Schüler und Lehrer der Jeschivot von der Steuerpflicht ausgenommen waren.41
B.4.2. Das Rabbinatsgericht ( Bet Din )
Die Gerichtsbarkeit über die Juden wurde von jeher in Deutschland und Österreich autonom von der jüdischen Gemeinde ausgeübt. Dass die Rechtssprechung beim Rabbinat verankert war - das Gericht entschied alle innerjüdischen Angelegenheiten - hielt den Landesherrn und Kaiser aber nicht davon ab, in die Rechtsprechung einzugreifen und so ein ihm genehmes Ergebnis für seine Schützlinge und oftmals Finanziers zu fordern. Die Bräuche des Wiener Rabbinatsgerichts sind wie viele andere direkt aus Deutschland übernommen und veränderten sich auch dementsprechend. Bei innerjüdischen Angelegenheiten, die vor ein städtisches Gericht gebracht und dort entschieden wurden, nahm das Rabbinatsgericht im Allgemeinen die Entscheidung des Gerichts an.42
B.5. Die Religion
B.5.1. Das Rabbinat
Das Rabbinat ist der Träger der Religion und es ist nicht verwunderlich, dass berühmte Rabbis das Schicksal und den Ruf der Gemeinde stark beeinflussen konnten. Diejenigen Juden, die ihre Lehrzeit bei einem Rabbiner abgeschlossen hatten, konnten bei entsprechender Eignung selbst zu Rabbinern werden. In Wien unterschieden die Behörden aus Unverständnis allerdings nicht zwischen Judenmeistern und Rabbinern und so ist für Wien heute nicht mehr nachvollziehbar, wer welches Amt bekleidete.43
Doch auch unter den Juden gab es immer wieder Probleme mit dem Rabbinat. So ist aus Wr. Neustadt bekannt, dass die Schüler des Rabbi Meisterlein ihm das Amt streitig machten und ihm das Leben mit vielfältigen Intrigen zu erschweren versuchten.
Ebenso war die Entlohnung des Rabbiners immer wieder ein Problem, da das Lehren der Thora eigentlich als freiwilliger Beruf anzusehen war, den man aus Berufung verrichten sollte und nicht, um damit Geld zu verdienen. Daher mussten sich auch zahlreiche Rabbiner mit Geldgeschäften befassen, um sich die Lehrtätigkeit leisten zu können. Auch hingen die Jeschivot stark von der Einkommenskraft des Leiter ab, da sie ja Geld verdienten. Dazu sollten die Jeschivot möglichst vielen Schülern offen stehen. 44
Zu den weiteren Aufgaben des Rabbiners zählten die Abhaltung von Trauungen, Trauerfeiern und anderen Zeremonien , dazu musste er sich auch noch einen Teil seiner Zeit dem Thora- und Talmudstudium widmen und, soweit es seine Zeit erlaubte, Schüler unterrichten. Vor der Einführung der Judenmeister bestand die Aufgabe der Rabbiner des weiteren in der Begutachtung und Beglaubigung von Wechseln und Dokumenten, die dem Rabbiner von der Stadt Wien oder dem Landesherrn vorgelegt wurden. Des weiteren waren die Rabbiner Rechtssprecher und Rechtsausleger und hatten, vor allem wenn es um Familienrecht ging, eine umfangreiche Kompetenz über Erlaubtes und nicht Erlaubtes.45
B.5.1.1. Die Österreichischen Weisen ( Chachme Österreich )
Als „Österreichische Weisen“ werden die Rabbiner bezeichnet, die im 13. und 14. Jahrhundert in Wien wirkten und durch ihre Schriften weit über die Landesgrenzen hinaus auf das europäische Judentum einwirkten.
Die Einwanderung der Juden nach Wien ist größtenteils geklärt, wobei festzustehen scheint, dass der größte Teil der Juden aus den Gemeinden am Rhein gekommen ist, eine Immigration, die wahrscheinlich durch die Kreuzzüge im 12. und 13. Jahrhundert verursacht wurde, welche die jüdischen Gemeinden nach Osten und Süden aus dem Deutschen Reich vertrieb. Die geistige Spitze des Judentums verbleib aber im Deutschen Reich, sodass es nicht verwunderlich ist, dass man in Österreich nur wenige berühmte ansässige rabbinische Persönlichkeiten antrifft, die Mehrzahl der Rabbis waren Zuwanderer oder auf der Durchreise nach Worms oder Speyer, den wichtigen Zentren jüdischer Gelehrsamkeit.
B.5.1.1.1. Rabbi Issak Or Sarua
Der wohl wichtigste in Wien ansässige jüdische Gelehrte dieser Zeit war Rabbi Issak Or Sarua. Eigentlich hieß er Rabbi Issak ben Rabbi Moses, seinen Beinamen „Or Sarua“ (Weg des Lichts) verdankt er der Bezeichnung seiner wichtigsten Schrift. Er stammte aus einer jüdischen Gelehrtenfamilie, die eigentlich aus Böhmen zu kommen scheint, da er dort seine Kindheit verbrachte. Er schlug wie sein Vater den Weg des Rabbiners ein und begab sich auf eine Ausbildungsreise, die über das Deutsche Reich nach Frankreich führte, danach besuchte und arbeitete er als Rabbiner in Regensburg, Budapest und Gran. Rabbi Or Sarua schlug seinen Wohnsitz schließlich in Wien auf, wo er bis zu seinem Tode, der ungefähr um 1250 anzusetzen ist, blieb.
In dieser Zeit schrieb er eines der wohl wichtigsten Werke jüdischer Lehrliteratur, das „Or Sarua“ (Weg des Lichts). Es ist dies ein vierteiliges Buch, in dem er seine Kenntnisse über die jüdische Halacha (religiöse Gesetzgebung) und die jüdischen Bräuche zum Ausdruck bringt und das für die mittelalterliche jüdische Gemeinde die maßgebliche Autorität in diesen Fragen darstellte. Sein Sohn Rabbi Chajjim schrieb später eine Kurzfassung des Buches, das auch in der Hagahot Mordechai (Anmerkung zum Buch des Mordechai) vorkommt.46
B.5.1.1.2. Rabbi Meir ben Baruch Segal
Von den Wiener Rabbinern dieser Zeit ist vor allem Rabbi Meir ben Baruch Segal zu nennen. Dieser stammt aus Fulda in Deutschland und war der Begründer der „aschkenasischen Semicha“ (Ordination zum Rabbiner).Er kam wohl um 1393 nach Wien und blieb hier bis 140647. Er war mit der Tochter von David Steuss, einem der reichsten und bedeutendsten Juden Wiens verheiratet, somit ist es nicht verwunderlich, dass er auch als Rabbi seinen Lebensunterhalt mit Zinsgeschäften verdiente.
Rabbi Meir hinterließ kein literarisches Werk, sodass alles, was wir über ihn wissen, von seinen Schülern oder anderen Rabbinern stammt, die mit ihm in Wien lebten.
Er besaß in seinem Haus eine Synagoge, in der er unter anderem Rabbi Hillel von Erfurt und Rabbi Jakob Molin zu seinen Schülern zählte.
Sein eigentliches Werk beschäftigte sich mit Vorschriften bezüglich Segenssprüchen und Gebeten. Aber er verfasste auch Werke über Hassagat Gevul (widerrechtliche Besitzstörung) 48 und schrieb Scheidungsbriefe.
B.5.1.1.3. Rabbi Avigdor ben Rabbi Elija Ha-Kohen
Um die Mitte des 13. Jahrhundert war auch ein weiterer der Chachme in Wien ansässig. Von Rabbi Avigdor ben Rabbi Elija Ha-Kohen (gestorben um 1260) ist wenig bekannt, er ist nur durch die Briefe und durch seine Erwähnung durch Rabbi Issak Or Sarua in Erinnerung geblieben. Aus einem reichen Haus stammend und von seiner älteren Schwester erzogen, hatte er zu seinen Lebzeiten Kontakt mit vielen Gelehrten im In- und Ausland und wurde oft in Rechtsangelegenheiten um Hilfe gebeten. Vermutlich lebte er eine Zeitlang in Italien und Frankreich, was den regen Schriftwechsel zwischen ihm und anderen Rabbinern in diesen Ländern erklären würde.49
Ab 1420/21, im Jahr der ersten Wiener Geserah, hören wir nichts mehr von den Wiener Gelehrten und das einzige geistige Zentrum der jüdischen Kultur in Ostösterreich blieb Wiener Neustadt, wo die jüdische Gemeinde weitgehend verschont geblieben war.
B.5.1.2. Der Ritus und seine Wiener Besonderheiten
Im deutschsprachigen Raum gab es bis ins 14. Jahrhundert nur den Aschkenasischen Ritus als einzigen anerkannten Ritus.50
Dieser Ritus existierte schon seit der Karolingerzeit und blieb durch das Mittelalter im Wesentlichen unverändert. Doch mit den Schickschalsschlägen, welche die jüdischen Gemeinden Europas durch die Pestverfolgungen im 14. Jahrhundert hinnehmen mussten, änderte sich auch der Ritus und spaltete sich in zwei Hauptrichtungen auf: den West- und den Ostaschkenasischen Ritus. Der Westaschkenasische blieb vor allem im Deutschen Reich und dort im Rheinland beheimatet, während der Ostaschkenasische seine Heimat in Österreich und später in den österreichischen Gebieten im Osten fand.
Die Riten unterschieden sich mehr durch die direkte Auslegung der jüdischen Schriften durch Rabbiner als durch Uneinigkeiten auf dem Gebiet der Lehre selbst. So wurden z.B. in Deutschland und Österreich die Thorarollen auf verschiedene Weisen aus dem Thoraschrein herausgeholt und wieder zurückgebracht, am eigentlichen Inhalt der Religion änderte sich aber nichts. Der Ritus bestimmt das jüdische Leben, seine genaue Einhaltung ist wichtig um Gott zu gefallen und nicht zu erzürnen, da bei Verstößen gegen den Ritus die Strafe Gottes droht. Der Ritus besteht aus vielen Einzelbestimmungen, einige werden im Folgenden aufgeführt, wobei auf die Unterschiede zwischen österreichischen, und deutschen, Ritus hingewiesen wird.51
Heft 3 (1980), 185-192.
B.5.1.2.1 Die Mesusa
Die Mesusa ist ein Pergamentstück, auf dem zwei biblische Verse (Dtn 6,4-9 und 11, 13-21) notiert sind. Diese wird in einer Metallkapsel am Türrahmen der Eingangstüre eines Hauses oder einer Wohnung befestigt und beim Eintreten berührt.
In Österreich wurden bis zum Verbot durch Rabbi Avigdor Ha-Kohen auch noch Engelsnamen auf das Pergament geschrieben. Des weiteren war es üblich, dass man Mesuot an sämtlichen Türen im Haus anbrachte und nicht nur an den Haupteingangstüren.
B.5.1.2.2. Schaufäden (Zizit)
Der Gebetsmantel der Juden war in der Norm mit vier Schaufäden ausgestatten.
In Österreich vertrat man aber die Meinung, dass diese Schaufäden nur an Gewändern vorgeschrieben seien, die aus Wolle oder Leinen gewebt sind, während man im rheinländischen Raum die Meinung vertrat, dass ein jeder Gebetsmantel, egal aus welchem Stoff, diese Schaufäden zu enthalten habe.
B. 5.1.2.3. Lesung aus der Thorarolle und von den Propheten
Die Besonderheit in Österreich kam dadurch zum Vorschein, dass bei bestimmten Anlässen die Leseordnung der Thora geändert werden musste. So las bei Hochzeiten, die am Chanukka Fest stattfanden, immer der Bräutigam die Stelle, die für die Hochzeit vorgesehen war und nicht die für Chanukka vorgesehene. Aber auch darin gab es Unterschiede, da z.B. der Wiener Neustädter Ritus diesen Brauch nicht praktizierte und wieder zum Westaschkenasischen zurückkehrte, in dem die Chanukka-Lesung Vorrang hatte.
B. 5.1.2.4. Segenssprüche
Die Segensprüche, die jeder Rabbiner zu besonderen und auch zu alltäglichen Anlässen sprach, unterschieden sich nicht so sehr im Wortlaut, als wann sie gesprochen wurden. Oft gab es auch einfache geographische Gründe, warum ein Segenspruch gesprochen wurde und warum nicht.
Wenn Rabbi Isserlein feststellt , daßman in Ö sterreich den für besonders freudige Anlasse vor geschrieben Segenspruch Ha-Tov Ve-Ha-Meitiv (der Gute und der Wohltätige)über Wein nicht sagte, da dort „ jeder Hausbesitzer zahlreiche Weinsorten vorrätig habe „ sondern nurüber „ besonders ausgezeichnete Weine „ , so hat das seine Grund in der Tatsache, dass in Ö sterreichs Klima die Weine seit jeher gut gedeihen. 52
Auch sagt das Sprechen von Segenssprüchen etwas über die Härte von Strafen aus, die verhängt wurden. So wurde der Segensspruch „ Ha-Gomel “ nicht bei Einkerkerung aufgrund von Steuerverbrechen gesprochen, wie es in Deutschland aber durchaus üblich war. Dies lässt die Schlüsse zu, dass Steuerdelikte häufig und deshalb nicht eines besonderen Segenspruches wert waren und dass der Eingekerkerte keiner direkten Gefahr ausgeliefert war, da „ Ha-Gomel “ nur gesprochen werden darf, wenn sich derjenige, dem der Segen gilt, in höchster Not befindet.
B.5.1.2.5.Gebete
Auch hier waren die Unterschied minimal, allerdings darf nicht vergessen werden, dass selbst kleinste Unterschiede in der Auslegung von Thora und Talmud oftmals zu jahrzehntelangen Streitigkeiten und Diskussionen von Schriftgelehrten und Rabbinern führten.
So wurden in Wien, wenn ein Feiertag auf eine Shabbat fiel, das Shabbatgebet nicht mit „an diesem Shabbat“ sondern mit „an diesem Ruhetag“ eingeleitet, ebenso gab es kleine Veränderungen in der Reihefolge der Gebete.
In Wr. Neustadt wurde das Mincha -Gebet erst nach der dritten Shabbat Mahlzeit gesprochen und nicht, wie es gefordert war, vorher. Fremd zugereiste Rabbiner hielten sich zwar aus Höflichkeit an den örtlichen Ritus, die meisten aber beteten das Mincha Gebet vor dem Essen und nachher noch einmal mit der Gemeinde.
Ein weiterer erwähnenswerter Brauch war, dass man den Wein, auf den man den Segenspruch am Ende der Havdala (der Shabbat Schlusszeremonie) sprach, nachher auf den Fußboden goss. Dies war kein Problem für die Wiener Gemeinde, da Wien ja von der Weinproduktion und vom Weinhandel lebte und so kein Mangel an Wein herrschte. Aus dem Norden zugereiste Rabbiner allerdings trauten oft ihren Augen nicht und waren über den Umgang in Wien mit dem Wein, der in ihren angestammten Gebieten durchaus selten und teuer war, sehr erstaunt.
B.5.1.2.6. Ikuv Ha-Tefilla
Die Ikuv Ha-Tefilla war ein basisdemokratisches Instrument der jüdischen Gemeinde und oftmals die einzige Möglichkeit eines Juden, der sich von der Gemeinde übergangen oder benachteiligte fühlte, sich Gehör zu verschaffen. Er musste in der Synagoge und noch vor dem ersten Gebet auf sein Gebetspult klopfen, worauf die Zeremonie angehalten wurde und er sein Anliegen vorbringen konnte. Dann wurde darüber beratschlagt und erst nach Lösung des Problems wurde mit dem Gottesdienst fortgefahren. Diese Diskussion während des Gottesdienstes und die Lösung des Problems ging zumeist sehr rasch vor sich, da nach jüdischem Ritus der Gottesdienst in einer bestimmten Zeit abgehalten und abgeschlossen sein musste.
B.5.1.3. Die Feste
B.5.1.3.1. Das Pessach Fest
Pessach erinnert an die Errettung der Israeliten aus der Ägyptischen Knechtschaft. Typisch für das achttägige Fest ist das häusliche Festmahl (Seder), bei dem aus der Hagada (Geschichte des Auszuges aus Ägypten) gelesen und symbolische Speisen wie Mazot (ungesäuertes Brot) verzehrt werden.53
Das Pessach-Fest ist wohl das straffest durchorganisierte Fest im jüdischen Festjahr, kein anderes Fest hat so viele Bräuche, Vorschriften und Deutungen wie Pessach. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass es gerade bei diesem Fest sehr viele lokale Bräuche zu beachten gibt. So wurden in Wien alle tönernen Haushaltsgeräte nur mit kochendem Wasser ausgespült und nicht gebrannt, wie es im Rheinland üblich war. Allerdings durften Holzschüsseln nicht für Pessach verwendet werden, da man sie nicht reinigen konnte, wie man dies im Rheinland mit heißem Wasser tun konnte.
Weitere Unterschiede betreffen das Essen und die Beleuchtung. So wurde in Österreich die Challa ( Gabe für den Rabbiner) schon vor dem Backen des Brotes vom Teig entfernt und nicht wie allgemein üblich erst danach. Bei den Lampen wurden während der Festtage in Wien diese von besonders frommen Leuten nur mit Olivenöl befüllt und nicht wie üblich mit Leinöl.
B.5.1.3.2. Omer-Zählung
Die Omer-Zählung ist die Zählung der Tage vom zweiten Tag des Pessach Festes bis zum SchavuotFest. Diese Zeitspanne umfasst 50 Tage und in diesen 50 Tagen soll sich für das jüdische Volk jede Katastrophe ereignet haben. Deshalb gilt die ganze Periode auch als Trauerperiode bis auf den 33. Tag, den Lag Ba-Omer, der ein Freudentag war. An ihm durfte man sich Gewand und Schuhe kaufen und am Abend des Vortages durfte man sich die Haare schneiden lassen.
B.5.1.3.3. Der Fasttag Tischa Be-Av
Die zweite Trauerperiode fällt auf die drei Wochen zwischen den 17. Tammus und dem 9. Av. In diese Zeit fällt nach der Überlieferung die Zerstörung der beiden Tempel in Jerusalem. Am Tischa Be-Av, dem 9. Tag des Monats Av, muss gefastet werden.
Die Wiener Jüdinnen verrichteten vom 1. Av an keinerlei Arbeit. Einzig Haarewaschen und Körperpflege am Shabbat war gestattet um die Ehre des Shabbat zu erhalten. Auch durfte man am Tischa Be-Av keine Lederschuhe tragen und über den Zeitpunkt, wann man diese auszuziehen hatte, herrschte unter den Rabbis in Österreich ein Disput, der nie ganz beigelegt wurde.
B.5.1.3.4. Das Neujahrsfest (Rosch Ha-Schana )
Das Neujahrsfest war das Fest im Jahr, an dem zur Reue aufgerufen wurde, da nun alle Taten ob gut oder schlecht, im Buch des Lebens, das die Grundlage für die Beurteilung des Menschen nach seinem Tode bildet, vermerkt werden.
Um auf diesen Tag hinzuweisen und zur Reue aufzufordern, wird der Schofar geblasen, ein zurechtgebogenes Widderhorn, das laute, heisere Töne von sich gibt. In Österreich hörte man mit dem Schofarblasen einen Tag vor dem eigentlichen Fest auf, um damit das Ende der Reuezeit anzuzeigen. Am eigentlichen Festtag wurde es dann wieder geblasen
B.5.1.3.5. Der Versöhnungstag ( Jom Kippur )
Jom Kippur ist der Höhepunkt der zehntägigen Bußzeit, die an Neujahr beginnt. Es ist der höchste und heiligste Feiertag des Jahres, ein strenger Fasttag, der in der Synagoge verbracht wird. Das Fest Jom Kippur unterschied sich in Österreich nicht allzu sehr von den üblichen Traditionen, es waren aber wie immer die Kleinigkeiten, die den Charakter des Festes bestimmten. So hüllte man sich etwa am Vortag zu Jom Kippur nicht in den Gebetsmantel und in der Synagoge ließ man die dicksten Kerzen brennen, die man hatte, um ihr Feuer auch noch am nächsten Tag nutzen zu können.
B.5.1.3.6. Das Laubhüttenfest ( Sukkot )
An Sukkot (i.e. Laubhütte) soll das siebentägige Wohnen in der Laubhütte jeden Juden daran erinnern, dass seine Vorfahren einst aus der ägyptischen Sklaverei in die Freiheit geführt wurden und dabei 40 Jahre lang in provisorischen Hütten wohnten.
Das Laubhüttenfest in Wien war ähnlich dem Westaschkenasischen. Der einzige Unterschied bestand darin, daß nur zwei Palmzweige für den Feststrauß der „vier Arten“ zu verwenden und diese an den Halbfesttagen auszuwechseln waren, da sie schnell welkten.
B.5.1.3.7. Das Tempelweihfest ( Chanukka )
Chanukka ist ein achttägiges Lichterfest, das an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem im Jahre 164 v. Chr. und an den Sieg der Hasomäner über die Hellenisten erinnert. Auch hier gab es besondere Vorschriften für das Fest in Wien. Während es in Deutschland üblich war beim neunflammigen Chanukka-Leuchter die Kerzen von links an anzuzünden, geschah dies in Wien von rechts. Auch stand der Leuchter nicht wie in Deutschland üblich an der Ostwand des Raums in Nord - Süd-Richtung, sondern an der Südwand in Ost-West-Richtung.
B.5.1.3.8. Das Losfest ( Purim )
Purim ist ein jüdisches Freudenfest zur Erinnerung der Rettung der Juden durch Esther vor dem persischen König Haman.
Das Losfest wurde in Österreich und im Wiener Raum immer mit viel Wein begangen und deshalb gab es auch an diesem Tag kein Abendgebet, da den Betrunkenen, und getrunken werden durfte bis man die Namen Haman und Mordechai nicht mehr unterscheiden konnte, die Teilnahme am Gottesdienst verboten war. Als besonderer Brauch ist noch hervorzukehren, dass es üblich war, allen Gemeindemitgliedern ein Stück Fisch und einen Becher Wein zu schenken. Meistens wurden diese Gaben Armen, dem Rabbi und dem Synagogendiener übergeben, da jene nicht alle beschenkten, aber alle diese.
B.5.1.4 Speisevorschriften
Die jüdischen Speisevorschriften basieren auf einer Trennung von Milch und Blut sowie auf der Schächtung, der speziellen Art der Schlachtung von Vieh, und der Vermeidung bestimmter Speisen sowie der Einhaltung von Fastenregeln.54
Die österreichischen Juden nahmen es nie so genau mit den in die Thora beschriebenen Speisevorschriften. Nur ein einziges Mal waren ihre Vorschriften strenger als die ihrer rheinländischen Glaubensgenossen. Diese aßen beim Bauchfleisch des Hammels das Fett mit, während dies den österreichischen Juden streng untersagt war. Ebenso kauften sie auch Sauerkraut von Nichtjuden und aßen Brot von Nichtjuden, wenn sie bei diesen eingeladen waren. Nur in den 10 Bußtagen hielten sie sich von diesen Speisen fern.
B.5.1.5 Persönliche Vorschriften
B.5.1.5.1. Familienvorschriften ( Taharat Ha-Mischpacha )
Die Familienvorschriften beschäftigen sich mit den genauen Vorschriften über Geschlechtsverkehr und die unreine Phase der Frau nach der Menstruation.55
In diesem Punkt war der österreichische Brauch strenger als jener der deutschen Juden, da die österreichische Frau länger bis zu ihrem rituellen Bad in der Mikve warten musste , um so wieder rein zu werden.
B.5.1.5.2. Beschneidung ( Brit Mila )
Die Beschneidung des jüdischen Knaben ist das Zeichen, dass der Knabe in den Bund Abrahams mit Gott aufgenommen wird. Sie wird am 8. Tag nach der Geburt durch den Beschneider (Mohel) vorgenommen. Dieser trennt mit einem Beschneidungsmesser die Vorhaut ab, allerdings scheinen sich dabei auch ältere Riten erhalten zu haben, da in den Bestimmungen für Österreich erwähnt wird, dass es in Österreich üblich war, die mit dem Mund abgetrennte Vorhaut auf den Boden zu spucken, während im Rheinland die Vorhaut in Wein gelegt wurde.
B.5.1.5.3. Zehent aus Einkünften
In Österreich war man nicht verpflichtet von aus Zinsgeschäften erwirtschaftetes Geld Zehent an die Gemeinde zu geben, nur besonders fromme Menschen gaben ihn auch aus diesen Einkünften.56
B.5.1.5.4. Trauervorschriften
Um den Verstorbenen kümmerte sich die Chewra Kaddscha, die Totenbruderschaft. Sie sorgte für die Waschung des Toten und sein rituelles Begräbnis, das noch am Tag des Todes stattfinden sollte. Am Grab wird das Kaddisch, das Totengebet gesprochen, danach wird eine 30-tägige Trauerzeit eingehalten.57
In Österreich durfte man sich nach dem Tode eines nahen Verwandten ein ganzes Jahr lang nicht rasieren, in Deutschland war dies nach drei Monaten wieder gestattet.
Auch verlangte man, dass der traditionelle Einriss ins Gewand gleich nach dem Ableben gemacht wurde und nicht erst nach der Beerdigung. Anders als im Rheinland üblich, saß man in Wien mit den Trauernden eine Woche lang nach dem Gebet im Hof der Synagoge und begleitete sie nicht nach Hause, wie dort üblich. Auch hatte der Rabbi nichts dagegen einzuwenden, dass der Trauergesang von einer Frau angestimmt wurde, zumindest solange auch die Verstorbene eine Frau war.58
B.5.1.5.5. Heirat und Scheidung
Der Hochzeitstag beginnt mit dem Besuch der Braut in der Mikwe zur rituellen Reinigung. Die Ehezeremonie erfolgt in der Synagoge, wo die Brautleute unter dem Trauungsbaldachin getraut werde. Dabei werden Ringe überreicht und eine Eheformel gesprochen, danach wird der Ehevertrag (Ketubba) überreicht. Ein Hochzeitsmahl beschließt die Feier. Scheidungen waren möglich, aber kaum üblich, in diesem Falle erhielt die Frau ihre Mitgift zurück. Die Vorschriften zur Heirat und Scheidung haben sich im Mittelalter regional und zeitlich kaum unterschieden. Somit war es möglich, dass auch Juden aus unterschiedlichen Gebieten heiraten konnten ,ohne Schwierigkeiten aufgrund lokaler Bräuche zu haben.59
Bei der Scheidung gab es das Problem der unterschiedlichen Aussprache von Buchstaben. So wurden manche Scheidungsurkunden in Deutschland nicht anerkannt, da sie angeblich für die falsche Person ausgestellt wurden.
C. DAS JÜDISCHE LEBEN IN WIEN
C.1. Bildung
Der jüdische Glaube ist sehr anspruchsvoll, wenn es um Bildung geht. Diese basiert hauptsächlich auf der Thora und dem Talmud, dem jüdischen Gesetzbuch, aus dem gelehrt wurde. Die Weisheiten der Bibel und der Thora im Besonderen wurden von der Rabbinern in den sogenannten Jeschivot (Talmudschulen ) gelehrt. Diese waren im 13. Jahrhundert vor allem im Rheinland sehr angesehen und die berühmtesten Gelehrten Europas wurden dort ausgebildet.
Die Lage der Ausbildung dürfte ihn Wien kaum besser gewesen sein als in ganz Osteuropa, wo es kaum Schriftgelehrte gab. Man profitierte in Wien aber davon, dass man an einem der Hauptverkehrswege der damaligen Zeit lag. Und so kamen doch immer wieder gelehrte Rabbiner vorbei und lehrten an den Wiener Talmudschulen, diese blieben zwar nicht lange, hatten aber durch ihre Meinungen und Lehren dennoch Einfluss auf die Wiener Schulen. Die erste Jeshiva ( Talmudschule) in Wien gründete Rabbi Avigdor ben Rabbi Elija Ha-Kohen etwa um die Mitte des 13. Jahrhunderts. Danach wurde die Jeshiva aber bis ins 14. Jahrhundert nicht mehr erwähnt und es gibt für diese Zeit auch keine anderen Quellen jüdischer Lehrtätigkeit in Österreich. Erst mit Rabbi Meir ben Rabbi Baruch Ha-Levi, einem Gelehrten aus dem Rheinland, kam die Wiener Jeshiva wieder zu Bedeutung und zog Studenten aus ganz Europa an, die nach Wien kamen, um an den Wiener Talmud-Schulen zu studieren.60
Außer zur religiösen Bildung hatten die Wiener Juden kaum Zugang zu philosophischen und naturwissenschaftlichen Schriften, da diese auf römischen und griechischen Manuskripten basierten und dieses Wissen von den Klöstern aufbewahrt und tradiert wurde.. Jüdische Ärzte durften nur Juden behandeln, da sonst die Gefahr einer Vergeltung beim Tode eines christlichen Patienten bestanden hätte.61
Der einzige bekannte jüdische Gelehrte, der sich mit einem anderen Subjekt als religiösen Fragen beschäftigte, ist der bekannte Rabbi Isserlein. Er beschäftigte sich besonders mit der Orthographie, da die richtige Schreibung von Orts- und Personennamen für Scheidungen unerlässlich war. Wurde nämlich der Scheidungsvertrag mit einem falschen Namen ausgestellt, so war er im eigentlichen Ort ungültig, aber im Ort, der auf dem Papier stand, gültig. Sollte dort nun auch ein Paar leben, das gleich hieß wie das eigentlich zu scheidende, so waren diese Eheleute nun geschieden. Um solchen Verwechslungen vorzubeugen war es besonders wichtig die Rechtschreibung, zumindest auf Dokumenten der Gemeinde, zu vereinheitlichen.62
C.2. Erziehung
Lückenhaft sind die Quellen, wenn es um die Erziehung der Kinder geht. Die einzigen Quellen, die diesbezüglich vorhanden sind, befassen sich mit der Frage der Entlohnung von Lehrern. So gab es einen Fall, in dem der Schüler gestorben war und nun die Frage offen war, ob der Lehrer bezahlt werden solle oder nicht. Auch sprach Rabbi Isserlein ein Urteil, dass Lehrer an Fasttagen nicht fasten mussten, wenn sie an besagtem Tag mehr als sechs Stunden zu unterrichten hatten. In der Regel wurden Kinder etwa im Alter von sechs Jahren an unterrichtet, wobei das Lernen von Lesen und Schreiben an Hand von Texten aus Thora und Talmud erfolgte. Eine kaufmännische oder handwerkliche Ausbildung wurde im Haus der Eltern vermittelt. Ungeklärt ist die Frage, ob den Töchtern eine gewisse Bildung zukam, es ist aber bekannt, dass im Hause des Rabbi Isserlein seine Schwiegertochter Rädel von Rabbi Judel Sofer unterrichtet wurde.63
Auch beantwortete Rabbi Isserleins Frau, Schnödeln, einmal einen Brief anstelle ihres Mannes, der anscheinend gerade verhindert war. Ob man allerdings vom Hause Isserlein, das sicher zu einem der vornehmsten und gebildetsten nicht allein im jüdischen Wien zählte, auf allgemeine Zustände schließen kann, ist nicht gesichert.
C.3. Die Judenstadt und ihre Häuser
Eine erste Schilderung jüdischer Wohnungen und Häuser gibt uns Rabbi Isaak ben Rabbi Moses Or Sarua: „... und alle hatten ihre Höfe in den rückwärtigen Teilen der Häuser. In Wien gibt es nämlich keine Vorhöfe sondern, die Hofräume befinden sich hinter den Häusern, und allen für den Hof bestimmten Zwecken dient jeweils der Hinterhof „ 64
In Wien gab es zunächst keine eigene Judenstadt, doch sah sich der Landesfürst immer mehr gezwungen die Juden zu schützen und so wurden die um den heutigen Judenplatz gelegenen Häuser immer mehr von Juden bewohnt. Ob dieser Wanderbewegung durch behördliche Anweisungen nachgeholfen wurde, ist nicht bekannt.
Die Judenstadt war nicht durch eine besonders dafür gebaute Mauer von dem Rest der Stadt getrennt, sondern einfach dadurch, dass alle Häuser ihren Eingang in die Judenstadt hatten und keinen rückwärtigen Eingang besaßen. Einzig die Gassen und Straßen die durch die Judenstadt führten, waren mit eignen Toren abgegrenzt, die aber immer offen standen Des Nachts aber und wenn Gefahr drohte, konnten sie von den Juden von innen geschlossen werden. Die Gemeinde war bis zu ihrer Aufhebung im Jahre 1421 autonom, sie besaß einen eigenen Fleischhof, einen Bäcker und ein Spital.
Vor dem Kärntertor befand sich der Judenfriedhof, der vielleicht eine Art „ Zentralfriedhof“ für Leichen von Juden aus ganz Österreich war. Diese Schlussfolgerung lässt zumindest ein Artikel des „Fridericianums“ zu, der besagt, dass Leichen von Juden und ihren Begleitern die Zoll- und Mautfreiheit gegeben ist. Auch befand sich im Ghetto ein eigenes Badehaus für Juden. Dieses war notwendig, da die strengen Badevorschriften es verboten, dass Juden und Christen gemeinsam badeten.65 1997) S. 198
C.4. Kleidung
Die Kleidung der Juden unterschied sich von den Gewändern der Christen. Dies aber nicht weil es im Zuge von städtischen Kleiderordnungen vorgeschrieben war oder zur besseren Unterscheidung zwischen Christen und Juden führte, sondern weil es ihnen durch den Talmud auferlegt war, bestimmte Stoffe und Verzierungen nicht zu tragen. Dazu Rabbi Isserlein :
„ ... sogar zwei- und dreifärbige Gewänder und Kleider mit Quasten, Tresen und Borten, so wie die Nichtjuden sie gewohnt sind, und auch das Herumgehen ohne Kopfbedeckung sind einem Juden ebenso verboten wie Kilajim... “ 66
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3 Die Wiener Judenstadt
Dennoch gab es bestimmte Kennzeichen das man mit einem Juden verkehrte. Zunächst fielen sie durch zwei äußerliche Merkmale, erstens durch den Judenfleck, ein gelbes Tuch, und durch den Judenhut (pileus cornutus), einen spitzen Hut, den alle männliche Juden tragen mussten. Rabbiner und Thoragelehrte hatten zu ihrer normalen Kleidung noch einen Talar, der sie besonders heraushob.
Laut Beschreibungen war er wie ein Kleid geschnitten, aber enger anliegend und am Kragen zugeknöpft, so dass man nicht mehr mit den Kopf herausschlüpfen konnte.67 Über die Kleidung der jüdischen Frauen ist nicht viel bekannt, sie wird etwa jener der Wiener Bürgerinnen entsprochen haben. Es ist aber schwer zu sagen, ob sie wie diese mit der Mode gingen oder ob es ähnlich den Männern eine traditionelle Kleidung gab, die sich über längere Zeiträume nur wenig veränderte.
C.5. Essen und Trinken
Die Trennung von Fleisch und Milchgerichten, die bei den Juden ja schon von jeher sehr streng war, wurde von einigen Wiener Juden sogar noch strenger genommen. So gab es z.B. in Wien einen Juden, der Fleischspeisen nur in einem Raum zu sich nahm und für Milchspeisen einen eigenen Raum besaß. Im großen und ganz nahmen es die Wiener Juden aber nicht so genau mit den Speisevorschriften und Übertretungen wurden nicht streng geahndet.68
So wundert es nicht, dass vor allem die reicheren Juden ein jedes Shabbat- Mahl zu einem wahren Festessen machten. Und da man in einer Weingegend lebte, war auch der für den Shabbat nötige Wein zumeist von ausgezeichneter Qualität.
Allerdings war auch das Fehlen von Wein bei Tisch kein Problem, da man den Segen auch über einem Glas Bier oder dem Shabbat -Brot sprechen konnte.
Zum Shabbat ist noch zu sagen, dass Rabbi Isserlein oft selbst auf den Markt ging, um den Fisch für das Shabbat -Mahl auszusuchen, eine Tätigkeit, die normalerweise die Frauen des Haushaltes erledigten. Auch wird berichtet, dass er oft selbst den Fisch zubereitet hat.
Weiters feierte Isserlein den Shabbat an heißen Sommertagen im Hof seines Hauses. Dort wurden die Speisen zu sich genommen, während die Shabbat -Kerzen im Haus brannten.
C.6 Der Shabbat
Am Shabbat wurden keine Arbeiten verrichtet. Am Vormittag ging man in die Synagoge, das weitere Brauchtum folgte den Jahreszeiten. Im Sommer legte man das Shabbat -Mahl oft vor, um den Nachmittag, z.B. für Spaziergänge entlang der Donau, nutzen zu können. Im Allgemeinen bleibt also zu sagen, dass der jüdische Shabbat im Mittelalter mit dem Sonntag gleichzusetzen ist, wie er heute noch praktiziert wird und keine mystische Komponente enthält. Der Shabbat konnte aber auch gebrochen werden. Eine der wichtigsten Ausnahmen war, dass sich alle Juden auch am Shabbat beim Löschen eines christlichen Hauses beteiligen sollten und mussten. Feuer war die ärgste Gefahr in der mittelalterlichen Stadt und die Pflicht zum Löschen des Feuers eine Absolute, verweigerte man die Hilfe, konnte man dafür mit dem Tode bestraft werden. Weitere Entscheidungen betrafen die Verteidigung der Stadt (Juden müssen auch am Shabbat die Stadt verteidigen) und das Beheizen der Öfen in Wintermonaten (Juden müssen Nichtjuden anstellen, um die Öfen in den Wintermonaten am Shabbat zu beheizen).
C.7. Familienfeste
Da es kaum Angaben über Feste gibt, die außerhalb der religiösen Feste stehen, kann man hier nur sicher die Hochzeit angeben, die ähnlich ablief wie bei Christen. Zuerst gibt es eine Zeit der Verlobung, an deren Ende die Hochzeit stand und die finanziellen Angelegenheiten geregelt wurden. Neben der religiösen Hochzeitszeremonie gab es wie heute noch üblich auch bei den Juden des Mittelalters einen Polterabend, auf dem der zu vermählende Junggeselle noch einmal Abschied von seinem bisherigen Leben nehmen konnte.69
Sowohl am Shabbat als auch an anderen Festtagen tanzte man und ließ dafür nichtjüdische Musikanten aufspielen, denen das Arbeiten an diesem Tag gestattet war.
Allerdings wurde diese Praxis bald von Rabbinern verboten, die darin eine Umgehung der Shabbat Gesetze sahen.
C.8. Spiele
Spielen und Wetten war auch unter den Juden weit verbreitet, sogar am Shabbat und an den hohen Festtagen wurde gespielt und gewettet. Dies führte dazu, dass viele Rabbiner, unter ihnen auch Rabbi Meir, schließlich sogar erlaubten an diesen Tagen zu spielen.
Allerdings hatten die Juden dabei Auflagen zu beachten. So sollten Spieler, die am Laubhüttenfest spielen wollten, dies nur in der Laubhütte tun und nicht außerhalb des für dieses Fest vorgeschriebenen Platzes.70
C.9. Volks- und Aberglaube
Selbst höchst gelehrte Rabbiner waren vor dem mittelalterlichen Aberglauben nicht gefeit und so gibt es auch hier Überlieferungen, die sich wahrscheinlich auf die gesamte jüdische Gemeinde anwenden lassen.71
So glaubte Rabbi Schalom, dass man den bösen Blick mit einer Natter abwehren könne, und Rabbi Isserlein war fest davon überzeugt, aus Träumen die Zukunft ablesen zu können. Rabbi Isserlein wird auch die Verbreitung mehrer seltsamer Bräuche zugeschrieben. So ließ er jedes Mal, bevor er etwas trank, einige Tropfen des Getränks auf den Boden träufeln und zur Behebung von Kopfschmerzen empfahl er den Kopf zu waschen, allerdings ohne dass ein anderer Körperteil von Wasser berührt wurde. Um Zahnschmerzen zu bekämpfen sollte man seinen Bart abschneiden
(!). Rabbi Isserlein versuchte Probleme auch durch die Verwendung von Magie zu lösen und suchte selbst oft Rat bei Hexern und Magiern in Krankheitsfällen.
Auch glaubte man an die Macht der Toten, das Diesseits zu beeinflussen und sprach daher immer zusätzliche Gebete an den Gräbern der Verstorbenen, die man besuchte.
C.10. Verbrechen
Raufereien und Schlägereien wurden auch in der Judenstadt von der Stadtwache geregelt.
Dieser war auch gestattet, wenn unbedingt notwendig, in die Synagogen zu gehen und dort streitende
Talmudgelehrte zu trennen, deren Streit physische Dimensionen anzunehmen drohte.
Diebstähle von Juden und bei Juden wurden streng geahndet. Auch wurde der Verstoß gegen rabbinische Gebote sehr streng, im äußersten Fall sogar mit der Ächtung der jüdischen Gesellschaft bestraft.72
Allerdings sahen die rabbinischen Gerichtshöfe Verstöße gegen die Steuerabgaben an die Obrigkeit als nicht schwerwiegend an, solange es um Geld ging, das der Landsfürst oder die Stadt unrechtmäßig forderten.
Schwere Kriminalverbrechen wie Vergewaltigungen werden aus der jüdischen Gemeinde nicht gemeldet oder in den Quellen wird darüber geschwiegen, allerdings gibt es einige gut dokumentierte Fälle, in denen gegen Vergewaltiger mit der vollen Härte des Gesetzes vorgegangen wurde.
C.11. Beziehungen zu Nichtjuden
Die Beziehungen der Juden zu Christen betrafen nicht nur Geschäftliches.
Viele Juden hatten unter den Christen Freunde und Vertraute, auch unter der Geistlichkeit hatten die Juden ihre Bekannten. Die daraus resultierenden Probleme beschäftigten sowohl Christen wie Juden. Da die Juden dem Kreuz Christi keine Ehrfurcht erbieten wollten oder konnten, mussten sie, wenn sie einen Pfarrer oder andere Geistlichen grüßten, dies davon abhängig machen, ob man das Zeichen des Herrn sehen konnte oder nicht. Auch gab Rabbi Isserlein genaue Anweisungen, wie man sich zu Weihnachten oder zu Ostern gegenüber Christen zu verhalten habe. Andererseits brachten auch Nichtjuden an jüdischen Festtagen Geschenke und feierten oft die Feste mit den Juden mit.
Auch wurde es den Juden erlaubt, sich an der Verteidigung der Stadt aktiv zu beteiligen, auch wenn es Shabbat war, dazu mussten aber schon die Außenbezirke der Stadt niedergebrannt sein und die Stadt musste die Juden bitten, sich den Verteidigern anzuschließen.
Ein viel größeres Problem sahen die Rabbiner in der Verbindung zwischen Juden und Christen, Rabbi Isserlein warnte immer wieder vor solchen ehelichen Verbindungen und tat sie als unnatürlich ab.73
C.12. Getaufte Juden
Juden, die sich taufen ließen oder die zwangsgetauft wurden, waren für die jüdische Gemeinde ein Problem. Vor allem die durch Zwangstaufe zum Christentum gezwungenen Juden, die wieder zum jüdischen Glauben zurückkehren wollten, hatten Problem wieder in die jüdische Gesellschaft aufgenommen zu werden. Allerdings hatten Juden keine Probleme damit, mit Konvertiten Geschäfte abzuschließen, wie aus einem Fall hervorgeht, bei dem Rabbi Isserlein urteilte, dass man einem Konvertiten Geld gegen Zinsen leihen könnte.
Wirkliche Probleme entstanden dann, wenn einer der Ehepartner sich entschloss zum Christentum zu konvertieren. Dies führte dazu, dass nun die Ehepartner nach der Chaliza
(Ehescheidungszeremonie) geschieden werden mussten. Dies war oft ein lange währendes und schwieriges Verfahren, an dessen finanziellen Auswirkungen ganze Familien zugrunde gehen konnten.
Sollte ein Konvertit jedoch die Entscheidung zur Rekonversion treffen und zum Judentum zurückkehren, nachdem er aus freien Stücken zum Christentum übergetreten war, so wurde er zwar wieder in die jüdische Gemeinde aufgenommen, musste aber mit der Todesstrafe, verhängt von einem kirchlichen Gericht, rechnen.74
Nur wenn er zwangsgetauft worden war, so konnte er je nach der Zeit, in der dies geschah, mit einer Bewährungszeit rechnen. Bekannte sich der Jude dann wieder zum Judentum, so ließ ihn die Kirche oftmals ziehen und er wurde wieder in die jüdische Gemeinde aufgenommen . Dies sollte vorbeugen, dass sich Juden für jene Religion entschieden, die ihnen im Moment die größeren Vorteile versprach.
D. WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN
Die wirtschaftlichen Grundlagen der jüdischen Gemeinde Wiens beruhten auf drei Grundpfeilern, dem Geldgeschäft, dem Handel und dem Handwerk. Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass den
(Wien 2000) , Bd. 1 S. 156
Wiener Juden auf Grund von auferlegten Verboten nur der Geldhandel zum Erwerb erlaubt war, bis
an das Ende der jüdischen Gemeinde 1421 finden wir unter den Wiener Juden auch Händler und Handwerker.75
D.1. Der Geldhandel
Der Geldhandel beruhte auf zwei Geschäftsarten, zum einen wurden auf Wechselkursschwankungen innerhalb Europas spekuliert, was auf Grund der weitverzweigten Beziehungen der jüdischen Gemeinden günstig zu bewerkstelligen war. Bargeldloser Zahlungsverkehr, das Ausstellen von Wechseln und Schecks war hier durchaus üblich. Man kaufte Münzen zum Edelmetallwert in einem Land ein, brachte sie in ein anderes und verdiente an der Wertdifferenz der jeweiligen Regionen. Der zweite Geschäftszweig hier war das Gewähren von Darlehen gegen Zinsen, allerdings wird der Anteil der jüdischen Darlehen am Gesamtgeschäft zumeist übertrieben bewertet. Den weitaus größten Anteil am Darlehensgeschäft hatte die Kirche, gefolgt vom Adel. Beide Institutionen hatten den Vorteil, ihre Kredite billiger vergeben zu können als die Juden, die einerseits stets mit der Tötung ihrer Schuldbriefe zu rechnen hatten, andererseits auch wesentlich riskantere Schuldner annehmen mussten.76
Üblich war die Einbehaltung von Pfändern gegen die Gewährung von Krediten, welche bei Zahlungsverzug verkauft werden durften. Es sind aus dem mittelalterlichen Schuldbüchern und Gerichtsakten zahlreiche Prozesse betreffend Kredite zu verzeichnen, wobei festgestellt werden kann, dass hier die Juden gegenüber ihren christlichen Gläubigern nicht benachteiligt wurden. Problematisch wurden die jüdischen Geldgeschäfte gegen Ende des 14. Jahrhunderts. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich wegen Missernten beim Weinbau, es ist die Zeit des Beginns der sg. „kleinen Eiszeit“, und wegen einiger schwerer Stadtbrände in Wien auch zahlreiche Erb- und Ratsbürger wie auch der Adel und sogar die Kirche bei jüdischen Bankiers verschuldet.
Die erhöhte Schuldabhängigkeit führte in der Folge zu einigen Pogromen, worauf man auf Betreiben dieser Gruppen den Zinssatz der Darlehen auf 6-8 Pfennige pro Pfund und Woche festsetzen musste, was zu einem wesentlichen Verdienstausfall der jüdischen Bankiers führte. 1997) S. 235
Erst am Ende des 14.Jahrhunderts normalisierten sich die Zinsraten wieder, allerdings hatten sich bis
dahin die meisten Schuldner von ihren nun billigen Krediten befreien können und das Darlehensgeschäft wurde nun wieder großteils von Adel und Kirche übernommen. Tatsächlich dürfte aber der Anteil der Wiener Juden am gesamten Kreditgeschäft zu keinem Zeitpunkt des Mittelalters mehr als 30% betragen haben.77
Wesentlichen Anteil hatten die jüdischen Bankiers zunächst auch an der Münzherstellung. Diese erfolgte in der Regel durch ein privates Gremium, die Münzerhausgenossen, welche das Silber einzukaufen und Münzen zu prägen hatten, die Differenz zwischen Metall- und Geldwert minus der Abgaben an den Herzog war der Gewinn aus dem Geschäft, der zeitweise beträchtlich sein konnte. Zur Kontrolle installierten die Wiener Herzöge daher zunächst jüdische Monetare, die dann später selbst Mitglieder der Münzerhausgenossenschaften sein durften, allerdings wurden die jüdischen Monetare durch das Judenprivileg von Friedrich II. auf Betreiben der Wiener Bürger aus diesen Funktionen entfernt.
D.2. Der Handel
Wien war im Mittelalter eine Handelsstadt, zum einen wurde der in Wien in großen Mengen erzeugte Wein gehandelt, zum anderen importierte man Luxusgüter und das Wiener Stadtrecht zwang alle ankommenden Händler in Wien ihre Waren zu verkaufen, die dann von Wiener Händlern weiter nach Osten gehandelt wurden.
Die Wiener Juden handelten zum einen mit den für Darlehen erhaltenen und verfallenen Pfändern, in den eigentlichen Großhandel waren sie nur soweit eingebunden, als sie Handelsgeschäfte finanzierten. Allerdings scheint es auch jüdische Kleinhändler gegeben zu haben, da im Privileg von 1238 festgehalten wird, dass auch Juden Handel treiben dürfen und auch der Handel mit Färbemitteln und Arzneiwaren nicht ausgenommen ist. Juden sind in Wien auch als Tuchhändler, Händler von Arzneiwaren, Wein- und Getreidehändler überliefert, als Besonderheit ist der Handel mit Granatäpfeln zu nennen. Juden betätigten sich auch als Makler, sogenannte „Unterkäufel“, verboten war ihnen ab 1368 jegliche Vermittlung- und Zwischenhandelstätigkeit auf dem Gebiet des Edelmetallhandels.
D.3. Gewerbe
Das Wirken der Juden als Handwerker und Kleinhändler ist nur indirekt aus den Verboten zu erschließen. Zu rechnen ist mit all jenen Gewerben, die der direkten Versorgung der jüdischen Gemeinde dienten, allerdings scheinen auch viele Christen bei Juden gekauft zu haben. Erst im 14. Jahrhundert erfahren wir, dass Friedrich der Schöne den Juden die Tuchherstellung verbietet, bereits 1267 hatte man den Verkauf von nicht koscherem Fleisch von Juden an Christen verboten. Es scheint daraus hervorzugehen, dass Juden bis in das 14. Jahrhundert teilweise in das Gewerbeleben integriert waren, man aber ab dem 13. Jahrhundert begann ihre Möglichkeiten schrittweise einzuschränken.78
E. SCHLUSS
Das Bild der Wiener Juden im Mittelalter war in der christlichen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, als man das Mittelalter als interessante Zeitepoche wieder entdeckte, geprägt von Bild des geldgierigen Handels- und Finanzjuden, der die christlichen Kreditnehmer auspresste und ausnützte und das Bild eines Volkes, das außerhalb jeglicher Gemeinschaft in der mittelalterlichen Stadt stand. Erst in den letzten Jahren hat die Forschung ergeben, dass sich über weite Strecken das tägliche Leben der Juden im mittelalterlichen Wien kaum von dem ihrer christlichen Nachbarn unterschied. Ausnahme ist, dass die jüdische Gemeinde stets bedroht war für alle Missgeschicke, die der Stadt widerfuhren, verantwortlich gemacht zu werden, sei es die Pest, die Hussiten, Dürre oder Überschwemmung. Diese stete Gefahr brachte es mit sich, dass die innere Organisation der jüdischen Gemeinde, ihr Zusammenhalt in privaten und religiösen Fragen wesentlich stärker war als die der christlichen Stadt und damit das Misstrauen der Christen erregte, was am Ende einer 230- jährigen Geschichte zur Vernichtung der jüdischen Gemeinde führte. Die kulturelle Leistung des Wiener Judentums für Wien ist für uns heute kaum mehr nachvollziehbar, da alle ihre Äußerungen ab 1421 planmäßig vernichtet wurden, ein letztes Echo stellen die erhaltenen Schriften und die Reste der Wiener Synagoge am Judenplatz dar.
F. GLOSSAR
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
G. BIBLIOGRAPHIE
Albert Camesina, Wiens örtliche Entwicklung, Wien 1877.
Hans Tietze, Die Juden Wiens. Geschichte, Wirtschaft, Kultur (Wien 1987, Nachdruck der Ausgabe von 1933)
Heidrun Helgert und Martin Schmidt, Die mittelalterliche Synagoge auf dem Judenplatz, in: Perspektiven Heft 6/7 (2000) 47-53
Johann Evangelist Scherer, Die Rechtsverhältnisse der Juden in den deutsch - österreichischen Ländern, Leipzig 1901
Klaus Lohrmann, Die Judenverfolgungen zwischen 1290 und 1420 als theologisches und soziales
Problem. Wellen der Verfolgung in der österreichischen Geschichte (Schriften des Instituts für Österreichkunde 48, 1986), 40 ff.
Klaus Lohrmann und Martha Keil, Überlegungen zur Vermögensrechtlichen Stellung der Juden im Mittelalter, in: Studien zur Geschichte der Juden in Österreich ( Handbuch zur Geschichte der Juden in Österreich Reihe B, Band 2, 11-40), Wien - Köln - Weimar 1994
Klaus Lohrmann, Die Wiener Juden im Mittelalter, Geschichte der Juden in Wien, Bd. 1 (Wien 2000)
Klaus Lohrmann. Die mittelalterliche Synagoge in Wien, in: Juden in Österreich, Ausgabe 2000, S. 12 - 16
Martha Keil, Rabbi Izchak bar Mosche Or Sarua. Der Begründer der mittelalterlichen Gelehrsamkeit in Wien, in: Juden in Österreich, Ausgabe 2000, S.16 - 21
Monika Grübel, Judentum. Dumont Schnellkurs, Köln 1996
Neubauer/Stern, Hebräische Berichte über die Judenverfolgung während der Kreuzzüge. Quellen zur Geschichte der Juden in Deutschland, Berlin 1892
Reinhard Pohanka, Hinter den Mauern der Stadt. Eine Reise ins mittelalterliche Wien (Wien 1985)
Reinhard Pohanka, Wien im Mittelalter (Wien 1999)
Reinhard Pohanka, Der Judenplatz nach 1421, in Perspektiven, Heft 6/7 (2000) S. 37-42
Shlomo Spitzer, Niederösterreichische hebräische Urkunden aus dem 14. Jahrhundert. Unsere Heimat Jg. 51, Heft 3 (1980), 185-192.
Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und
Kulturgeschichte (Wien 1997)
Willehald Paul Eckert, Die mittelalterlichen Beschuldigungen gegen die Juden. Judentum im Mittelalter (Ausstellungskatalog 1978), 91-108.
H. BILDNACHWEIS
Umschlagbild: Judenmeister Leyser im „Judenbuch der Scheffstrasse“, Hofkammerarchiv, aus : Reinhard Pohanka, Hinter den Mauern der Stadt. Eine Reise ins mittelalterliche Wien (Wien 1985) S. 126
Abb.1: Erste Erwähnung von Münzmeister Schlom, Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S.18
Abb.2: Die Lage der Wiener Synagoge, Klaus Lohrmann, Die Wiener Juden im Mittelalter, Geschichte der Juden in Wien, Bd. 1(Wien 2000) S. 95
Abb.3: Die Wiener Judenstadt, Ignaz Schwarz, Das Wiener Ghetto seine Häuser und Bewohner, (Wien 1909) S. 45
Hiermit erkläre ich diese Arbeit eigenständig und ohne fremde Hilfe verfasst zu haben und kein Material außer dem oben angegebenen verwendet zu haben
[...]
1 Klaus Lohrmann, Die Wiener Juden im Mittelalter, Geschichte der Juden in Wien, (Wien 2000), Bd. 1, 13
2 Hans Tietze, Die Juden Wiens. Geschichte, Wirtschaft, Kultur (Wien 1987, Nachdruck der Ausgabe von 1933) S. 15
3 Neubauer/Stern, Hebräische Berichte über die Judenverfolgung während der Kreuzzüge. Quellen zur Geschichte der Juden in Deutschland, 74 (hebr.) u. 211 ( dt.), Berlin 1892
4 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S.19
5 Hans Tietze, Die Juden Wiens. Geschichte, Wirtschaft, Kultur (Wien 1987, Nachdruck der Ausgabe von 1933) S. 16
6
7 Klaus Lohrmann, Die Wiener Juden im Mittelalter, Geschichte der Juden in Wien,
(Wien 2000), Bd. 1,S.39
8 Johann Evangelist Scherer, Die Rechtsverhältnisse der Juden in den deutsch - österreichischen Ländern, ( Leipzig 1901 ) S. 175
9 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S.30
10 Reinhard Pohanka, Hinter den Mauern der Stadt. Eine Reise ins mittelalterliche Wien (Wien 1985) S.127 18
11 nach Shlomo Spitzer, Bne Chet.: CDB V/1 71 Nr. 41 Punkt 32 : Item iunxta constiutiones pape Innocencii, sancti patris nostri, districto prohibemus, ne de ceteri iudei singuli in nostro dominio costituti culpari debeant quod humano utuntur sanguine cum iuxta preceptum legis ab omni prorsus sanguine se iudei contineant universi.
12 nach Shlomo Spitzer, Bne Chet :CDB V/2, 137 ff. Nr. 566; das Diplom vom 29 März 1262 CDB V/1 471 ff. Nr. 316.
13 Reinhard Pohanka, Hinter den Mauern der Stadt. Eine Reise ins mittelalterliche Wien (Wien 1985) S.97
14 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 36
15 Klaus Lohrmann, Die Judenverfolgungen zwischen 1290 und 1420 als theologisches und soziales Problem. Wellen der Verfolgung in der österreichischen Geschichte (Schriften des Instituts für Österreichkunde 48, 1986), S. 43
16 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 38
17 Klaus Lohrmann, Die Judenverfolgungen zwischen 1290 und 1420 als theologisches und soziales Problem. Wellen der Verfolgung in der österreichischen Geschichte (Schriften des Instituts für Österreichkunde 48, 1986), S. 45
18 Klaus Lohrmann, Die Judenverfolgungen zwischen 1290 und 1420 als theologisches und soziales Problem.
Wellen der Verfolgung in der österreichischen Geschichte (Schriften des Instituts für Österreichkunde 48, 1986),
S. 48
19 Willehald Paul Eckert, Die mittelalterlichen Beschuldigungen gegen die Juden. Judentum im Mittelalter (Ausstellungskatalog 1978), S. 91-108.
20 Klaus Lohrmann, Die Judenverfolgungen zwischen 1290 und 1420 als theologisches und soziales Problem. Wellen der Verfolgung in der österreichischen Geschichte (Schriften des Instituts für Österreichkunde 48, 1986), S. 50
21 Reinhard Pohanka, Hinter den Mauern der Stadt. Eine Reise ins mittelalterliche Wien (Wien 1985) S. 176
22 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 56
23 Klaus Lohrmann, Die Judenverfolgungen zwischen 1290 und 1420 als theologisches und soziales Problem. Wellen der Verfolgung in der österreichischen Geschichte (Schriften des Instituts für Österreichkunde 48, 1986), S. 51
24 H. Tietze, Die Juden Wiens. Geschichte, Wirtschaft, Kultur (Wien 1987, Nachdr. der Ausgabe von 1933) S.: 33
25 Klaus Lohrmann, Die Judenverfolgungen zwischen 1290 und 1420 als theologisches und soziales Problem.
Wellen der Verfolgung in der österreichischen Geschichte (Schriften des Instituts für Österreichkunde 48, 1986),
26 Hans Tietze, Die Juden Wiens. Geschichte, Wirtschaft, Kultur (Wien 1987, Nachdruck der Ausgabe von 1933)
S. 35
27 Willehald Paul Eckert, Die mittelalterlichen Beschuldigungen gegen die Juden. Judentum im Mittelalter (Ausstellungskatalog 1978), S.107.
28 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 116
29 Hans Tietze, Die Juden Wiens. Geschichte, Wirtschaft, Kultur (Wien 1987, Nachdruck der Ausgabe von 1933)
30 Heidrun Helgert und Martin Schmidt, Die mittelalterliche Synagoge auf dem Judenplatz, in: Perspektiven Heft 6/7 (2000) S. 47 ff.
31 Klaus Lohrmann. Die mittelalterliche Synagoge in Wien, in: Juden in Österreich, Ausgabe 2000, S. 12 f. 32
32 Heidrun Helgert und Martin Schmidt, Die mittelalterliche Synagoge auf dem Judenplatz, in: Perspektiven Heft 6/7 (2000) S. 47 f.
33 Heidrun Helgert und Martin Schmidt, Die mittelalterliche Synagoge auf dem Judenplatz, in: Perspektiven Heft 6/7 (2000) 50 f.
34 Reinhard Pohanka, Hinter den Mauern der Stadt. Eine Reise ins mittelalterliche Wien (Wien 1985) S. 131
35 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 121
36 Reinhard Pohanka, Hinter den Mauern der Stadt. Eine Reise ins mittelalterliche Wien (Wien 1985) S. 131
37 Klaus Lohrmann, Die Wiener Juden im Mittelalter, Geschichte der Juden in Wien, (Wien 2000), Bd. 1 S. 116
38 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 125 f.
39 Klaus Lohrmann, Die Wiener Juden im Mittelalter, Geschichte der Juden in Wien, (Wien 2000) Bd. 1, S. 123
40 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 129
41 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 131 ff.
42 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S.146.
43 Klaus Lohrmann, Die Wiener Juden im Mittelalter, Geschichte der Juden in Wien, (Wien 2000), Bd. 1, S. 119 ff.
44 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 149 f.
44 Monika Grübel, Judentum. Dumont Schnellkurs, Köln 1996, S. 45
46 Martha Keil, Rabbi Izchak bar Mosche Or Sarua. Der Begründer der mittelalterlichen Gelehrsamkeit in Wien, in: Juden in Österreich, Ausgabe 2000, S.18
47 S. Spitzer The jews in Austria 2, 98-9 Nr.616. Nach Grätz, Geschichte der Juden 6 und Gündemann, Geschichte des Erziehungswesens, 18, soll er in den sechziger Jahren nach Wien gekommen sein: s. auch Wolf , Wien, 14. Krauß, Wiener Geserah, S. 44-45 weist anhand von verschiedenen Dokumenten nach, dass er sich erst zu Beginn der neunziger Jahre in Wien niedergelassen hat.
48 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997)
49 Shlomo Spitzer, Niederösterreichische hebräische Urkunden aus dem 14. Jahrhundert. Unsere Heimat Jg. 51,
50 Monika Grübel, Judentum. Dumont Schnellkurs, Köln 1996 S.60 ff.
51 Zum Ritus im Allgemeinen : Monika Grübel, Judentum. Dumont Schnellkurs, Köln 1996 Klaus Lohrmann, Die Wiener Juden im Mittelalter, Geschichte der Juden in Wien, Bd. 1(Wien 2000), S: 93 ff. Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S.201 ff.
52 Nach Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. THD Nr. 34. S. a. LJ I,35
53 Zu den Festen und Feiertagen im allgemeinen Monika Grübel, Judentum. Dumont Schnellkurs, Köln 1996 S. 20 ff. Klaus Lohrmann, Die Wiener Juden im Mittelalter, Geschichte der Juden in Wien, Bd. 1 (Wien 2000), S.:93.ff Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S.208 f.
54 Monika Grübel, Judentum. Dumont Schnellkurs, Köln 1996 S. 122-125
54 Monika Grübel, Judentum. Dumont Schnellkurs, Köln 1996 S. 74-75
56 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 215
57 Monika Grübel, Judentum. Dumont Schnellkurs, Köln 1996 S. 165
58 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S.215
59 Klaus Lohrmann, Die Wiener Juden im Mittelalter, Geschichte der Juden in Wien, (Wien 2000) Bd. 1 S.:107
60 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S.187
61 Reinhard Pohanka, Hinter den Mauern der Stadt. Eine Reise ins mittelalterliche Wien (Wien 1985) S. 127
62 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 199
63 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien
64 nach Shlomo Spitzer, Bne Chet: Or Sarua Teil 1,225 Nr. 762. : Zhitomir 1862
65
66 nach Shlomo Spitzer, Bne Chet : THD Nr. 196
67 S. Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 221
68 S. Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 223
69 Monika Grübel, Judentum. Dumont Schnellkurs, Köln 1996 S. 162 59
70 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 227
71 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 229
72 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S. 231
73 Klaus Lohrmann, Die Wiener Juden im Mittelalter, Geschichte der Juden in Wien
74 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien
75 Klaus Lohrmann, Die Wiener Juden im Mittelalter, Geschichte der Juden in Wien, (Wien 2000) Bd. 1 S. 62 ff.
76 Shlomo Spitzer, Bne Chet. Die österreichischen Juden im Mittelalter. Eine Sozial- und Kulturgeschichte (Wien 1997) S.46
77 Klaus Lohrmann, Die Wiener Juden im Mittelalter, Geschichte der Juden in Wien, (Wien 2000) Bd. 1 S. 78 64
Häufig gestellte Fragen zu "Die Wiener Juden im Mittelalter"
Was ist das "Fridericianum"?
Das "Fridericianum" war die erste österreichische Judenordnung, erlassen von Herzog Friedrich II., welche die Rechte und Pflichten der Juden eindeutig festlegte. Es diente als Vorbild für alle weiteren Judenordnungen und regelte u.a. den Status der Juden als Geldverleiher und ihren Rechtsanspruch.
Wer waren die "Österreichischen Weisen" (Chachme Österreich)?
Als "Österreichische Weisen" werden die Rabbiner bezeichnet, die im 13. und 14. Jahrhundert in Wien wirkten und durch ihre Schriften weit über die Landesgrenzen hinaus auf das europäische Judentum einwirkten. Zu den bedeutendsten gehörten Rabbi Issak Or Sarua, Rabbi Meir ben Baruch Segal und Rabbi Avigdor ben Rabbi Elija Ha-Kohen.
Was war die Wiener Geserah?
Die Wiener Geserah war die Vernichtung der jüdischen Gemeinde von Wien im Jahr 1421. Sie resultierte aus dem Vorwurf der Hostienschändung und der Kollaboration mit den Hussiten. Die Juden wurden gefangengenommen, gefoltert, zwangsgetauft oder verbrannt, und ihre Synagoge wurde zerstört.
Was war die Rolle der Synagoge in der jüdischen Gemeinde Wiens?
Die Synagoge war der Mittelpunkt des jüdischen sozialen und religiösen Lebens. Sie diente als Gebetsstätte, Sitz des Rabbinatsgerichts und Ort für öffentliche Bekanntmachungen. Sie war auch ein Ort des Studiums und Lernens.
Welche wirtschaftlichen Tätigkeiten übten die Juden in Wien aus?
Die wirtschaftlichen Grundlagen der jüdischen Gemeinde beruhten auf dem Geldhandel (Geldverleih und Devisengeschäfte), dem Handel (Wein, Luxusgüter, Textilien, Arzneiwaren) und dem Handwerk (hauptsächlich zur Versorgung der jüdischen Gemeinde, aber auch für Christen).
Wie war die jüdische Gemeinde in Wien organisiert?
Die Gemeinde wurde vom Gemeindevorstand geleitet, der sich aus dem führenden Rabbi, dem Judenmeister und bedeutenden Geschäftsleuten zusammensetzte. Der Judenmeister leitete die Geschäfte mit den staatlichen Behörden und war für die Eintreibung von Steuern und Abgaben zuständig. Das Rabbinatsgericht (Bet Din) entschied alle innerjüdischen Angelegenheiten.
Welche Bedeutung hatte der Friedhof für die Wiener Juden?
Der Friedhof der jüdischen Gemeinde Wien lag vor dem Kärntnertor und stand unter dem Schutz des Landesherren. Grabschändungen wurden streng geahndet. Nach der gewaltsamen Auflösung der Gemeinde 1421 verfiel der Friedhof.
Wie unterschied sich die jüdische Kleidung von der christlichen in Wien?
Die Kleidung der Juden unterschied sich von den Gewändern der Christen aufgrund religiöser Vorschriften und nicht aufgrund städtischer Kleiderordnungen. Männliche Juden mussten einen Judenfleck und einen Judenhut (pileus cornutus) tragen.
Was waren die "Tötbriefe"?
Die "Tötbriefe" waren Finanzinstrumente, die von den Landesherren ausgestellt wurden, um Schulden von Adeligen gegenüber Juden für ungültig zu erklären. Dies konnte als Gegenleistung für politische oder militärische Dienste geschehen und führte oft zu finanziellen Problemen für jüdische Geldverleiher.
Welche Rolle spielte die "Mikwe" in der jüdischen Gemeinde?
Die Mikwe war das rituelle Badehaus der jüdischen Gemeinde und diente der rituellen Reinigung, insbesondere für Frauen nach der Menstruation. Sie war ein wichtiger Bestandteil jeder jüdischen Gemeinde.
Was waren die "aschkenasischen Semicha"?
Die "aschkenasischen Semicha" Ordination zum Rabbiner, Rabbi Meir ben Baruch Segal aus Fulda in Deutschland war der Begründer der "aschkenasischen Semicha".
Was war die Ikuv Ha-Tefilla?
Die Ikuv Ha-Tefilla war ein basisdemokratisches Instrument der jüdischen Gemeinde und oftmals die einzige Möglichkeit eines Juden, der sich von der Gemeinde übergangen oder benachteiligte fühlte, sich Gehör zu verschaffen.
Was war die Chailla?
die Chailla beschreibt die Ehepartner nach der Ehescheidungszeremonie die geschieden werden mussten.
- Quote paper
- Pohanka Christoph (Author), 2001, Die Geschichten der Juden im mittelaterlichen Wien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/101473