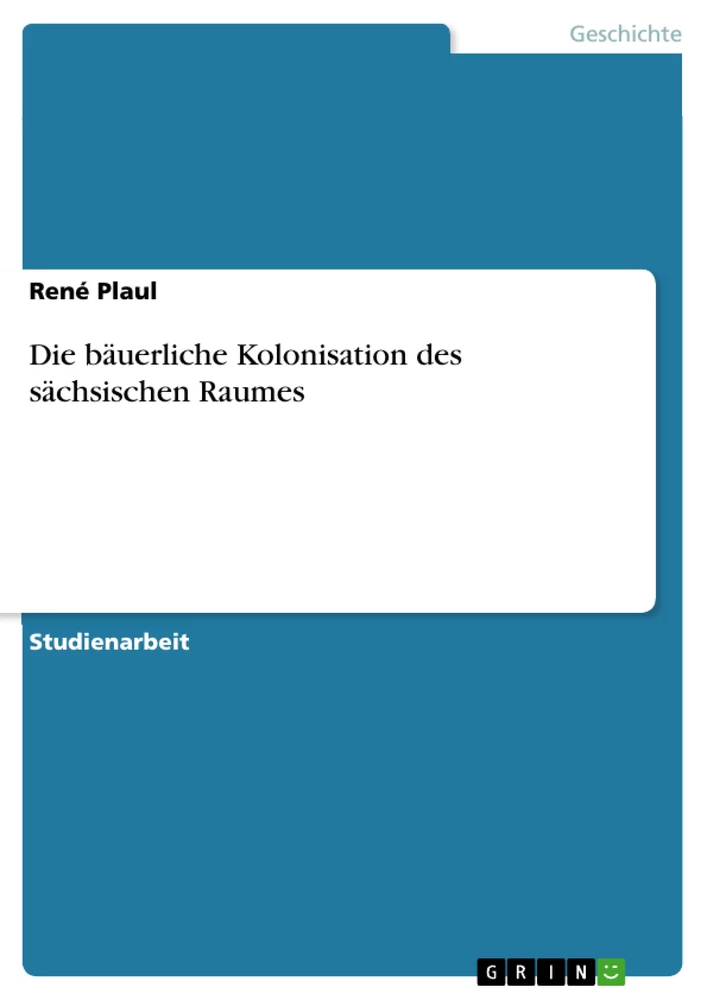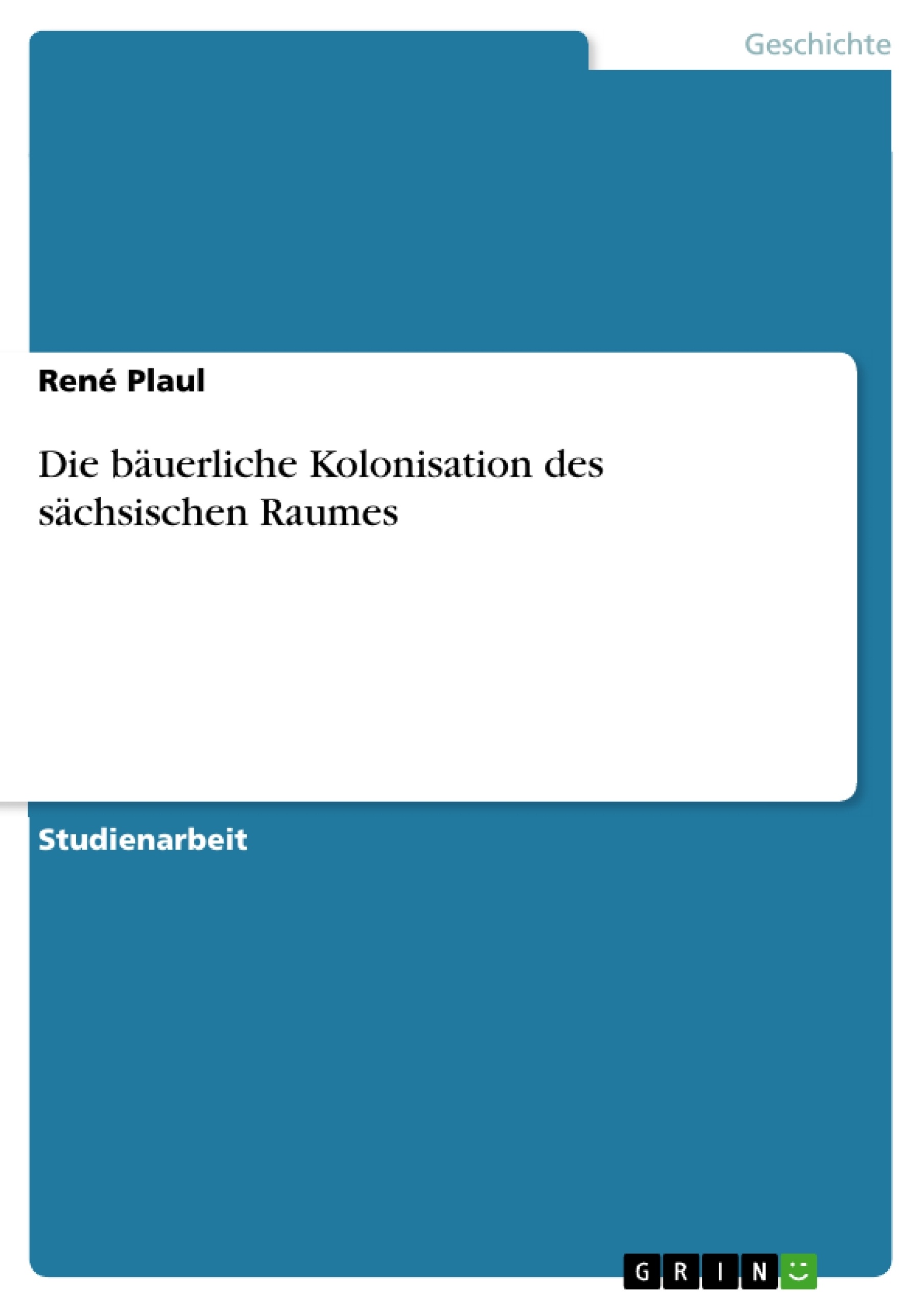Inhalt
3 Einleitung
3 Wie sah nun das leben vor der deutschen Besiedlung aus ?
6 Welche Voraussetzungen hatten deutschen Neusiedler?
8 Wie verlief die gemeinsame Besiedlung und wie entwickelte sich das
Verhältnis von Sorben und Deutschen ?
10 Literaturliste
11 Anhang
Einleitung
Als Wiprecht von Groitzsch 1096 das Benidiktinerkloster Pegau stiftet , läutet das wohl endgültig eine neue Phase der sächsischen Geschichte ein. Das Kloster war das erste östlich der Saale und bereitet die ausge- dehnte Missionstätigkeit unter der slawischen Bevölkerung vor. 1105 be- gann Graf Wilprecht ,dann mainfränkische Bauern um Lausick in der noch bewaldeten Gegend anzusiedeln.1 Damit sollte eine Siedeltätigkeit einset- zen bei der in 150 Jahren nach Rodung großer Waldflächen etwa 200.000 Menschen einwanderten und etwa 4000 neue Dörfer gründeten.2
Ich will in meiner Arbeit die Bedingungen und Voraussetzungen der Sie- deltätigkeit näher beleuchten und mich speziell mit den ersten Siedlern beschäftigen. Dabei wird für mich das Verhältnis der deutschen Siedler zu der alten, angestammten sorbischen Bevölkerung von besonderem Inter- esse sein.
Aus der großen Zahl von Werken, die sich seit über einhundert Jahren mit der Sächsischen Siedlungsgeschichte beschäftigt habe ich versucht, Werke aus verschiedenen Zeiten und mit unterschiedlichen Untersuchungsansätzen auszuwählen.
Wie sah nun das Leben vor der deutschen Besiedlung aus ?
Nach dem Band- und Schnurkeramiker der Bronzezeit aus dem Elbegebiet von den Germanen vertrieben wurden und die Germanen dann ab dem 4. Jh. zum Rhein oder später nach Böhmen abzogen stand die mittelelbige Landschaft mit ihrer dünnen Besiedlung gegenüber jedem bevölkerungs- starkem Nachbarn offen.3 In der „fast unbewohnten Einöde“4 erinnerten nur noch wenige Namen an die germanischen Bewohner. Vor allem Flüsse wie Elbe, Mulde, Havel oder Röder5 zeugten noch davon. Die einziehen- den Sorben6 besiedelten die Landschaft in ähnlich lockerer Form, wie es die Germanen vor ihnen taten. Sie siedelten im offenem Flachland und vermieden die Gebirge mit ihren Urwäldern so das die frühe Besiedlung nahe an den Gewässern stattfand. Meist vollzog sich die Entwicklung auf- wärts der Bäche und Flüsse.7 Die Dörfer, die sie anlegten, bezeichneten Sie nach dem Geschlechtsältesten oder nach der Beschaffenheit der Ört- lichkeit. (z.B. Bobritzsch bei Freiberg, slawisch Bobrowizy, die Leute des Bober; Plauen von Plawa, überschwemmte Fläche). Die Höfe wurden dabei entweder um einen kreisförmigen Platz (Rundling) oder an einer kurzen, breiten aber geschlossenen Gasse (Straßendörfer) angeordnet.8 Die Flur- form der slawischen Siedler war die Blockflur. Kleine Ackerblöcke, die der slawische hölzerne Hakenpflug im Kreuz- und Quergang bearbeiten konnte. Dabei wurden mit einer jährlichen Neuverteilung die Fläche wohl als Feld- Graswirtschaft genutzt. So nach und nach setzte sich aber auch bei den Slawen die eiserne Pflugschar durch.9 Entgegen den Ortsformen, die von Deutschen Siedlern ebenfalls angewendet bzw. übernommen10 wurden, setzte sich die Blockflur nur selten durch. (z.B. in Groß und Kleinborthen).
In den Gegenden, wo der Boden sehr sandig war spielte der Fischfang eine bedeutende Rolle. Gerade da, wo Flüsse entweder durch das Zusammen- treffen oder Trennen gute Möglichkeiten boten und Fischweiden vorhanden waren. Ortsnamen wie Zehren (Ceren = Senknetz) oder Wachwitz (Wach = geflochtene Fischreuse) zeugen bis heute von der einstigen Lebensgrund- lage.11
Neben der Fischerei war die Jagd und die Zeidlerei,12 meist als Einsammeln von Waldbienen- Produkten betrieben, von lebenswichtiger Bedeutung. So das der Wachs- und Honigzins bei der Tributserhebung besonders hervorgehoben wird.
Die Sorben hatten dabei kein geschlossenes Staatsgebilde, sondern sie lebten in Gauvölkerschaften. Wie die Nisaner im mittleren Elbtal, die Dale- minzer in der „Lomatzscher Pflege“ oder die Lusizer in der Niederlausitz13. Trotzdem versuchten sie sich natürlich zu schützen und bauten feste Bur- gen (System mit Wall und Palisaden). Ein Verzeichnis, daß in Regensburg entstand zählt 50 dieser sorbischen Anlagen auf. Dabei werden 14 den Daleminzern und 30 den Milzenern zugeordnet.14 Jana bei den Dalemin- zern oder Bautzen bei den Milzenern waren dabei wohl die Bedeutend- sten. Es gab aber auch eine Vielzahl von kleineren festen Plätzen, wie z.B. die Heidenschanze in Coschütz.15 Sie waren politischer, militärischer und religiöser Mittelpunkt. Und Religion war auch bei den Sorben wichtig. Vor der Missionierung hatten die Sorben eine polytheistische16 Naturreli- gion ohne Tempel. Es gab keinen geschlossenen Priesterstand, dessen Funktionen wurde von den Geschlechtsältesten und den Fürsten wahrge- nommen.17 Zwei Berge in der Oberlausitz könnten das deutlich machen Czorneboh, (der schwarze, böse Gott) und Bieleboh, (der weiße, gute Gott). Insgesamt läßt sich aber eine Vermischung von verschiedenen Ein- flüssen feststellen. So ist nicht gesichert, welche Teile nun altslawisch, neuslawisch oder gar unter dem Einfluß der Deutschen stand. So vermu- teten sie übernatürliches in Quellen, Bäumen und Wäldern oder glaubten an Erscheinungen wie die Mittagsfrau, die Sichelfrau oder der Wasser- mann und des Buschweib. Der Tod war bei ihnen weiblich (smjertnica).18 Die Grabbräuche waren sehr vielfältig und reichten von den anfänglichen Brandgräbern über Skelettbestattungen bis hin zu Beisetzungen in Stein- kisten. 1100, also kurz vor dem Beginn der großen bäuerlichen Kolonisa- tion lebten etwa 40 000 Sorben in der alten Offenlandschaft.
Welche Voraussetzungen hatten die deutschen Neusiedler ?
Die westlichen Siedelgebiete der Deutschen waren um 1100 so übervöl- kert, daß es immer schwieriger wurde, sich zu ernähren. Hinzu kam die drückende Form der Abhängigkeit des Bauern vom Herrn. Die Tradition der Aufteilung des Grundbesitzes unter den Berechtigten führte speziell am Rhein, in Mainfranken und Thüringen zur Zersplitterung der Anbauflä- che und ließ eine Selbstversorgung kaum noch zu. Der wirtschaftliche Landesausbau in West- und Mitteldeutschland war fast an seine natürli- chen Grenzen angekommen. Für viele war das ein Antrieb, neues Land zu besiedeln und dabei auch noch die Freiheit zu gewinnen19.
Sie zogen auf beschwerlichen Wegen Richtung Osten in den obersächsi- schen Raum, wo sie vor dem Nichts standen.20 Dieses Gebiet war nach 200-jährigen Kämpfen 1089 endlich frei von Ansprüchen Fremder und konnte besiedelt werden.21 Die wirtschaftliche Erschließung der Bauern aus dem altdeutschen Raum setzte bald nach 1100 ein, weitete sich ab 1150 über die Mulde aus und war in der Mark Meißen etwa 1250 abge- schlossen.22 ‘23
Allgemein wird der Zuzug der Bauern in drei Hauptsiedlerströme eingeteilt. Dabei spielte Thüringen am frühesten und stärksten eine besondere Rolle. Nicht nur das Thüringen Durchzugsgebiet der Zuwanderer aus dem rhein- fränkischen und dem hessischen Gebiet war, sondern die ersten Siedler kamen auch von dort. Die zweite Zuwanderungslinie kam aus Ostfranken und dem Mainlande . Franken brachten über diese Linie fränkisches Recht und die fränkische Hufe mit. Die dritte und auch nördlichste Linie benutzten die niederdeutschen, niederrheinischen und niederländisch- flämischen Einwanderer.24
Die Herkunft der Siedler ist durch einige Quellen überliefert. So belegt eine Urkunde, daß 1154 Kühren bei Wurzen Bischof Gerung von Meißen Fla- men ansiedelte, eine andere berichtet von einem Streit der 1186 zwischen dem Lehnsmann Adalbert von Taubenheim und den Franken der Dörfer Taubenheim, Sora, Ullendorf und Hasela stattfand.25 Aber etwas anderes wichtiges überliefern die Quellen noch: die Rechtsstellung der neuen Siedler.
Wenn ein Dorf von neuen Siedlern besetzt wurde konnte der Grundbesit- zer , dem das Land gehörte, die Leitung selbst übernehmen. Dieser konnte einen Vermittler (Schulze oder Richter) einsetzen, der Streit schlichtete. Das kam einer weitgehenden Selbstverwaltung gleich und wirkte sich sehr positiv auf die Entwicklung der Dörfer aus. In den Neu- dörfern galt ausschließlich deutsches Recht.26 Aus den Urkunden geht auch hervor, daß die Bauern der Kolonistendörfer von Frohndiensten be- freit waren.
Die Bauern aus den alten Siedelgebieten sicherten durch ihren Zuzug das militärisch- Machtpolitik beherrschte Gebiet der Sorben. Und ermöglichten, daß das Land auf Dauer in den deutschen Machtbereich eingegliedert war. Positiv muß dabei beachtet werden, daß eine gewaltsame Verdrän- gung der slawischen Bevölkerung nicht bekannt ist27 und davon ausge- gangen wird, daß beide Bevölkerungsgruppen friedlich nebeneinander wohnten und die Bevölkerung der Sorben in der Deutschen nach und nach aufging.28
Etwas anders verhielt sich das im Gebiet der Milzener (Milcieni), in dem bis heute eine ausgeprägte Sorbische Kultur vorhanden ist. Diese Be- siedlung setzte später ein und hat in ihrer Entwicklung (z.B. Namens- kunde) einige Besonderheiten, auf die ich in dieser Arbeit nicht eingehen kann.
Wie verlief die gemeinsame Besiedlung und wie entwickelte sich das Verhältnis von Sorben und Deutschen ?
Das Aufgehen der sorbischen Bevölkerung ist nicht verwunderlich, da am Ende der Besiedlung 40.000 Sorben, 350.000 Deutschen gegenüber stan- den.29 Aber es gibt bis heute noch eine Reihe von Spuren und Hinweisen, die das Zusammenleben beider Völker erahnen läßt. Die Grundlage für ein friedliches Miteinander hatte wohl die Kirche mit ihrer Missionierung bereitet. Denn das beide Völker der christlichen Kirche angehörten war ein viel wichti- gerer Aspekt, als der sprachlich- nationale Unterschied.30 Das macht die Be- trachtung einiger Ortsnamen deutlich. Denn noch ehe sich in einigen Orten ein Name für das Dorf ausbilden konnte wurde er nach der Kirche benannt. Namen wie Hohenkirchen (Leute bei der Hohen Kirche) oder Kirchberg (Leute am Kirchberg) zeugen noch heute davon. Das läßt darauf schließen, daß die Kirche schon in der frühesten Phase der Ortsentstehung gebaut wurde31 und macht damit die Wichtigkeit, die der Glauben für die Menschen hatte, anschaulich.
Entscheidend für ein erfolgreiches Siedeln war aber in welcher Form das ge- schah. Unterschieden werden kann dabei zwischen Siedlungen, die sich in altem sorbischen Siedlungsgebiet befinden oder Siedlungen, die auf völligem Neuland gegründet wurden.32 So können z.B. Namen von Siedlungen Aus- kunft geben, wie die deutschen und Sorben siedelten.33 Wendisch- Bora und Deutschen- Bora bei Nossen, Wendisch- Lupa und Deutsch- Lupa bei Oschatz oder Wendisch- Baselitz neben Deutsch- Baselitz bei Kamenz sind nur einige Beispiele dafür, daß die Besiedlung des Landes unbedingt mit der alten Sorbischen Besiedlung im Zusammenhang gesehen werden muß. Da- gegen sind Namen wie Bischofswerda, Mittweida oder Frankenberg eindeu- tig deutschen Ursprungs. Oft wurden auch Namen übernommen, die sich an slawische Bezeichnungen orientierten (Chemnitz).34 Ein genaueres be- leuchten von Ortsnamen ist ein interessantes Feld, aber würde den Rahmen bei weitem sprengen und kann so nicht Gegenstand dieser Arbeit sein.35 Ein anderer Aspekt zum Verständnis des Verhältnisses der beiden Völker ist, daß die Bewohner in den altsorbischen Dörfern für lange Zeit rechtlich und wirtschaftlich benachteiligt waren. In den vorkolonialen Ortschaften blieben die minderfreien Bewohner und hohen Belastungen mit Abgaben und Dien- sten erhalten. Die Vorteile, die in den Kolonistendörfern vorhanden waren konnten dort also nicht genutzt werden. Es wäre aber zu einfach, zu sagen, daß die Sorben benachteiligt oder unterdrückt waren. Die Trennung der Be- völkerung verlief zwischen den neuen und alten Dörfern. Wobei aber die sor- bische Bevölkerung zum größten Teil in den alten Dörfern wohnte.36 Ein Punkt der unbedingt noch angerissen werden muß, um das Miteinander der beiden Völker zu verstehen sind, die Siedlungsformen. So sind die kleinen Weiler oder Gassendörfer der vorkolonialen Zeit meist erhalten geblieben haben aber ihr Aussehen durch den Umbau des Hofes in einen Dreiseiten- oder Vierseitenhof verändert.37 Dieser mußte nach dem Sachsenspiegel so geräumig sein, daß ein Erntewagen wenden konnte.38 Die alten Rundlinge sind aufgeweitet worden („der Kreis“ in Radebeul) und es entstanden Rund- platzdörfer, oder an den Rundling ist angebaut wurden (Gruna)39. Die neuen Siedler zogen also auch Haus an Haus mit Sorben zusammen, nutzten mit ihnen zusammen ihre alten Dorfanlagen und erweiterten sie. Aus all diesen Gründen ist es wohl nicht übertrieben zu schlußfolgern, daß zwischen den Völkern eine im großen und ganzen friedliche Annäherung stattgefunden hat.
Literaturliste
Blaschke, Karlheinz; Bevölkerungsgeschichte von Sachsen bis zur Industriellen Revolution; Hermann Böhlans Nachfolger, Weimar; 1967
Blaschke, Karlheinz; Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen, 1. Teil; Bibliographisches Institut; 1957
Blaschke, Karlheinz; Geschichte Sachsens im Mittelalter; Unionverlag, Berlin; 1990
Butte, Heinrich; Hrsg.: Herbert Wolf; Geschichte Dresdens bis zur Reformationszeit; Mitteldeutsche Forschung, Band 54; Böhlan Verlag, Köln; 1967
Kaemmel, Otto; Sächsische Geschichte; Hellerau- Verlag Dresden GmbH; 1991
Kötzschke; Kretzschmar, Sächsische Geschichte, Band 1; Verlag C. Heinrich, Dresden; 1902
Kretzschmar, J.- R.; Die Entstehung von Stadt und Stadtrecht zwischen
Saale und Neiße; Neudruck der Ausgabe Breslau 1905; Scentia Verlag, Aa- len; 1991
Naumann, Günter; Sächsische Geschichte in Daten; Koehler& Amelang, München, Berlin; 1994
Thieme, André; Methoden und Aufgaben mittelalterlicher Siedlungsge-
schichte; In: Landesgeschichte in Sachsen; Hrsg.: Reiner Aurig, Steffen Herzog und Simone Lässig; Studien zur Regionalgeschichte, Band 10; Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld; 1997
[...]
1 „Erste urkundlicher Beleg für die Besiedlung des Landes östlich der Saale durch planmäßig angeworbene deutsche Bauern (bäuerliche Kolonisation).“ Günter Naumann; Sächsische Geschichte in Daten; Koehler & Amelang München, Berlin; 1994; S.: 21
2 ; Blaschke Karlheinz; Geschichte Sachsens im Mittelalter; Union Verlag Berlin; 1990; S.: 81 Wobei Karlheinz Blaschke die Siedlungsbewegung eher als allmähliches Einsickern von West nach Ost bezeichnet und das mit Rechenbeispielen unterstreicht.
3 Butte Heinrich, Wolf Herbert (Hrsg.); Geschichte Dresdens bis zur Reformationszeit; Mitteldeutsche Forschung, Band 54; Böhlan Verlag Köln; 1967; S.: 7
4 Kaemmel Otto; Sächsische Geschichte; Hellerau- Verlag Dresden GmbH; 1991; S.:22
5 Vgl. Butte Heinrich; Geschichte Dresdens S.: 7 und Kaemmel Otto; Sächsische Geschichte;... S.: 22
6 Den Name Sorben bekam das slawische Volk, daß von der Saale bis zum Havelland wohnte von den Deutschen Nachbarn. Vgl. Butte Heinrich; Geschichte Dresdens.. ; S.: 22
7 Thieme André; Methoden und aufgaben mittelalterlicher Siedlungsgeschichte in: Landesgeschichte in Sachsen; Aurig Reiner, Herzog Steffen, Lässig Simone (Hrsg.); Studien zur Regionalgeschichte; Band 10; Verlag für Regionalgeschichte Bielefeld; 1997; S.: 44
8 Kaemmel Otto; Sächsische Geschichte;... S.: 23
9 Butte Heinrich; Geschichte Dresdens..., S.:9
10 Der Rundling kann als Urmodell von Siedlung gesehen werden. Er versprach den größten Schutz gegenüber Feinden und Das Vieh konnte in seiner Mitte weiden, da ein abriegeln leicht möglich war.
11 Butte Heinrich; Geschichte Dresdens..., S.:10
12 Bienenzucht
13 Siehe Karte im Anhang
14 Kötzschke- Kretzschmar; Sächsische Geschichte; Band 1; C. Heinrich Verlag Dresden;
15 Kaemmel Otto; Sächsische Geschichte;... S.: 22
16 Polytheismus <griech..> Glaube an viele Götter
17 Kaemmel Otto; Sächsische Geschichte;... S.: 24
18 Kötzschke- Kretzschmar; Sächsische Geschichte; Band 1; C. Heinrich Verlag Dresden; S.:
19 Kötzschke- Kretzschmar; Sächsische Geschichte;... S.:
20 Zu empfehlen ist dabei die Beschreibung von Karlheinz Blaschke in seinem Buch: Die Geschichte Sachsens im Mittelalter. Sehr bildhaft wird dort von den Strapazen der Reise und von den großen Aufgaben des Neuanfangs berichtet. S.: 81- 82
21 Genaue Beschreibungen der Machtverschiebungen und Kämpfe dieser Zeit sollen nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. Lassen sich aber hervorragen Bei den Angegebenen Büchern von Karlheinz Blaschke, Otto Kaemmel und Günter Naumann nachlesen.
22 Die Besiedlung der Lausitz setzte 50 Jahre später ein.
23 Naumann Günter; Sächsische Geschichte in Daten;... S.: 22
24 Siehe Graphik im Anhang
25 Karlheinz Blaschke, Geschichte Sachsens im Mittelalter; S.: 84
26 Kötzschke- Kretzschmar; Sächsische Geschichte;... S.:
27 Butte Heinrich; Geschichte Dresdens..., S.:26
28 Blaschke Karlheinz; Bevölkerungsdichte von Sachsen bis zur industriellen Revolution; Hermann Böhlans Nachfolger, Weimar; 1967; S.: 174
29 Siehe oben S.: 175
30 30Blaschke Karlheinz; Bevölkerungsdichte von Sachsen bis zur industriellen Revolution; Hermann Böhlans Nachfolger, Weimar; 1967; S.: 175
31 Karlheinz Blaschke, Geschichte Sachsens im Mittelalter; S.: 87
32 Kötzschke- Kretzschmar; Sächsische Geschichte;... S.:
33 André Thieme geht in seinem Beitrag zur Erforschung der Landesgeschichte spezieller auf die Bedeutung, Entwicklung und Erkenntnisse von Onomastik (Namenskunde) der Orts und Flurnamen ein.[33] Thieme André; Methoden und aufgaben mittelalterlicher Siedlungsgeschichte in: Landesgeschichte in Sachsen;... S.: 48- 53.
34 Der Name stammt vom Chemnitzfluß der von altslawischen Siedlern vergeben wurde.
35 Zu empfehlen ist dabei z.B. Karlheiz Blaschke. der gezielt versucht Ortsnamen nach ihrer Herkunft zu analy- sieren. Karlheinz Blaschke, Geschichte Sachsens im Mittelalter; S.: 87- 90 oder sein Historisches Ortsver- zeichnis: Blaschke Karlheinz; Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen; Bibliographisches Institut; 1957; Teil 1- 4
36 Blaschke Karlheinz; Geschichte Sachsens im Mittelalter;... S.:107
37 Butte Heinrich; Geschichte Dresdens..., S.:27
38 Noch heute vorherrschende fränkische Hofanlage, mit der großer Toreinfahrt zur Straßenseite.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung über die deutsche Besiedlung Sachsens, insbesondere im Hinblick auf die ersten Siedler und ihr Verhältnis zur angestammten sorbischen Bevölkerung. Es beleuchtet die Lebensweise vor der Besiedlung, die Voraussetzungen der deutschen Siedler, den Verlauf der gemeinsamen Besiedlung und die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Sorben und Deutschen.
Wie sah das Leben vor der deutschen Besiedlung aus?
Vor der deutschen Besiedlung war das Gebiet von Sorben besiedelt, die in Gauvölkerschaften lebten. Sie siedelten bevorzugt im offenen Flachland nahe an Gewässern und vermieden die Gebirge. Ihre Dörfer waren entweder Rundlinge oder Straßendörfer. Die Landwirtschaft wurde mit dem Hakenpflug betrieben, wobei die Blockflur vorherrschte. Fischfang, Jagd und Zeidlerei spielten ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Sorben hatten feste Burgen zur Verteidigung und praktizierten eine polytheistische Naturreligion.
Welche Voraussetzungen hatten die deutschen Neusiedler?
Die westlichen Siedelgebiete der Deutschen waren um 1100 übervölkert, was zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Abhängigkeit der Bauern führte. Die Aussicht auf neues Land und Freiheit trieb viele Menschen an, in den obersächsischen Raum zu ziehen. Die Siedler kamen hauptsächlich aus Thüringen, Franken und den Niederlanden. Sie erhielten deutsches Recht und waren von Frohndiensten befreit.
Wie verlief die gemeinsame Besiedlung und wie entwickelte sich das Verhältnis von Sorben und Deutschen?
Die Besiedlung verlief weitgehend friedlich, wobei die Sorben nach und nach in der deutschen Bevölkerung aufgingen. Die Kirche spielte eine wichtige Rolle bei der Integration. Siedlungen wurden entweder in alten sorbischen Gebieten oder auf Neuland gegründet. Ortsnamen geben Hinweise auf die Besiedlungsgeschichte. In den altsorbischen Dörfern waren die Bewohner zunächst rechtlich und wirtschaftlich benachteiligt. Es kam aber zu einer Annäherung der Völker, wobei sie teilweise Haus an Haus zusammenwohnten und ihre Dorfanlagen gemeinsam nutzten.
Welche Literatur wurde für diese Arbeit verwendet?
Für die Arbeit wurden verschiedene Werke zur sächsischen Geschichte und Siedlungsgeschichte herangezogen, darunter:
- Blaschke, Karlheinz; Bevölkerungsgeschichte von Sachsen bis zur Industriellen Revolution
- Blaschke, Karlheinz; Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen, 1. Teil
- Blaschke, Karlheinz; Geschichte Sachsens im Mittelalter
- Butte, Heinrich; Hrsg.: Herbert Wolf; Geschichte Dresdens bis zur Reformationszeit
- Kaemmel, Otto; Sächsische Geschichte
- Kötzschke; Kretzschmar, Sächsische Geschichte, Band 1
- Kretzschmar, J.- R.; Die Entstehung von Stadt und Stadtrecht zwischen Saale und Neiße
- Naumann, Günter; Sächsische Geschichte in Daten
- Thieme, André; Methoden und Aufgaben mittelalterlicher Siedlungsgeschichte
- Arbeit zitieren
- René Plaul (Autor:in), 2000, Die bäuerliche Kolonisation des sächsischen Raumes, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/101305