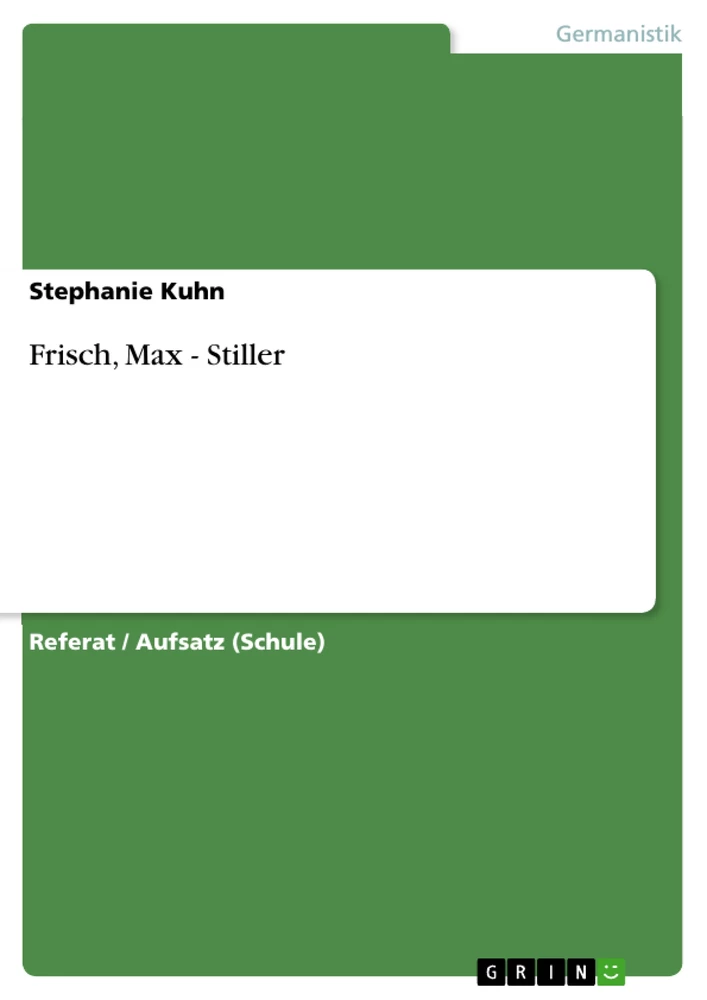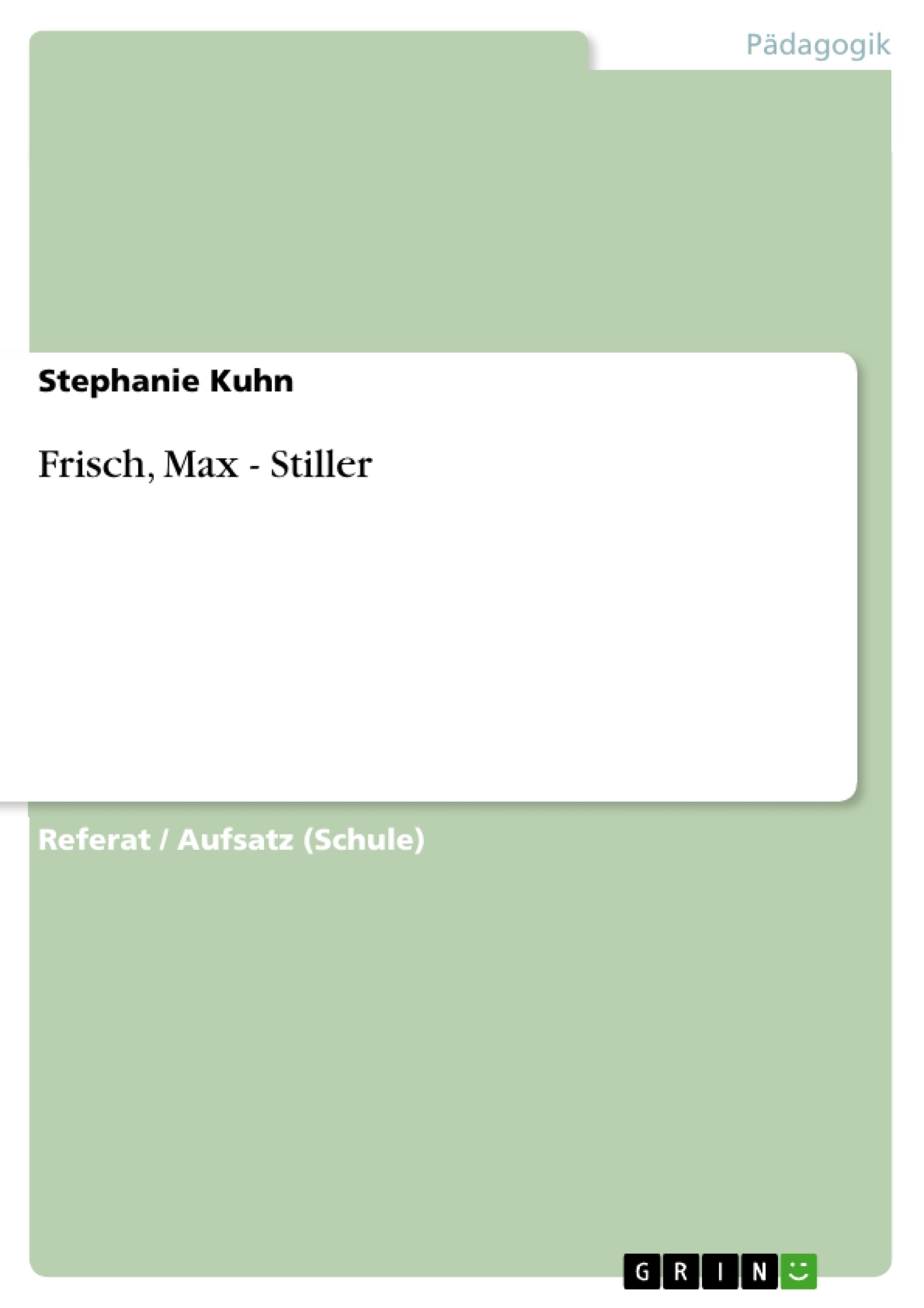Was bedeutet Identität, wenn die Welt ein Zerrbild von uns selbst entwirft? Max Frischs Roman „Stiller“ entführt uns in ein raffiniertes Verwirrspiel um Wahrheit, Lüge und die unerbittliche Macht der Projektion. Bei seiner Einreise in die Schweiz wird ein Mann, der sich Mr. White nennt, verhaftet – er soll der verschwundene Bildhauer Anatol Ludwig Stiller sein. Doch White beteuert seine Unschuld, er ist nicht Stiller! Im Gefängnis beginnt er, seine Geschichte aufzuschreiben, eine Geschichte voller Brüche, gescheiterter Beziehungen und dem verzweifelten Versuch, einer ihm aufgezwungenen Identität zu entfliehen. Durch seine Aufzeichnungen und die Erinnerungen seiner Frau Julika entsteht ein vielschichtiges Porträt eines Mannes, der als Künstler scheiterte, im Spanischen Bürgerkrieg versagte und dessen Ehe an der Unfähigkeit zur ehrlichen Kommunikation zerbrach. Ist White wirklich Stiller, der vor seiner Vergangenheit flieht, oder ist er ein Opfer einer fatalen Verwechslung? Tauchen Sie ein in einen psychologischen Strudel, der die Frage nach der eigenen Identität und der zerstörerischen Kraft von Vorurteilen aufwirft. Eine fesselnde Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur, die uns zwingt, unsere eigenen Bilder von uns selbst und anderen zu hinterfragen. „Stiller“ ist mehr als nur ein Roman; es ist eine literarische Reise zur Essenz des Menschseins, ein Spiegel, der uns unsere eigenen Masken und Rollenzwänge vor Augen führt. Begleiten Sie Mr. White auf seiner Suche nach Freiheit und Authentizität in einer Welt, die ihn in eine Rolle zwängen will, die er vehement ablehnt. Ein Meisterwerk der Schweizer Literatur, das die zeitlose Relevanz von Identität, Selbstbestimmung und der Überwindung gesellschaftlicher Erwartungen eindrücklich unterstreicht. Lassen Sie sich von Frischs sprachlicher Brillanz und der psychologischen Tiefe der Charaktere in den Bann ziehen und erleben Sie, wie die Grenzen zwischen Realität und Einbildung, Wahrheit und Täuschung verschwimmen. Ein Muss für alle, die sich mit den grossen Fragen des Lebens auseinandersetzen und die Komplexität menschlicher Beziehungen ergründen wollen. Entdecken Sie die erschütternde Wahrheit hinter der Maske des vermeintlichen Mr. White.
In dem 1954 erschienenen Roman „Stiller“ setzt sich der Schweizer Autor Max Frisch erneut wie auch in den Werken „Homo Faber“ (1957) und „Andorra“ (1961) mit der Problematik der Identität auseinander. Frisch zeigt in diesem Roman, wie sehr das Leben und Wesen jedes einzelnen durch Rollenverteilung und -erwartung geprägt wird und wie schwer es ist, diesen Anforderungen zu genügen. Oft wird die Persönlichkeit und das Bewusstsein des Menschen von der Umwelt zum Anderssein gezwungen, bis dieser diese Festschreibung annimmt und an diese Rolle glaubt. Es wird in „Stiller“ auch auf die Problematik hingewiesen, dass einem Menschen nicht die Möglichkeit gegeben wird, sich zu verändern. „Du sollst dir kein Bildnis machen“ - diese Worte sind nicht durch Frisch geprägt, jedoch in seinem Werk wieder aufgegriffen worden. Nicht dadurch, sich ein Bildnis zu machen sieht der Autor das Problem, sondern viel mehr darin, dieses „Bild“ nicht wieder verändern zu wollen, statt dessen den Menschen darin gefangen zu halten.
Bei der Einreise in die Schweiz wird der vermeintliche Amerikaner Mr. White festgenommen und wegen seines identischen Aussehens verdächtigt, der vor sieben Jahren verschwundene Anatol Ludwig Stiller, ein Bildhauer, zu sein. „White“ kommt ins Gefängnis, wo er von seinem Verteidiger dazu aufgefordert wird, sein Leben nieder zu schreiben. Der Leser erfährt auf diese Weise von Stillers Vergangenheit, die so Schritt für Schritt und von mehreren Perspektiven aufgedeckt wird.
An zahlreichen Nachmittagen, an denen er das Gefängnis verlassen darf, lernt „White“ Julika Stiller gut kennen und der Leser erfährt aus ihrer Perspektive viel von Stillers Vergangenheit: Stiller versagt als Bildhauer und als Freiwilliger beim Spanischen Bürgerkrieg. So sieht er die Ehe mit Julika, einer Balletttänzerin, als Bewährungsprobe an. Diese Ehe misslingt aber, da er ihre Verschlossenheit und ihren Narzissmus nicht erträgt und beide keine gemeinsame konstruktive Ebene für ihr Zusammenleben finden. Julika erkrankt an Tuberkulose und muss in ein Sanatorium in Davos. Sie schließt dort Bekanntschaft mit einem Sanatoriumsveteran, der später jedoch stirbt, was sie sehr berührt. Stiller- in ein anderes Verhältnis involviert- kümmert sich während dieser Zeit wenig um seine Frau, doch eines Tages im August besucht er sie dennoch. Es kommt zu einer ersten Begegnung, doch so plötzlich, wie er erscheint, verschwindet er auch nach einem Spaziergang mit der kranken Julika wieder. Als Julika es in dem Sanatorium nicht mehr auszuhalten glaubt, flieht sie, bricht jedoch in Landquart, einer Bahnstation, zusammen und wird so wieder zurück nach Davos gebracht. An einem trostlosen Novembertag begegnen sich die beiden ein letztes Mal, als Stiller Julika noch einen Besuch abstattet, mit der Absicht, ihre Beziehung zu beenden. Dieses letzte Gespräch vor Stillers Verschwinden ist zugleich auch der Schluss des zweiten Heftes.
Auch an dieser mir vorliegenden Textstelle zeigt sich ganz deutlich das Scheitern der Beziehung und die gegenseitige Rollenerwartung, sowie das ständige Gefühl des Versagens von Seiten Stillers. So sagt er schon zu Beginn der Textstelle: Ja, ich fragte mich manchmal, warum ich in all diesen Jahren nie aufgesprungen bin und dir kurzerhand eine Ohrfeige versetzt habe. Im Ernst, es ist ein Fehler, der nicht mehr nachzuholen ist; ein Fehler, davon bin ich überzeugt.“(S. 145) Wie schon so oft -er spricht zweimal von Schuld-, gibt er sich die Schuld, nicht versucht zu haben, Julikas Zurückgezogenheit und Passivität gewaltsam durchbrochen zu haben, sondern sich selbst zurückgezogen zu haben. Stiller sieht sich als Versager der Beziehung. Julikas Krankheit deutet er als Flucht aus der Beziehung, damit er sein schlechtes Gewissen bekommt- bewusst oder unbewusst. So spricht er hier auch von der Flucht aus dem Sanatorium, schließlich hätte sie gewusst, dass sie zusammenbrechen würde. Alles sei Inszenierung, um ihm ein schlechtes Gewissen zu machen und ihm die Schuld zu geben.
An der Krankheit allgemein schreibt sich Stiller dennoch die Schuld zu: „Und dabei ist es wieder das Fürchterliche: in einem ganz andern Sinn, siehst du, ist es wirklich mein Verschulden, dass du jetzt in diesem Sanatorium liegst.“ Von Anfang an deutet er ihre Beziehung als gescheitert und macht sich Vorwürfe. Er hat Julikas Erwartungen nicht entsprochen und sie umgekehrt genau so wenig seinen, so dass eine harmonische und am Ende beglückende Basis in ihrer Beziehung nie hat existieren können. So sagt er kurz darauf auch, dass, hätte sie einen anderen Mann kennen und lieben gelernt, sie vielleicht gesund wäre und auch bleiben würde. Für den Bildhauer Stiller sei die Beziehung sowieso immer nur eine „Bewährungsprobe“ (S. 145), wie er es nennt, gewesen. An dieser Bewährungsprobe sei er gescheitert, was ihn wieder -nach seinem Spanienerlebnis- als Versager dastehen lässt.
Doch auch Julika gibt er eine Teilschuld am Scheitern der Beziehung, denn sie habe ihm die ganze Zeit eine Rolle gegeben, aus der sie ihn nicht mehr entlassen habe. Sie hätte sich keinen Mann suchen sollen, der ihr unterliegt und dem sie ein schlechtes Gewissen aufzwingen kann, um ihn an sich zu binden, sondern einen Mann, „der nur durch natürliche Liebe zu gewinnen und zu halten ist“ (S. 145), welcher Rolle er nicht entspricht und somit nicht einhalten kann. Als nun Julika zu reden beginnt, macht sie ihrem Mann von vornherein wieder Vorwürfe, um sein schlechtes Gewissen zu wecken. Sie formuliert Frischs essentiellen Gedanken der Bildnisproblematik. Er -Stiller- dränge sie mit solchen Gedanken in eine Rolle, mache sich ein falsches Bild von ihr. Diesen Gedanken brachte ihr einst der Sanatoriumsveteran nahe. Dieser hoffte natürlich, Julika würde ich auf sich selber beziehen. Ihr Verhalten in diesem letzten Gespräch mit Stiller zeigt also, dass sie überhaupt nicht verstand. Sie stützt ihre Aussage noch mit einem „Nicht wahr?“(S. 145), um ihm noch deutlicher seine Schuld zu zeigen. Dieses „Nicht wahr?“ lässt keine andere Meinung zu als die ihre, womit Stiller wieder das Unrecht auf seiner Seite hat. Hier wird also ganz deutlich gemacht, dass Julika die stärkere Person in der Beziehung ist, die Stiller immer wieder zeigt, was für ein Versager er doch ist, der nichts kann und immer im Unrecht ist.
Auch macht sie ihm durch ihre Aussagen deutlich, dass es Stiller ist, der am Scheitern der Beziehung die Schuld zu tragen hat. Immer wieder macht sie ihm Vorwürfe. Schließlich mache er sich ein Bild von ihr, wie er es immer schon zuvor gemacht hat. „Du sollst dir kein Bildnis machen! Jedes Bildnis ist eine Sünde. Es ist genau das Gegenteil von Liebe, siehst du, was du jetzt machst mit solchen Reden.“ (S. 146) Gleich darauf gibt sie auch zu verstehen, dass Stiller nicht das Wesentliche versteht, von dem man redet. Sie sagt: „Ich weiß nicht, ob du’s verstehst“ (S. 146) und vermittelt ihrem Gegenüber das Gefühl, dass Stiller solche Gedanken nicht nachvollziehen kann.
Im gesamten Gesprächsverlauf merkt man, dass Julika ihrem Mann die Rolle des Versagers zuweist. Ihr selbst fällt nicht auf, dass sie sich längst ein Bild von Stiller gemacht hat. Genau dieses „Bildnis machen“ wirft sie ihm vor. Wenn sie auch davon spricht, dass man dem Partner immer die Möglichkeit geben sollte, sich zu verändern und aus der festgeschriebenen Rolle zu entschlüpfen, wenn man ihn liebt (S. 146), so ist hier bei der Betrachtung ihrer Beziehung zu sagen, dass nicht nur Stiller nicht liebt, sondern Julika genauso wenig. Das stellt Stiller daraufhin selbst fest: Man solle doch in ihrem Falle nicht von Liebe sprechen (S. 146).
„Reden wir doch offen!“ (S. 146)- zum ersten Mal in der Beziehung soll ein Thema wirklich offen behandelt werden, so, wie man es die ganze Zeit zuvor niemals geschafft hat. Stiller hat erkannt, vielleicht durch seine Beziehung mit Sibylle, wie falsch man in der Partnerschaft miteinander umgegangen ist, dass beide die Schuld am Scheitern tragen, da man nie offen zueinander gewesen ist. Nun redet Stiller nun auch auf eine Art offen mit Julika, da er sich selbst Eingeständnisse macht: “Unsere verhältnismäßige Treue war die Angst vor der Niederlage mit jedem anderen Partner, ..., nichts weiter.“ (S. 146)
Zum Schluss des Gesprächs sagt Stiller, dass er sich wegen Julikas Krankheit weder Vorwürfe macht noch großes Mitleid mit ihr hat: so sagt er, wäre es gut, wenn sie jetzt wüsste, „dass mir deine Krankheit keinen Eindruck mehr macht“ (S. 146). Das zeigt sich auch darin, dass er sagt: „Die Tränen in deinen Augen, Julika, sind eine Drohung, die nicht mehr wirkt.“ (S. 147)
Zum Ende der Beziehung ist er ihr zum ersten Male nicht böse. Stiller erkennt, dass er jetzt leben möchte, nicht ein Leben voll Vorwürfe und Rücksichtnahme, sondern ein freies Leben ohne ständig auferlegte Rollenerwartungen. Für ihn ist die ganze Beziehung beendet. Durch die Aussage „Nämlich sterben müssen wir alle“ (S. 147) drückt er nicht nur aus, dass er mit Julika abschließt, sondern auch mit seinem ganzen bisherigen Leben. Es ist für ihn der Beginn eines neuen Lebens und einer neuen Identität.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Max Frischs Roman "Stiller"?
In Max Frischs Roman "Stiller" (1954) geht es um die Problematik der Identität, wie sie auch in seinen Werken "Homo Faber" und "Andorra" thematisiert wird. Der Roman zeigt, wie stark das Leben und Wesen eines Menschen durch Rollenerwartungen und -zuschreibungen geprägt wird und wie schwierig es ist, diesen zu entsprechen. Oft wird die Persönlichkeit durch die Umwelt zum Anderssein gezwungen, bis man diese Festschreibung annimmt und daran glaubt. Der Roman weist auch auf die Problematik hin, dass Menschen nicht die Möglichkeit zur Veränderung gegeben wird. Das Problem ist nicht, sich ein Bildnis zu machen, sondern dieses nicht verändern zu wollen und den Menschen darin gefangen zu halten.
Wer ist Mr. White und was hat er mit Anatol Stiller zu tun?
Mr. White, ein vermeintlicher Amerikaner, wird bei der Einreise in die Schweiz festgenommen, da er dem vor sieben Jahren verschwundenen Bildhauer Anatol Ludwig Stiller zum Verwechseln ähnlich sieht. Er wird verdächtigt, Stiller zu sein und kommt ins Gefängnis, wo er von seinem Verteidiger aufgefordert wird, sein Leben niederzuschreiben.
Was erfährt der Leser über Stillers Vergangenheit?
Der Leser erfährt durch Mr. Whites Aufzeichnungen und Julika Stillers Perspektive viel über Stillers Vergangenheit. Stiller scheitert als Bildhauer und als Freiwilliger im Spanischen Bürgerkrieg. Seine Ehe mit Julika, einer Balletttänzerin, sieht er als Bewährungsprobe an, die jedoch misslingt. Julika erkrankt an Tuberkulose und kommt in ein Sanatorium nach Davos.
Wie verläuft das letzte Gespräch zwischen Stiller und Julika?
In dem letzten Gespräch vor Stillers Verschwinden konfrontiert Stiller Julika mit dem Scheitern ihrer Beziehung. Er gibt sich zwar die Schuld, Julikas Zurückgezogenheit nicht durchbrochen zu haben, wirft ihr aber auch vor, ihm eine Rolle zugewiesen zu haben, aus der sie ihn nicht entlassen hat. Julika wiederum wirft Stiller vor, sich ein falsches Bild von ihr zu machen, und beruft sich auf den Gedanken des Sanatoriumsveteranen. Stiller erkennt die Falschheit ihrer Beziehung und spricht zum ersten Mal offen mit Julika.
Welche Rolle spielen Schuld und Versagen in Stillers Leben?
Schuld und Versagen sind zentrale Motive in Stillers Leben. Er sieht sich als Versager in seiner Ehe mit Julika und fühlt sich für ihre Krankheit mitverantwortlich. Er glaubt, ihren Erwartungen nicht entsprochen zu haben und dass sie ihm unbewusst die Schuld zuweisen möchte.
Welche Bedeutung hat die Krankheit von Julika im Roman?
Julikas Krankheit wird von Stiller teilweise als Flucht aus der Beziehung gedeutet, um ihm ein schlechtes Gewissen zu machen. Er sieht sie als einen Weg, ihn an sich zu binden. Andererseits erkennt er aber auch, dass ihre Beziehung von Anfang an zum Scheitern verurteilt war und er ihre Erwartungen nicht erfüllen konnte.
Was bedeutet das Ende des Gesprächs zwischen Stiller und Julika?
Am Ende des Gesprächs beendet Stiller innerlich die Beziehung zu Julika. Er hat erkannt, dass er ein Leben ohne Vorwürfe und Rollenerwartungen führen möchte. Für ihn bedeutet dies den Beginn eines neuen Lebens und einer neuen Identität.
Welche übergeordneten Themen werden in "Stiller" behandelt?
Der Roman thematisiert die Problematik der Rollenerwartung und -zuschreibung, die Vorurteile gegenüber Menschen und die Schwierigkeit, sich aus festgeschriebenen Rollen zu befreien. Er betont die Notwendigkeit, Menschen die Möglichkeit zur Veränderung zu geben, um sich neu zu entdecken.
- Arbeit zitieren
- Stephanie Kuhn (Autor:in), 2001, Frisch, Max - Stiller, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/101061