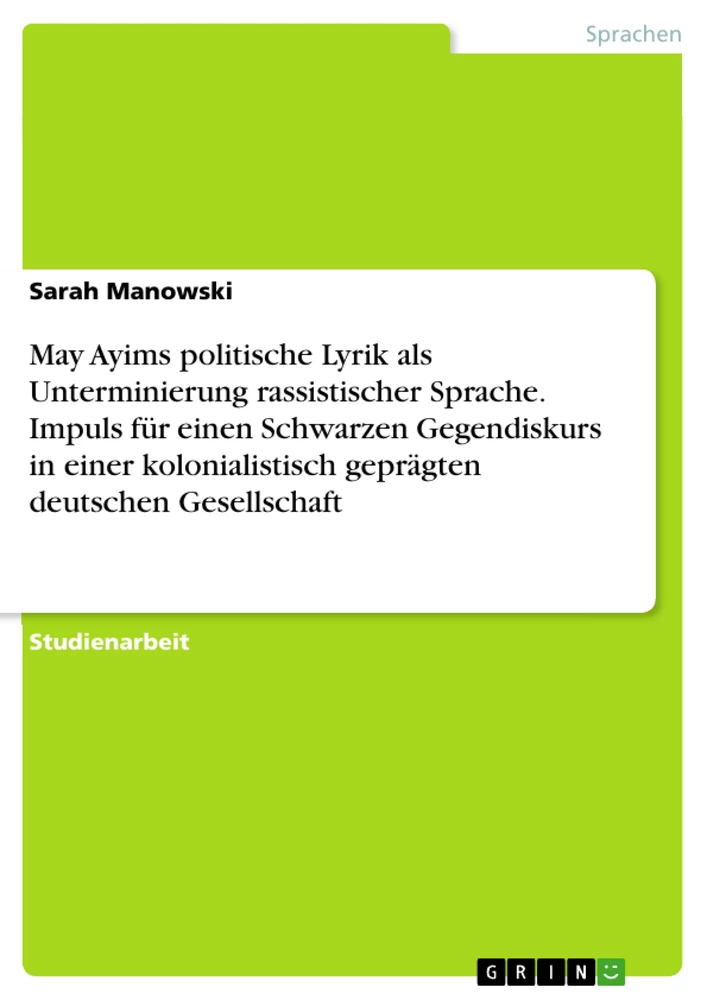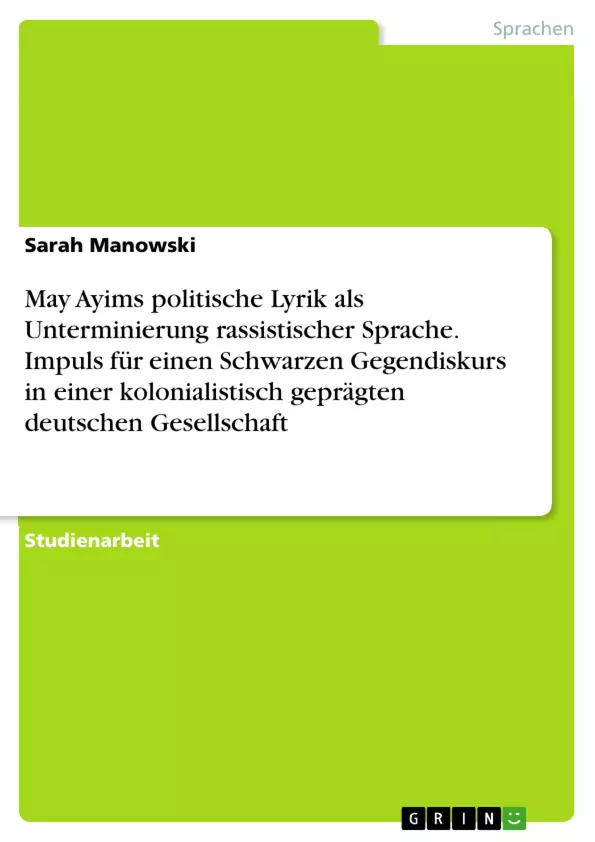Aufbauend auf poststrukturalistischen beziehungsweise feministisch-postkolonialen Ansätzen wird in dieser Arbeit herausgearbeitet, inwiefern Diskurse mit Macht zusammenhängen und wie eine Intervention der Machtlosen, hier konkret der Afrodeutschen, aussehen kann. Diesbezüglich stellt sich die Frage, ob oder inwieweit diese in der Lage sein können, Gegendiskurse und ein Umdenken innerhalb der Gesellschaft anzustoßen und somit Partizipation an strukturellen Gegebenheiten erleben zu können.
May Ayim, Schwarze Aktivistin und Mitgründerin des Vereins 'Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland' hat mit ihrer Lyrik diesen Versuch unternommen. Anhand einer Gedichtauswahl wird untersucht, mit welchen sprachlichen und rhetorischen Mitteln Lyrik zu einem Instrument der Politisierung werden kann.
Im postkolonialen Deutschland existieren in Bezug auf Schwarz gelesene Menschen bis heute kolonialistisch geprägte Sprach- und Denkmuster, die zu fortwährenden rassistischen Strukturen führen. Solche dienen der Konstituierung gegebener Hegemonien, die vom Großteil der Dominanzkultur nicht ausreichend hinterfragt oder nur oberflächlich betrachtet werden, denn geführte Diskurse blenden diese Problematik weitestgehend aus. Wissen wird aus weißer Perspektive produziert und reproduziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Postkolonialer Rassismus gegenüber Schwarzen Deutschen
- Kolonialrassistische Strukturen und Diskurse
- Kolonialistische Stereotypisierung und Sprache
- Diskurse als Mittel für hegemoniale Konstituierungen
- Verknüpfung von Diskurs und Macht - Epistemische Gewalt
- Zu feministischer postkolonialer Theorie: Stimme und Intervention der >Subalterne<
- May Ayims Gedichte als Dekonstruktion und Gegendiskurs – Verknüpfung von Literatur und Aktivismus
- Interpretation einer Lyrikauswahl Ayims hinsichtlich Sprachaneignung und Selbstermächtigung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht May Ayims politische Lyrik als Form des Widerstands gegen rassistische Strukturen in der deutschen Gesellschaft. Ziel ist die Analyse, wie Ayims Gedichte rassistische Sprache dekonstruieren und einen Schwarzen Gegendiskurs initiieren. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss kolonialer Diskurse auf die Gegenwart und die Möglichkeiten der Sprachaufarbeitung und -aneignung zur Selbstermächtigung.
- Postkolonialer Rassismus in Deutschland
- Dekonstruktion rassistischer Sprache in der Lyrik May Ayims
- Schwarzer Gegendiskurs als Widerstandspraxis
- Sprachaneignung und Selbstermächtigung
- Verknüpfung von Literatur und Aktivismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die zentrale These der Arbeit: May Ayims politische Lyrik dient als Dekonstruktion rassistischer Sprache und als Impuls für einen Schwarzen Gegendiskurs in Deutschland. Sie verbindet die soziologische Debatte um den Begriff "race" mit der Bedeutung von Sprache als kulturellem Produkt und Werkzeug der Macht. Die Autorin beschreibt ihr methodisches Vorgehen, die Verwendung von theoretischen Ansätzen Foucaults und Spivaks, und die gewählte Schreibweise von "Schwarz" und "weiß".
Postkolonialer Rassismus gegenüber Schwarzen Deutschen: Dieses Kapitel definiert Kolonialrassismus als historisch spezifische Form des Rassismus, die die weiße Hegemonie legitimiert und die strukturelle Diskriminierung Schwarzer Deutscher bedingt. Es wird der Wandel vom biologistischen zu einem kulturellen Rassismus beschrieben, wobei rassistische Stereotype weiterhin bestehen bleiben. Beispiele wie "racial profiling" und die Reproduktion rassistischer Stereotype in Schulbüchern veranschaulichen die Verankerung von Rassismus in der Gesellschaft und ihren Institutionen. Der deutsche Kolonialrassismus, wird als nicht nur auf rechtsextreme Handlungen beschränkt, sondern in der Gesellschaftsstruktur und den Institutionen verwurzelt dargestellt.
Schlüsselwörter
May Ayim, politische Lyrik, postkolonialer Rassismus, Schwarzer Gegendiskurs, Sprachaneignung, Selbstermächtigung, Dekonstruktion, kolonialistische Sprache, Diskursanalyse, Michel Foucault, Gayatri Spivak, afrodeutsche Literatur, Widerstandspraxis, Identität.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der politischen Lyrik May Ayims
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die politische Lyrik von May Ayim als Form des Widerstands gegen rassistische Strukturen in der deutschen Gesellschaft. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung, wie Ayims Gedichte rassistische Sprache dekonstruieren und einen Schwarzen Gegendiskurs initiieren.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert, wie Ayims Gedichte rassistische Sprache dekonstruieren und einen Schwarzen Gegendiskurs ermöglichen. Sie beleuchtet den Einfluss kolonialer Diskurse auf die Gegenwart und die Möglichkeiten der Sprachaufarbeitung und -aneignung zur Selbstermächtigung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt postkolonialen Rassismus in Deutschland, die Dekonstruktion rassistischer Sprache in Ayims Lyrik, den Schwarzen Gegendiskurs als Widerstandspraxis, Sprachaaneignung und Selbstermächtigung sowie die Verknüpfung von Literatur und Aktivismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die zentrale These – Ayims Lyrik als Dekonstruktion rassistischer Sprache und Impuls für einen Schwarzen Gegendiskurs – erläutert und die methodische Vorgehensweise beschreibt. Das Hauptkapitel behandelt postkolonialen Rassismus gegenüber Schwarzen Deutschen, definiert Kolonialrassismus und zeigt dessen Auswirkungen auf. Ein weiteres Kapitel analysiert Ayims Gedichte im Hinblick auf Sprachaneignung und Selbstermächtigung. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und Ausblick.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit nutzt theoretische Ansätze von Michel Foucault und Gayatri Spivak, um die Diskurse und Machtstrukturen zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: May Ayim, politische Lyrik, postkolonialer Rassismus, Schwarzer Gegendiskurs, Sprachaneignung, Selbstermächtigung, Dekonstruktion, kolonialistische Sprache, Diskursanalyse, Michel Foucault, Gayatri Spivak, afrodeutsche Literatur, Widerstandspraxis, Identität.
Wie wird die Lyrik von May Ayim interpretiert?
Die Lyrik von May Ayim wird als aktive Dekonstruktion rassistischer Sprache und als Form des Widerstands interpretiert. Es wird analysiert, wie Ayim Sprache aneignet und für die Selbstermächtigung nutzt.
Welche Rolle spielt Sprache in der Arbeit?
Sprache spielt eine zentrale Rolle, da sie als Werkzeug der Macht und als kulturelles Produkt betrachtet wird. Die Arbeit untersucht, wie rassistische Sprache dekonstruiert und durch einen Schwarzen Gegendiskurs konterkariert werden kann.
Wie wird der Begriff "race" in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit verbindet die soziologische Debatte um den Begriff "race" mit der Bedeutung von Sprache als kulturellem Produkt und Werkzeug der Macht.
- Quote paper
- Sarah Manowski (Author), 2021, May Ayims politische Lyrik als Unterminierung rassistischer Sprache. Impuls für einen Schwarzen Gegendiskurs in einer kolonialistisch geprägten deutschen Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1008434