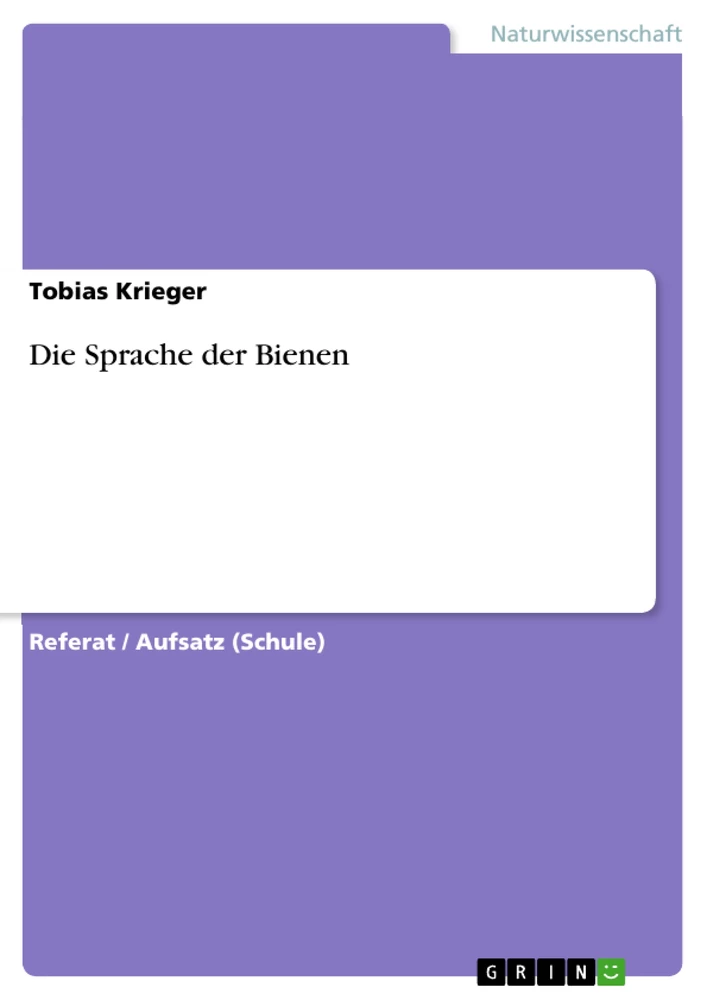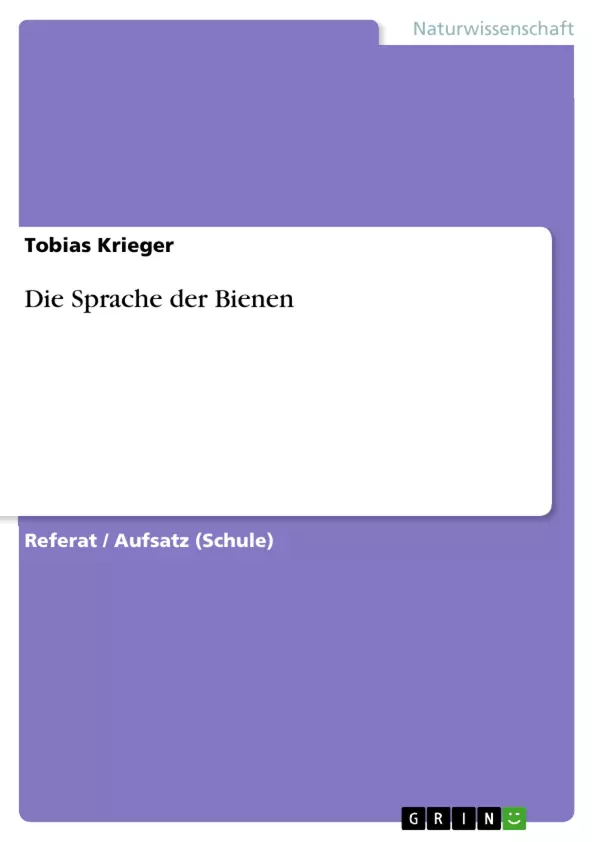Stell dir vor, du tauchst ein in eine verborgene Welt, in der jede Bewegung, jeder Tanz, jede Duftnote eine tiefere Bedeutung trägt: Willkommen im faszinierenden Universum der Honigbienen! Dieses Buch enthüllt die komplexen sozialen Strukturen und die erstaunliche Arbeitsteilung innerhalb eines Bienenvolkes, von den fleißigen Baubienen, die kunstvolle Waben errichten, bis zu den unermüdlichen Sammlerinnen, die Nektar und Pollen für die Gemeinschaft eintragen. Entdecke, wie die Bienen durch ihre einzigartigen Tänze kommunizieren, um Nahrungsquellen zu finden und sich über deren Entfernung, Richtung und Qualität auszutauschen. Erfahre mehr über die geheimnisvolle Paarung der Bienenkönigin, die nur einmal in ihrem Leben stattfindet, und die faszinierenden Mechanismen der Fortpflanzung und Geschlechtsbestimmung. Begleite die Bienen bei ihrem jährlichen Ausschwärmen, wenn ein Teil des Volkes sich aufmacht, eine neue Niststätte zu gründen, und beobachte, wie sie gemeinsam die beste Option auswählen. Dieses Buch ist eine Hommage an die Intelligenz und die Anpassungsfähigkeit dieser kleinen Geschöpfe, die eine unverzichtbare Rolle in unserem Ökosystem spielen. Es ist eine Einladung, die Welt mit neuen Augen zu sehen und die Wunder der Natur in ihrer ganzen Pracht zu erkennen. Tauche ein in eine Welt voller Überraschungen, in der Gemeinschaft, Kommunikation und Überleben auf einzigartige Weise miteinander verbunden sind. Lass dich von der Weisheit der Bienen inspirieren und entdecke, was wir von ihnen über Organisation, Zusammenarbeit und die Bedeutung eines harmonischen Zusammenlebens lernen können. Ein Muss für alle Naturfreunde, Imker und alle, die sich für die Geheimnisse des Lebens interessieren. Die Arbeit der Bienen ist mehr als nur Honigproduktion; sie ist ein Spiegelbild unserer eigenen Gesellschaft und eine Quelle unendlicher Inspiration.
Vorgeschichte:
Wir überlegten uns welches Thema wir von den sechs, die zur Auswahl standen nehmen sollten. Da wir durch Zufall, oder mehr durch eine Strafarbeit auf die Bienen stießen, entschlossen wir uns kurzerhand für dieses Thema. Wir fragten also bei Bekannten herum, ob sie einen Imker kennen würden, der im Stande wäre, uns zu helfen. Nach gar nicht all zu langer Zeit meldete sich dann ein Mann telephonisch bei uns: Er hieß Albert Koch und ist Präsident des schweizerischen Imkerverbandes. Herr Koch lud uns nun an einem freien Nachmittag zu seinem Imkerhäuschen ein.
Dort angekommen mussten wir feststellen, dass das Wetter denkbar schlecht für Beobachtungen im Bienenstock war. Es war zu kalt und regnete leicht. Es war kaum anzunehmen, dass sich eine Biene draußen hätte blicken lassen. Nach einem kurzen Gespräch entschlossen wir uns Herr Koch zu ,,interviewen", um wenigstens etwas an diesem Nachmittag erreicht zu haben. Mit der Zeit nahm das Ganze dann aber eine überraschende Wende. Herr Koch konnte uns das Ganze sehr bildhaft erklären und uns kamen immer wieder neue und noch bessere Fragen in den Sinn, dass wir bis am Abend miteinander redeten und wir uns mit immer mehr Wissen voll stopften.
Die Tatsache, dass wir die Bienen nicht beobachten konnten, verunmöglicht es uns ein Protokoll zu führen. Wir versuchen nun aber das Aufgenommene in Textform wieder zu geben.
1. Die Arbeitsaufteilung der Biene
Wer schon einmal einen Blick in das Innere eines Stocks getan hat, muss sich wundern, wie in diesem Wirrwarr abertausender von Bienen, die scheinbar sinnlos herumlaufen, überhaupt eine Zusammenarbeit möglich sein soll. Dennoch muss sie bestehen, denn wie sollten sonst die kunstvollen, regelmäßigen Waben errichtet, wie die Brut ordnungsgemäß aufgezogen, wie ausreichend Pollen und Nektar eingetragen werden.
Um dies herauszufinden, bedienen sich Wissenschaftler einer einfachen aber wirkungsvollen Methode : Sie markieren einzelne Bienen mit einem Farbtupfer und beobachten sie über einen längeren Zeitraum. Das Ergebnis: Jedes einzelne Tier geht einer bestimmten Tätigkeit nach, als hätte es einen besonderen Auftrag.
Da sind zunächst die Baubienen, die für den Wabenbau zuständig sind. Sie haben auf der Bauchseite spezielle Wachsdrüsen, aus denen sie winzige Wachsschuppen ausschwitzen, zurechtbeißen und dann Stück für Stück zu den regelmäßigen Sechsecken zusammenfügen. Der Wabenbau ist architektonisch und ökonomisch einzigartig, nutzt das Sechseckmuster den Raum doch besser als jedes andere geometrische Muster.
Eine zweite Berufsgruppe bilden die Brutammen. Sie betreuen, wie der Name schon sagt, die Kinderstube der Hausarbeiten.de - Die Sprache der Bienen Bienen, das heißt, sie inspizieren die Larven und versorgen sie mit besonderem Futter.
Wieder eine andere Gruppe ist mit Reinigungsaufgaben beschäftigt. Sie bereitet die leer gewordenen Zellen für die Eiablage vor, das heißt, sie reinigt sie und tapeziert sie danach mit einem sterilisierenden Sekret aus.
Ein Wissenschaftler meint: "Es gibt auf der Welt keine Kinderklinik und kein Säuglingsheim, das in hygienischer und pflegerischer Hinsicht mit der Brutpflege der Bienen konkurrieren kann. Würde ein menschlicher Säugling so intensiv und mit so hochwertiger Nahrung versorgt werden wie eine Bienenlarve, würde der Säugling in sechs Tagen ein Gewicht von 32 Zentnern erreichen.
Unbedingt zu erwähnen sind auch die Wächterbienen, die Tag für Tag am Nesteingang Posten beziehen und nur Angehörige des eigenen Volkes, erkennbar an ihrer speziellen Duftnote, hineinlassen.
Die letzte, aber sicher nicht die unwichtigste Gruppe, sie die Sammelbienen (auch Trachtbienen genannt), die bei sonnigem Wetter unermüdlich das Futter für das gesamte Volk eintragen. Indem sie mehr bringen als verbraucht wird, können für die nachfolgende Generation, die den Winter zu überleben hat, genügend Vorräte gespeichert werden.
Wie ungeheuer groß die Sammelleistung der Bienen ist, veranschaulicht folgende Rechnung:" Um ein halbes Kilo Honig zu speichern und einzudicken, müssen sie mindestens zwei Millionen Blüten besuchen und dabei eine Wegstrecke bewältigen, die der dreifachen Umrundung des Erdballs gleichkommt" Der Hauptnutzen , den die Sammelbienen bringen liegt aber nicht im Honigertrag, sondern in der Bestäubung wichtiger Nutzpflanzen.
Angesichts dieser höchst unterschiedlichen Aufgaben - und es gibt noch mehr-, könnte man vermuten, dass sich jede Biene von Jugend an, auf eine bestimmte Tätigkeit spezialisiert, sei es nun aus Neigung oder weil sie vielleicht in ihren Genen vorprogrammiert ist. Beides trifft nicht zu, sonder tatsächlich verrichtet jede einzelne Biene im Laufe ihres Lebens sämtliche Tätigkeiten, die in einem Bienenvolk anfallen- bis auf das Eierlegen. Das bleibt der Königin vorbehalten.
Und so sieht der Lebenslauf einer Biene aus: unmittelbar nach dem Schlüpfen beginnt das junge Tier zunächst für etwa drei Tage den Reinigungsdienst. Anschließend betätigt sie sich sieben Tage lang als Brutamme. Vom zehnten Lebenstag an arbeitet die Biene eine Woche lang als Baubiene. Anschließend wird sie als Wächter vor dem Flugloch Stellung beziehen. In der dritten Lebenswoche schließlich reiht sie sich unvermittelt in die Schar der Sammelbienen ein und wird bis an ihr Lebensende dabei bleiben. Ist das Angebot an Pollen und Nektar reichlich, werden Bienen vier bis fünf Wochen alt, in der kalten Jahreszeit etwa zwölf Wochen und Winterbienen fünf bis sechs Monate.
Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als seien die verschiedenen Tätigkeiten an bestimmte Lebensabschnitte gebunden, als würde sich also eine Verständigung darüber, wer was wann zu tun haben, erübrigen. Dies um so mehr, da die verschiedenen Beschäftigungen mit körperlicher Veränderung verbunden sind: Die Ammendrüsen im Kopf sind am höchsten zur Zeit der Brutpflege entwickelt und die Wachsdrüsen am Bauch während der Tätigkeit als Baubiene. Nach jedem entsprechenden Lebensabschnitt stellen die genannten Drüsen ihren Dienst ein.
Nach der bisherigen Schilderung der Arbeitsteilung im Bienenstaat muss es deshalb verblüffen zu erfahren, dass dieses Schema keineswegs starr ist, sondern tatsächlich verändert werden kann, wenn es - und das überrascht besonders - die soziale Lage erfordert.
Diese Labilität und Anpassungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt des Bienenstaates stellt uns natürlich die Frage: Wer informiert die einzelne Biene, welche Tätigkeit sie jeden Tag auszuführen hat?
Die Erklärung ist so einfach, dass sie verblüfft: Jede Biene holt sich selbst die nötigen Informationen über das, was im Stock zu tun ist. Dazu unternimmt sie ausgedehnte Patrouillengänge. Diese können bis zu 40 Prozent ihrer gesamten Tätigkeit ausmachen. Dabei inspizieren sie jede einzelne Zelle im gesamten Bau, erfahren so, wo gereinigt werden Hausarbeiten.de - Die Sprache der Bienen muss, ob eine Larve Futter braucht, was zu reparieren ist. Dort wo es an etwas mangelt, springen sie, sofern es ihr physiologischer Zustand erlaubt, uneigennützig ein.
2. Der Tanz und die Nahrungsbeschaffung
Wie finden die Bienen ihre Trachtquellen? Wodurch werden sie in großen Scharen zu einer Stelle geführt?
Um dieses Geheimnis zu lüften, kennzeichnete ein Wissenschaftler namens Karl von Frisch eine Kundschafterbiene mit einem Farbklecks und beobachtete sie bei ihrer Rückkehr in den Stock. Und was er da sah, nannte er später einmal die wichtigste Entdeckung seines Lebens: Die mit Pollen oder Nektar beladene zurückkehrende Biene lief zunächst kurz im Zickzack und begann dann mit raschen, trippelnden Schritten auf der Wabe eine Art 8er-Figur zu laufen, einmal rechts herum, einmal links herum im raschen Wechsel. Diesen Rundtanz, er kann bis zu drei Minuten dauern, wiederholt sie an mehreren Stellender Wabe und versetzt damit die benachbarten Artgenossen in größte Aufregung. Sie trippeln hinter der Tänzerin her, halten ihre Fühler an deren Hinterleib und folgen ihr, wenn diese zum Flugloch eilt und zum Futterplatz zurückfliegt. Offensichtlich wurden sie durch den Tanz auf einen Futterplatz hingewiesen.
Die Tänzerinnen im Stock verkünden jedoch nicht nur das Vorhandensein von Futter, sondern auch die Blütensorte, von der es zu holen ist. Diese Information, so fand von Frisch heraus, wird ebenfalls während des Tanzes weitergegeben. Das geschieht durch den Duft, der mit dem Nektar und Pollen sowie im Haarkleid der Sammelbiene Mit in den Stock gebracht Wird. Stockgenossinnen, die der tanzenden Biene hinterherlaufen, legen ihre Fühler auf den Hinterleib der Tänzerin. Auf den Fühlern befinden sich die Geruchsorgane. Damit nehmen sie nun den Duft der Futterquelle wahr. Die so informierten Bienen besuchen von nun an nur noch die Blüten jener Pflanzenart, die diesen spezifischen Duft haben.
Damit steht fest, dass eine Kundschafterbiene ihre Stockgenossinen bereits darüber informiert hat, welches Futter an welcher Blüte zu holen ist. Das allein aber würde noch nicht reichen, um die Quelle ausbeuten zu können. Dazu müssen die anderen Bienen auch wissen, in welcher Richtung sie wie weit zu fliegen haben.
Diese Informationen werden über die Tanzweise vermittelt: Liegt die Futterquelle in unmittelbarer Nähe des Stocks, vollführt die Kundschafterbiene den eben erwähnten Rundtanz. Er sagt aus, dass die Futterquelle nicht weiter als 100 Meter vom Stock entfernt ist.
Liegt die Futterquelle aber 100 Meter oder mehr vom Heimatstock weg, so tritt an die Stelle des Rundtanzes der Schwänzeltanz. Auch bei ihm trippeln andere Bienen der Tänzerin nach. Diese läuft zunächst einen Halbkreis, dann geradlinig zurück, danach einen Halbkreis nach der anderen Seite und wiederum geradlinig zurück und so fort. Während des Geradelaufens schwänzelt sie lebhaft mit dem Hinterleib und erzeugt gleichzeitig einen Scharrton. Da aber Bienen nicht hören können, liegt der Informationsgehalt nicht in den Tönen selbst, sondern in deren Vibration, die die Nachläuferinnen wahrnehmen.
Über die Entfernung der Futterstelle informiert die Kundschafterbiene durch eine entsprechende Veränderung im Rhythmus ihres Tanzes. Schneller Rhythmus gilt für nahe Futterstellen; je langsamer die Schwänzelläufe aufeinander folgen, desto weiter liegt das Ziel entfernt.
Nun würden den Artgenossen im Stock die bisherigen Angaben über Art und Entfernung der weiter weg liegenden Futterquelle wenig nützen, wenn sie nicht auch gleichzeitig über die Richtung informiert würden, in der sie diese zu suchen haben. Erfahren sie dies nämlich nicht, müssten sie auf der weiträumigen Suche enorme Mengen an Energie aufwenden. Wie ist also das zu vermeiden?
Natürlich muss man jetzt daran denken dass sich die Informationsübermittlung in ihrem dunklen Stock und dazu noch Hausarbeiten.de - Die Sprache der Bienen auf einer senkrecht stehenden Wabe abspielt. Wie ist dabei ein Ziel anzugeben, das in der Horizontalen liegt?
Um festzustellen, wie das geschieht, haben die Wissenschaftler eine Sammelschar an ein Futtertischchen 500 Meter vom Stock entfernt im Süden lockt und ihre Tänze den ganzen Tag beobachtet. Dabei stellten sie fest, dass sich die Richtung der Schwänzelläufe auf der vertikalen Wabe vom Morgen bis zum Abend entgegen dem Uhrzeigersinn ändert, und zwar genau entsprechend der Sonnenwanderung. Am Morgen weist der Schwänzeltanz nach rechts, schwenkt dann bis Mittag direkt nach oben und erreicht schließlich abends um 18 Uhr die horizontale Lage ca. 90 Grad nach links. Allgemein lässt sich sagen, dass sämtliche Tanzrichtungen der Lotrechten nach links und rechts zugeordnet werden, je nachdem, ob die Flugbahn links oder rechts zur Sonne verläuft. Schwänzellauf nach oben heißt demnach: Das Ziel liegt in der Richtung zur Sonne; Schwänzellauf nach unten bedeutet: Ihr müsst von der Sonne wegfliegen, damit ihr zum Ziel kommt. Schwänzellauf 80 Grad links von der Lotrechten zeigt ein Ziel an, das 80 Grad links von dem jeweiligen Sonnenstand liegt.
Die Richtung die im Schwänzeltanz angezeigt wird, ist auch dann zu erkennen wenn die Sonne verdeckt ist. Den Bienen reicht schon ein kleiner blauer Fleck am Himmel, den sie können - im Gegensatz zu uns Menschen - die Schwingungsrichtung des polarisierten Lichts wahrnehmen und anhand dessen den Sonnenstand berechnen.
Neben Informationen über Ort und Pflanzenart werden im Tanz auch Angaben über die Rentabilität und die Qualität der aufgefundenen Futterquelle geliefert Dies geschieht durch die Lebhaftigkeit und die Dauer des Tanzes. Besonders interessant dabei ist, dass Ergiebigkeit und Qualität der Futterquelle von der einzelnen Biene nicht nach subjektiven Maßstäben bewertet werden, sondern soziale Bedürfnisse den Ausschlag geben.
3. Die Paarung der Bienen
Wenn die Drohnen (männliche Bienen) merken, dass sich in ihrem Volk zu wenig Bienen befinden, fliegen sie aus. Sie treffen sich alle an einer einzigen Stelle, welche sich 10 Meter über Boden und 5 Kilometer vom Stock entfernt befindet, dem so genannten Sammelplatz. Während des Fluges dorthin sondern sie bestimmte Pheromone aus, welche der Bienenkönigin den Weg zu ihrem Sammelstock weisen soll. Die Königin fliegt nun entgegen der Flugrichtung und folgt dem Geruch. Ist die Königin am Sammelplatz angelangt, wird sie von der schnellsten Drohne befruchtet, dabei stirbt die Drohne und es ist ein lauter Knall zu Hören, da sich das innere der Drohne nach außen kehrt. Wahrscheinlich hat die Drohne keine Ahnung das sie für diese Begattung mit dem Leben bezahlt, aber sie tut dies ja nicht aus sexueller Begierde sondern der Fortpflanzung wegen.
Die ersten Erforscher der Paarungsgewohnheiten von Honigbienen nahmen an, dass siech eine Königin nur einmal in ihrem Leben paart. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen brachten jedoch den Beweis, dass sich eine Königin in der Regel im Lauf einiger Tage mit sechs oder mehr Drohnen paart. Die freibeweglichen Samenzellen der Drohnen gelangen in ein kleines, sackartiges Organ, den als Spermatheka bezeichneten Samenbehälter, im Hinterleib der Königin. Die Spermien bleiben in diesem Behälter während des gesamten Lebens der Königin lebensfähig.
Die Königin mag das Geschlecht ihrer Nachkommen zu bestimmen. Wenn ein Ei vom Eierstock in den Eileiter gelangt, kann es mit Spermien aus der Spermatheka befruchtet werden - oder auch nicht. Aus einem befruchteten Ei entwickelt sich eine weibliche Honigbiene, entweder eine Arbeiterin oder eine Königin, aus einem unbefruchteten eine Drohne. Diesen Entscheid fällt sie je nachdem an was es im Stock gerade so mangelt.
4. Das Ausschwärmen
Jedes Jahr im Mai oder Juni, dann also, wenn sich die Nachkommenschaft mächtig vermehrt, wenn aufgrund des Platzmangels für neue Larven keine Brutzellen mehr gebaut werden können und die Lagermöglichkeiten für Nektar Hausarbeiten.de - Die Sprache der Bienen und Pollen erschöpft sind, bereiten sich die Bienen auf eine Volksteilung vor.
Dies geht nicht von heute auf morgen vor sich, sondern wird in allen Einzelheiten sorgsam vorbereitet, nichts bleibt dem Zufall überlassen.
Zunächst gilt es, eine neue Königin aufzuziehen. Da dies 21 Tage dauert, muss die Entscheidung über die Teilung des Volkes schon drei Wochen vorher gefallen sein. Auslöser ist die Feststellung, dass es im Stock zu eng wird. Dann legen die Baubbienen am Wabenrand so genannte ,,Weiselzellen" an, in denen die Brutammen aus einem befruchteten Ei nun eine Königin zur Reife bringen.
Sobald die jung Königin geschlüpft ist, verlässt die alte Stockmutter innerhalb weniger Tage das Heim und schwärmt mit der Hälfte der Bienengemeinschaft aus. um eine neue Niststätte zu gründen. über den neuen Platz, in welcher Richtung und Entfernung er liegt und sogar über dessen Qualität informieren die Spurenbienen ihre Stockgenossinnen mit einem Schwänzeltanz; mit der gleichen Methode also, wie wir sie schon aus dem Abschnitt über die Nahrungsbeschaffung kennen.
Aber eine Frage drängt sich nahezu auf: Wie können sich die Bienen eines Schwarms so gut abstimmen? Und wer entscheidet, welcher der beste ist?
Es informieren ja mehrere Bienen über verschiedene Nistplätze mit separaten Schwänzeltänzen. Sie werden aber nicht alle gleich aus geführt, sie unterscheiden sich in Lebhaftigkeit und Dauer. Je besser die Niststelle ist, desto lebhafter und ausdauernder wird getanzt- Dies gleicht den Elementen der Tänze, der Sammelbienen, wenn sie über die Qualität und Ergiebigkeit einer neuen Trachtquelle berichten.
Die lebhaftesten Tänze der Spurenbienen lassen andere Bienen nicht unberührt - Im Gegenteil, sie wecken deren Neugier, selbst den neuen Platz zu untersuchen. Haben sie dies getan und sind der gleichen Meinung, werben sie ebenfalls durch Tänze für den neuen Wohnsitz.
Nach und nach merken jetzt auch jene Spurenbienen, die bisher für einen anderen Platz geworben haben, dass eine immer größere Zahl von Genossinnen für einen bestimmten anderen Platz tanzt, und sie beginnen sich dafür zu interessieren, fliegen ebenfalls hin und vergleichen dessen Qualität mit der ihres Platzes. Am Ende werden auch sie dann für den besseren werben und so wird am Schluss der beste Nistplatz ausgewählt.
5. Unsere Meinung und unsere Eindrücke zu dieser Arbeit
Wir hatten einige Anfangsschwierigkeiten als wir beim Imker eintrafen, da wir nicht genau wussten, was Sie von uns erwarteten und der Imker nicht genau wusste was er uns erzählen sollte. Als wir in dann aufforderten einfach einmal mit etwas anzufangen, kam die Sache ins Rollen. Wir sind jetzt voll und ganz über den ,,Beruf" Imker, über die Bienen und ihr Umfeld informiert. Wir wissen wie Honig hergestellt wird, wir wissen wie sich eine Biene, im Laufe ihres kurzen Lebens, entwickeln, wir wissen welche Aufgaben ein Imker hat. Kurz gesagt, wir wissen alles was mit Bienen zu tun hat. Wir führten diese Gespräch nicht nur Oberflächlich, so nach der Art dass er uns nonstop Signale liefert und wir sie einfach teilnahmslos aufnehmen, sondern wir führten es in einem eher freundschaftlichen Rahmen. Wir haben einen angenehmen Nachmittag mit Albert Koch verbracht.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über Bienen?
Diese Arbeit befasst sich mit dem Leben der Bienen, ihrer Arbeitsaufteilung, der Art und Weise, wie sie Nahrung beschaffen, ihrer Paarung und dem Ausschwärmen. Sie bietet einen umfassenden Einblick in die Welt der Bienen, basierend auf einem Gespräch mit Albert Koch, dem Präsidenten des Schweizerischen Imkerverbandes.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Hauptteile: Vorgeschichte, die Arbeitsaufteilung der Biene, der Tanz und die Nahrungsbeschaffung, die Paarung der Bienen und das Ausschwärmen. Am Ende folgt eine persönliche Meinung und Eindrücke der Autoren.
Welche Aufgaben haben die einzelnen Bienen im Bienenstock?
Die Bienen haben unterschiedliche Aufgaben, darunter Baubienen, Brutammen, Reinigungsbienen, Wächterbienen und Sammelbienen. Jede Biene durchläuft im Laufe ihres Lebens fast alle diese Aufgaben, mit Ausnahme des Eierlegens, welches der Königin vorbehalten ist.
Wie kommunizieren Bienen über Futterquellen?
Bienen kommunizieren über Futterquellen durch verschiedene Tänze, darunter der Rundtanz und der Schwänzeltanz. Der Rundtanz deutet auf eine Futterquelle in unmittelbarer Nähe hin, während der Schwänzeltanz die Entfernung und Richtung einer weiter entfernten Quelle angibt.
Wie paaren sich Bienen?
Die Drohnen treffen sich an einem Sammelplatz, wo sie Pheromone absondern, um die Königin anzulocken. Die Königin paart sich mit mehreren Drohnen, wobei die Drohne während der Paarung stirbt. Die Königin kann bestimmen, ob ein Ei befruchtet wird oder nicht, was das Geschlecht der Nachkommen bestimmt.
Was ist das Ausschwärmen und warum geschieht es?
Das Ausschwärmen ist die Teilung des Bienenvolkes, die in der Regel im Mai oder Juni stattfindet, wenn der Platz im Bienenstock knapp wird. Die alte Königin verlässt den Stock mit einem Teil der Bienen, um eine neue Kolonie zu gründen.
Wie wählen Bienen einen neuen Nistplatz beim Ausschwärmen?
Spurbienen suchen nach geeigneten Nistplätzen und informieren ihre Stockgenossinnen durch Schwänzeltänze. Die Lebhaftigkeit und Dauer des Tanzes spiegeln die Qualität des Nistplatzes wider. Die Bienen wählen den besten Nistplatz durch einen Prozess des Vergleichens und Abstimmen.
- Arbeit zitieren
- Tobias Krieger (Autor:in), 1997, Die Sprache der Bienen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/100822