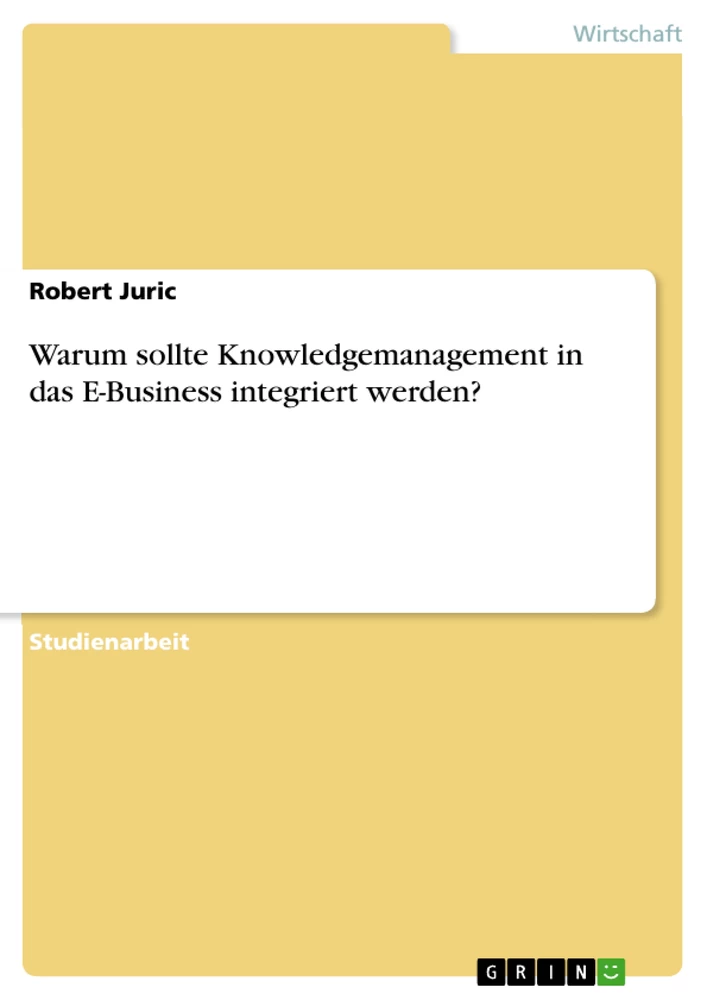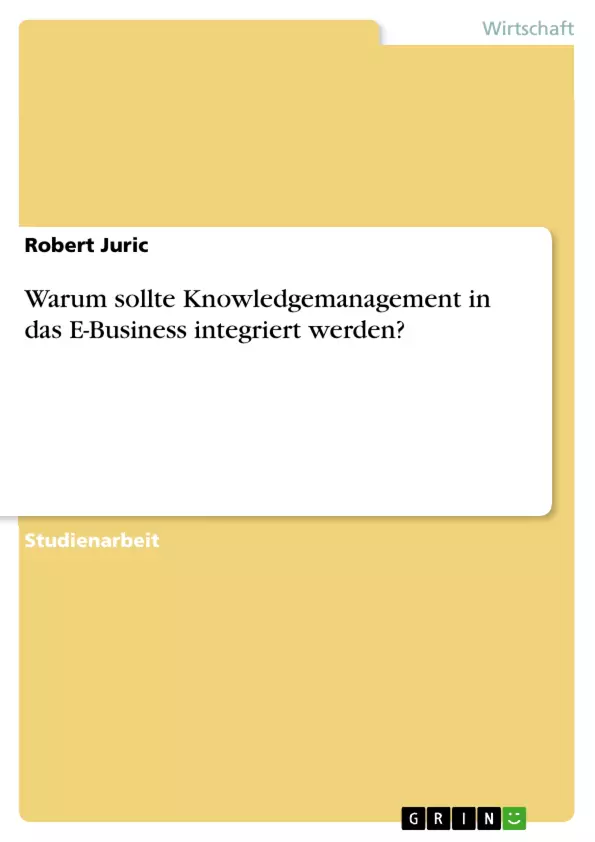Inhaltsverzeichnis
1. These:
Warum sollte Knowledgemanagement in das E-Business integriert werden?
1.1. Einführung in Managementsysteme
2. Knowledgemanagement:
2.1. Was ist Knowledgemanagement (KM)
2.2. Dimensionen des KM
2.3. Das Konzept der Bausteine
2.4. Wissensziele
2.5. Wissensidentifikation
2.6. Wissenserwerb
2.7. Wissensentwicklung
2.8. Wissensverteilung
2.9. Wissensbewahrung
2.10. Wissensnutzung
2.11. Wissensbewertung
3. E-Business:
3.1. Was ist E-Business
3.2. Voraussetzungen um erfolgreich E-Business zu betreiben
3.3. Potentiale des Internets
3.4. Probleme einer Organisation
4. E-Business mit KM optimieren:
4.1. Beschleunigung der Produktentwicklung und -einführung
4.2. Kundenloyalität
4.3. Aufkäufe und Zusammenschlüße
4.4. Supply Chain Management
4.5. Patentmanagement
4.6. Skillsicherung
5. Fazit:
5.1. Warum KM für E-Business?
A) Quellen
Lieber Leser,
dieses Referat entsteht im Rahmen der Vorlesung “Management von virtuellen Unternehmen”, gehalten von Professor Doktor Christoph Zydorek.
Dabei gilt ein Brückenschlag zwischen der Vorlesung und dem ausgesuchtem Thema herzustellen. Besonderer Wert wird auf den Aspekt des “wissenschaftlichen Arbeitens” gelegt. Es ist meine erste wissenschaftliche Ausarbeitung, mit dem Ziel, die wissen- schaftliche Herangehensweise zu adaptieren und für künftige Arbeiten nutzbar zu machen.
Diese Arbeit erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, oder das Beleuchten des Themas aus allen Blickwinkeln. Vielmehr möchte dieses Referat dem Leser das Potential des Knowledgemanagements näher bringen, und zum weiteren Studium ermutigen.
Die Entscheidung der These fiel vor geraumer Zeit, beim Lesen des Buches “e-business” von Rost und Schulz-Wolfgramm, herausgegeben von der IBM Unternehmensberatung GmbH (F.A.Z. Institut).
Genug des Vorwortes. Danke! - an alle, insbesondere an Sie, den Leser. Viel Spaß beim Schmökern
Robert Juric
1. These:
Warum sollte Knowledgemanagement in das E-Business integriert werden?
1.1. Einführung in Managementsysteme
Dieses Ausarbeitung möchte nicht über E-Business oder KM im allgemeinen referieren. Es möchte nicht Voraussetzungen oder Auswirkungen dieser beiden Themen zum Inhalt haben. Es möchte nur einen Einblick in die möglichen Zusammenhänge und Wechsel- wirkungen vermittlen.
Bis heute haben sich in der jungen Wissenschaft des Wissensmanagement zwei Schulen gebildet. Der Japaner Nonaka ist der Begründer der einen, der Schweizer Probst der Begründer der anderen Schule. Das Referat behandelt vorwiegend das in Europa bedeutendere Vorgehensmodell des Herrn Probst.
Nun möchte ich einige Managementsysteme vorstellen, mit denen der KM-interessierte Leser durchaus in Berührung kommen könnte.
Dokumentenmanagement
Dokumentenmanagementsysteme (DMS) sind Anwendungen zur strukturierten Erzeugung, Ablage, Verwaltung und Übertragung von elektronischen Dokumenten in Büroumgebungen. Es geht dabei um die Bearbeitung von Informationen, und nicht wie in der Produktion um die Manipulation von physischen Objekten.
Unter elektronischen DMS kann dabei einerseits die elektronische Verarbeitung von ursprünglich papiergebundenen Dokumenten verstanden werden, andererseits aber auch die Verarbeitung von rein elektronischen Dokumenten.
Typische Dokumente in einer Büroumgebung sind z. B. Rechnungen, Lieferscheine, Belege, technische Zeichnungen.
Durch ein strukturiertes DMS werden u.a. folgende Managementfunktionen unterstützt:
- Zugangskontrollen (Welche Rechte haben die Anwender?)
- Status Reporting (Wer hat momentan ein bestimmtes Dokument?)
- Versionskontrolle (Welche Version ist die aktuelle?)
- Speichermanagement (Welche rechtlichen Anforderungen existieren? Welche Unternehmensvorschriften gibt es?)
DMS unterstützen den Anwender bei diversen Bürotätigkeiten, z. B. bei der Dokumentation, der Archivierung von elektronischen Dokumenten, der Kommunikation (durch integrierte E-Mail-Systeme) oder der gezielten Suche nach bestimmten Dokumenten.
Eine Besonderheit im Vergleich zur papierbasierten Arbeitsweise ist die Tatsache, dass zeitgleich auf Dokumente zugegriffen werden kann. Dabei erhält der erste Benutzer, der ein Dokument öffnet, die exklusiven Änderungsrechte. Alle weiteren Mitarbeiter werden beim Zugriff darauf hingewiesen, dass das Dokument sich bereits in Bearbeitung be- findet und nicht geändert werden kann.
Sobald die Änderungen gespeichert werden, ist die aktualisierte Version des Dokuments weltweit verfügbar.
Besondere Bedeutung haben DMS in Workflow-Management-Systemen (WMS bzw. Vorgangsmanagementsystemen). Meist sind DMS deren Grundlage, d. h. das WMS erledigt die Steuerung der zum Geschäftsprozess zugehörigen Dokumente auf der Basis des DMS.
Work-Flow Management
WMS ermöglichen die computergestützte Bearbeitung von Geschäftsprozessen, indem sie Informationsobjekte wie z. B. Dokumente, Informationen oder Aufgaben von einem Beteiligten zum nächsten zur Bearbeitung weitergeben. Die Bearbeitung unterliegt dabei vorher in der Modellierungsphase festgelegten Vorschriften.
Ein WMS definiert, erzeugt und steuert Geschäftsprozesse.
Die Grundidee:
Informationsobjekte werden durch die an einem Geschäftsprozess (z. B. Auftrags- abwicklung) beteiligten betrieblichen Instanzen geleitet und schrittweise angereichert. Dies geschieht dadurch, dass das WMS für jede Aktivität eines Prozesses die geeigneten Bearbeiter aus der Organisationsdatenbank auswählt und sie bei der Abwicklung unter- stützt, z. B. indem es die notwendigen Anwendungssysteme selektiert. Endprodukte dieser Ablaufsteuerung sind dann ein oder mehrere Informationsobjekte, z. B. das aus- gefüllte Auftragsformular und die zugehörige Rechnung.
Es existieren prinzipiell zwei Typen von WMS:
1) Das WMS basiert auf einem Dokumenten-Management-System (DMS). Es leitet dem zuständigen Bearbeiter die relevanten Dokumente direkt in seinen elektronischen Eingangspostkorb.
Der wohl größte Vorteil dieser Variante ist die Verknüpfung der zu einem Geschäftsprozess zugehörigen Dokumente mit dem aktuellen Vorgang. Dadurch hat der Mitarbeiter jederzeit alle relevanten Informationen zu dem Workflow im sofortigen Zugriff.
2) Dem WMS liegt kein DMS zugrunde. Es werden somit keine elektronischen Dokumente durch das WMS weitergeleitet, sondern lediglich die Geschäftsprozesse von einer Organisationseinheit zur nächsten weitergeleitet und gesteuert.
Bei diesem Systemtyp wird dem Mitarbeiter durch das WMS mitgeteilt, welche Aktivitäten als nächstes erforderlich sind, die zur Erledigung notwendigen Dokumente werden aber nicht mitgeliefert.
Fortschrittliche WMS liefern dem Sachbearbeiter zusätzlich Informationen über die aus- zuführenden Vorgänge wie z. B. Besonderheiten, bisher aufgetretene Probleme, Lösungsansätze usw. Das WMS wird damit zum Träger von Wissen über die Geschäftsprozesse und stellt einen Ansatz zum Wissensmanagement dar.
Eine Kombination von Workflow mit den Mitteln des Internet erlaubt es, auch externe Mitarbeiter, Zweigstellen oder sogar Lieferanten und Abnehmer in die Geschäftsprozesse einzubeziehen.
Supply Chain Management
Supply Chain Management (SCM) bezeichnet Systeme, die die Koordination von Geschäftsabläufen, Lieferanten und Kunden zum Zweck der Effektivitätssteigerung opti- mieren. Zielsetzung sind integrierte Lösungen mit dem umfassenden und aktuellen Abbild des Kunden für alle Unternehmensbereiche.
Der Fluß von Daten, Material und Geld soll von den Lieferanten über die Produktion und den Handel bis hin zum Endverbraucher optimal gesteuert werden. Dafür werden alle intern und extern Beteiligten miteinander verbunden und tauschen in Echtzeit die notwendigen Informationen aus. Wird die Lieferkette gestört (beispielsweise durch einen Maschinenausfall beim Zulieferer), wird dieses in beiden Richtungen weitergemeldet. Die Betroffenen können eine Alternativplanung anstoßen, um die Folgen der Störung etwa durch das Einschalten eines neuen Produzenten zu umgehen.
Informationsmanagement
Aufgabe des Informationsmanagements ist es, durch den Einsatz moderner IuK- Technologien dafür zu sorgen, dass Informationen zwischen Personen und Organisation zielgerichtet und wirtschaftlich eingesetzt werden.
Die Grundfragen bei der Gestaltung und Entwicklung von Informationsmanagement sind folgende:
- Informationsbedarfsbestimmung (Welche Informationen werden benötigt?)
- Produktion und Distribution von Informationsgütern (Wie und in welcher Qualität sollen Informationsprodukte hergestellt und Informationsdienste angeboten werden? Auf welchen Kanälen soll wer welche Informationsprodukte und Informationsdienste erhalten?)
- Nutzung und Verwertung der zur Verfügung stehenden Informationen in Geschäftsprozessen (Wie kann eine Informationssensibilität gefördert, vorhandene Informationsbarrieren abgebaut, die Verwertung optimiert werden?)
- Organisation des gesamten Prozesses der Informationsversorgung (Wie kann die Erreichung der Organisationsziele durch professionelle Informationsarbeit optimiert werden?)
Das Ziel der Gestaltung des Informationsmanagement ist
- die richtige Information,
- im richtigen Umfang,
- in der richtigen Qualität,
- zur richtigen Zeit,
- mit möglichst geringem Aufwand,
- bei der richtigen Person anzubieten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments über "Knowledgemanagement im E-Business"?
Das Dokument konzentriert sich auf die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Knowledgemanagement (KM) und E-Business, und nicht auf allgemeine Darstellungen dieser beiden Themen.
Welche Managementsysteme werden im Zusammenhang mit Knowledgemanagement vorgestellt?
Es werden verschiedene Managementsysteme vorgestellt, darunter Dokumentenmanagement (DMS), Workflow Management (WMS), Supply Chain Management (SCM) und Informationsmanagement.
Was sind die Hauptfunktionen eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)?
Ein DMS unterstützt Funktionen wie Zugangskontrollen, Status Reporting, Versionskontrolle und Speichermanagement zur strukturierten Bearbeitung von elektronischen Dokumenten.
Wie funktioniert ein Workflow Management System (WMS)?
Ein WMS ermöglicht die computergestützte Bearbeitung von Geschäftsprozessen, indem es Informationsobjekte zwischen Beteiligten weitergibt und dabei vorher festgelegte Vorschriften berücksichtigt.
Welche Arten von WMS gibt es?
Es gibt WMS, die auf einem Dokumenten-Management-System (DMS) basieren und solche, die ohne DMS arbeiten. Erstere leiten Dokumente weiter, während letztere lediglich Geschäftsprozesse steuern.
Was ist das Ziel von Supply Chain Management (SCM)?
SCM zielt auf die Optimierung der Koordination von Geschäftsabläufen, Lieferanten und Kunden ab, um die Effektivität zu steigern. Der Fluss von Daten, Material und Geld soll optimal gesteuert werden.
Was sind die Grundfragen im Informationsmanagement?
Die zentralen Fragen sind: Informationsbedarfsbestimmung, Produktion und Distribution von Informationsgütern, Nutzung und Verwertung von Informationen in Geschäftsprozessen sowie die Organisation des gesamten Prozesses der Informationsversorgung.
Was ist das Ziel des Informationsmanagements?
Das Ziel ist, die richtige Information im richtigen Umfang, in der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit und mit möglichst geringem Aufwand der richtigen Person anzubieten.
Welche Schulen des Wissensmanagements werden erwähnt?
Es werden die Schule des Japaners Nonaka und die des Schweizers Probst erwähnt, wobei das Modell von Probst in Europa eine größere Bedeutung hat.
Was sind die Hauptthemen, die im Inhaltsverzeichnis aufgeführt sind?
Die Hauptthemen umfassen die Integration von Knowledgemanagement in E-Business, Definitionen und Dimensionen von Knowledgemanagement, E-Business Grundlagen sowie die Optimierung von E-Business durch KM in Bereichen wie Produktentwicklung, Kundenloyalität, Supply Chain Management, Patentmanagement und Skillsicherung.
- Arbeit zitieren
- Robert Juric (Autor:in), 2001, Warum sollte Knowledgemanagement in das E-Business integriert werden?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/100575