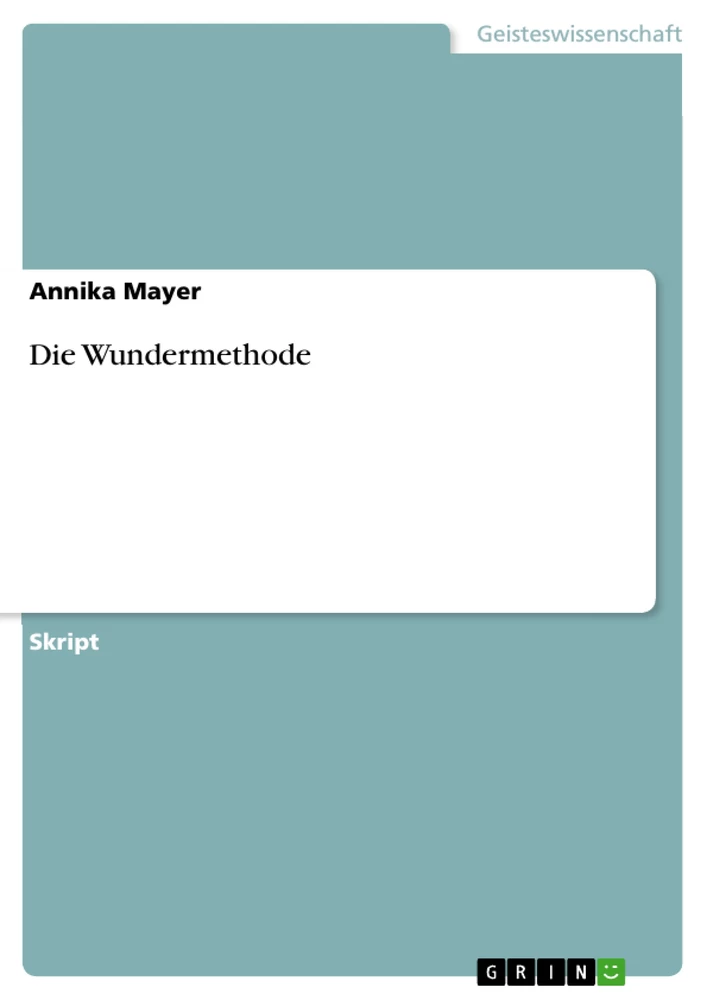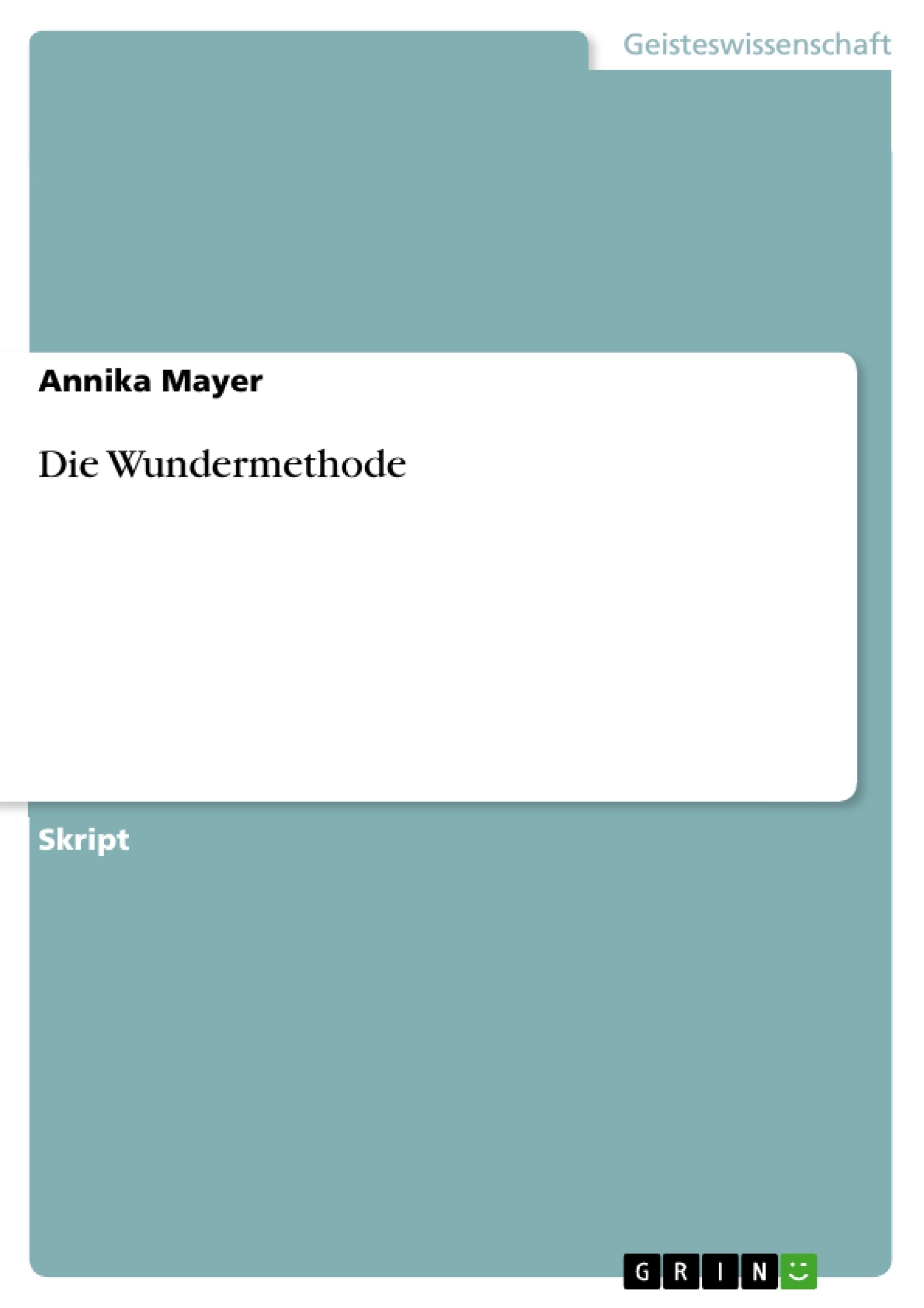Die Wundermethode
Einleitung
1. Der Zusammenhang zwischen Drogenpolitik und Suchtbehandlung
Jahrzehntelang wurde im Suchtbereich, was sowohl den Alkoholiker als auch den von illegalen Drogen Abhängigen betraf, eine repressive Politik ausgeübt. Als Suchtmittel- konsument bekam man von Hause aus den Stempel “kriminell” aufgedrückt. Das Be- strafungsprinzip stand an oberster Stelle, oft in Form von Haftunterbringungen. Nur we- nige kamen in den “Genuß’” einer therapeutischen Behandlung, zumal diese erst im Laufe der Jahrzehnte entstanden. Dem politischen Prinzip der Bestrafung und Verfol- gung entsprechend, waren denn auch die therapeutischen Konzepte. Man arbeitete (und manche Einrichtungen auch heute noch) ebenfalls mit dem Prinzip der Bestrafung, Sanktionen bei Regelverstößen, Kontaktsperren zu Familie und Freunden. Manche Be- handlungsmethoden hatten einen regelrechten “Holzhammer-Charakter”. Der Mensch hatte sich den vorgegebenen Regeln anzupassen, ansonsten wurde ihm Therapieunwil- ligkeit und Widerstand vorgeworfen. Therapie wurde daher von vielen nicht als Chance gesehen.
Hier hat sich nun ein Wandel vollzogen.
Im Februar 1987 beim Freiburger Drogen-Symposium, an dem rund 4o Drogenexper- ten aus dem gesamten Bundesgebiet teilnahmen, erkannte man, daß die Politik der 8o- er Jahre für das nächste Jahrzehnt nicht mehr anwendbar ist. “Schon die Vergangenheit hat außerdem gezeigt, daß sich der Drogenkonsum mit Strafverfolgung nicht eindäm- men läßt und mit der Kriminalisierung junger Menschen mehr Schaden als Nutzen ange- richtet wird Die Folgerung: Für die neunziger Jahre sind eine neue Drogenpolitik, ein anderes Drogenrecht und eine veränderte Drogenhilfe notwendig”.1 Gesellschaftlich wurde ein Anwachsen der Zwei-Drittel-Gesellschaft prognostiziert, in der hochtechnisier- ten Dienstleistungsgesellschaft werde der Konsum die herrschende Ideologie bestim- men. Außerdem erwarte man eine Ausweitung des Drogengebrauchs bei Jugendlichen sowie eine größere Verfügbarkeit der Drogen. Als Ergebnis für das nächste Jahrzehnt wurde festgehalten: “Die Drogenprävention der neunziger Jahre wird sich, da die Stra- tegien der Kontrolle, Verfolgung und Bestrafung gescheitert sind, auf aktive psychosozi- ale und gesellschaftspolitische Konzepte stützen müssen”.2 Kurz: Weg vom Leidensdru- ckes, weg vom Bestrafungsprinzip.
Rückblickend ist dies geschehen. Verbundsysteme, niedrigschwellige Angebote, Methadonsubstitution, Vielfalt der Angebote, akzeptierende Drogenarbeit, Schadensbegrenzung wären die Stichworte für die 9o-er Jahre.
Für das neue Jahrzehnt wird mittlerweile sogar die Originalstoffvergabe Heroin disku- tiert. Im Alkoholbereich gibt es ebenfalls einen neuen umstrittenen Ansatz, dem des kon- trollierten Trinkens von Prof. Dr. Joachim Körkel, Dipl.-Psychologe und Leiter der Evan- gelischen Fachhochschule für Sozialwesen in Nürnberg.3 Eine bis dato unglaubliche Vorstellung: Junkies, die ihren Stoff vom Arzt beziehen und Alkoholiker, die kontrolliert Trinkend am Tresen stehen?! Macht sich hier etwa Resignation vor dem Phänomen Sucht breit oder fehlt es nur an neuen Konzepten? Die Wahrheit liegt wohl dazwischen: Zum einen die Erkenntnis, daß die alten Methoden alleine nicht ausreichen und (endlich) die Bereitschaft, auch andere neue und ungewöhnliche Wege einzuschlagen.
1.1. Zieldefinition der Suchtbehandlung am Beispiel Hamburg
“Ziel der Suchtbehandlung ist die (sozial-) medizinische Rehabilitation des Abhängig- keitskranken, d.h. seine gesundheitliche Stabilisierung bzw. Heilung sowie seine soziale und berufliche Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Dies ist im allgemeinen mit der dauerhaften Beendigung des Suchtmittelkonsums (der Abstinenz) verbunden, aber es sind auch Fälle denkbar, in denen eine erfolgreiche Rehabilitation erreicht wird, ohne daß der Suchtkranke seinen Konsum völlig aufgibt, sondern vielmehr fähig wird, ihn zu kontrollieren und zu mäßigen. Abstinenz ist mithin ein in den meisten Fällen zwar not- wendiges, aber für sich allein genommen nicht hinreichendes Ziel der Behandlung. Vielmehr steht ebenso sehr die Wiederherstellung der beruflichen und sozialen Funkti- onsfähigkeit im Vordergrund. Grundsätzlich gilt es sicherzustellen, daß jeder Abhängig- keitskranke die ihm entsprechenden bestmöglichen Leistungen erhält...”.4
1.2. Im Vergleich: Traditionelle Methoden und die neue “ Wunder- Methode ”
Viele ambulante und stationäre Einrichtungen im Suchtbereich arbeiten auch heute noch mit Methoden, die sich als nicht unbedingt erfolgreich erwiesen haben. So wird bei- spielsweise propagiert, daß ein Alkoholabhängiger nie wieder trinken darf, Drogenab- hängige keinen Alkohol trinken dürfen bzw. Haschisch rauchen. Es wird von einem le- benslangen “Clean-Anspruch” gesprochen. Die meisten Einrichtungen sind auch so konzipiert, daß man nach einem Rückfall das Haus verlassen muß und damit die Thera- pie abbricht. Bis dahin verbuchte Erfolge werden somit zunichte gemacht. Besonders dramatisch wirkt sich dieser Umstand in sogenannten Nachsorge-Projekten aus: Durch den Anspruch “Keine Drogen, kein Alkohol” verliert man sogar seine Wohnung und - falls man in einem dieser Projekte auch arbeitet - seinen Job. Ein einziger Rückfall stellt somit das gesamte bis dahin Erreichte in Frage. Zeigt man sich dann entsprechend reuig und geläutert, besteht eventuell die Möglichkeit der Wiederaufnahme. Die Person fühlt sich wie ein Versager, sie hat es wieder nicht geschafft, dauerhaft abstinent zu bleiben. In -zig Gesprächen wird versucht herauszufinden, was Auslöser für den Rückfall war.
Eine der ersten Einrichtungen aus den 6o-er Jahren ist Synanon, eine Selbsthilfegruppe, die sich in den USA gründete sowie die Anonymen Alkoholiker. Sie stellten ein Regelwerk auf, an dem sie sich lebenslang zu orientieren hatten. Die psychologische Aufarbeitung spielt hier weniger eine Rolle; man könnte die Arbeit methodisch als Verhaltenstherapie beschreiben.
Viele Einrichtungen arbeiten psycho-analytisch. Der Schwerpunkt wird auf Ereignisse in der Kindheit gelegt (Mißbrauch, Alkoholiker-Familien, Heimaufenthalte). Auch wenn die Psychoanalyse nach Freud aufgrund ihrer zu langen Behandlungsdauer (3-4 Jahre) sta- tionär nicht angewandt wird, sind doch Elemente von ihr vorhanden. Einrichtungen wie “Daytop” formulierten in den 8o-er Jahren ihr Konzept wie folgt: “... durch Aufbrechen alter Strukturen und Aufbau einer neuen Persönlichkeit...”, was in der Praxis nichts ande- res hieß, als den Menschen völlig niedermachen, bis er am Boden zerstört war (alles andere wurde als Widerstand gewertet), um ihn dann im Sinne des therapeutischen Konzeptes wieder zurechtzuformen. Eine fürchterliche Vorstellung, die für mich schon an Gehirnwäsche grenzt!
Da man im Laufe der Jahrzehnte bemerkte, daß es nicht DIE EINE WAHRE METHODE gibt, bot man verschiedene therapeutische Verfahren an. So ist es durchaus üblich, daß Kombinationen aus verhaltenstherapeutischen Verfahren, klientenzentrierter Ge- sprächspsychotherapie, Gestalttherapie, Psychodrama, körperorientierte Verfahren, Neurolinguistisches Programmieren, Bewegungstherapie sowie Kunst- und Musikthe- rapie praktiziert werden. Auch die systemische Familientherapie und ressourcenorien- tierte Kurztherapie nach De Shazer nehmen langsam Einzug in die Einrichtungen, nicht zuletzt aufgrund ihrer verkürzten Behandlungszeiten, die diese Behandlungsmethoden für die Kostenträger attraktiv machen.
Bei dieser Fülle von Angeboten stellt sich natürlich die Frage, warum jetzt noch eine weitere Methode, sogar eine “Wunder-Methode”, nötig ist, und was sie von den anderen unterscheidet.
2. Der lösungsorientierte Ansatz
Der lösungsorienterte Ansatz geht davon aus, daß der Klient in der Lage ist, selbst Lö- sungsstrategien zu entwickeln. Die hilfesuchende Person weiß bzw. ahnt, was sie braucht (und wenn es erst einmal nur Rat und Hilfe ist). Sie ist eine gleichwertige Person und der Therapeut wird zum Dienstleister. Man arbeitet gemeinsam an dem Problem und berücksichtigt dabei die Fähigkeiten des Klienten. Früher hat man Personen, die nicht entsprechend am therapeutischen Prozeß teilgenommen haben, vorgeworfen, sie wollten nicht wirklich abstinent werden und leisteten Widerstand. Die “Wunder-Methode” dreht den Spieß um:
“Der wichtige Punkt ist einfach der, daß Sie nicht dem Programm folgen, das wir gefun- den haben, sondern daß Sie ein Programm finden, dem Sie folgen können” (S. 24).
Traditionelle Berater arbeiten mit dem Fokus auf “Krankheit”, sie sind konditioniert auf die Suche nach Problemen, regelrecht problem-orientiert. Man spricht hier von den drei D´s: “Disease, denial, dysfunktion” (Krankheit, Verleugnung, Dysfunktion). Der lösungsorientierte Ansatz geht mit einer völlig anderen Sicht an die Sache heran.
2.1. Die acht Prinzipien
1. Kein Ansatz paßt für alle
Die 12 Schritte der AA´s, die leicht abgewandelt in fast jeder traditionellen Behandlung enthalten sind, haben schon den Charakter der 1o Gebote aus der Bibel. Sie sind verbindlich für alle Süchtigen. Das Menschenbild ist, daß alle Süchtigen gleich sind. Kurz: Man wirft sie alle in einen Topf und meint, mit einer Kochzeit werden alle gar.
Der lösungsorientierte Ansatz dreht den Spieß um:
“Jeder Mensch, der ein Alkoholproblem erlebt, ist anders... Anders gesagt, die Behand- lung sollte so zugeschnitten sein, daß sie zu der jeweiligen Person paßt, statt daß sie von der jeweiligen Person verlangt, zur Behandlung zu passen... Im Gegensatz zum ei- ne-Größe-paßt-allen-Ansatz traditioneller Alkoholbehandlung hilft lösungsorientierte The- rapie mit ihrem präzisen und geschliffenen Fokus auf dem, was funktioniert, der Klient/In, ihre eigenen, persönlichen Heilungspläne zu erkennen und dann zu implemen- tieren” (S. 3o).
2. Es gibt mehr als eine mögliche Lösung
Jemand hat kalte Füße. Der Ansatz (s.o.) wäre nun zu untersuchen, ob er Strümpfe oder Schuhe braucht. Hat man dies geklärt und festgestellt, die Person braucht Schuhe, wäre der nächste Schritt, welche zu kaufen. Die Lösung wäre also ein Schuhkauf. Nun stellt man im Laden fest, daß es zwar Schuhe gibt, aber alle nur in Größe 45. Hunderte von Schuhen in Größe 45, bei einer eigenen Größe von 39. Jetzt könnte man natürlich rum- experimentieren mit 3 Paar Strümpfen und Einlegesohlen etc., bis die Schuhe endlich passen. Aber sind wir mit dieser “Lösung” zufrieden? Ich denke nein. Es wäre ein Kom- promiss, aber keine wirkliche Lösung.
Was gebraucht wird sind also LÖSUNGEN, und nicht nur eine einzige. Und das Schritt für Schritt.
“Der lösungsorientierte Ansatz - mit seinem Schwerpunkt darauf, eine Lösung zu finden, die für den Einzelnen funktioniert - hilft KlientInnen, eine Vielzahl möglicher Lösungen zu erkunden” (S. 31).
Vom gesunden Menschenverstand her wäre es eigentlich klar - man sucht sich ein Geschäft, in dem man die passenden Schuhe findet.
3. Lösung und Problem sind nicht notwendigerweise miteinander verbunden
Irgendwie hat man im Kopf, daß die Lösung des Problems mit dem Problem in direktem Zusammenhang stehen muß. D.h. wenn jemand Probleme mit dem Trinken hat, muß er sich mit Trinken beschäftigen. Vor lauter Konzentration auf das Nicht-Trinken liegt das Trinken ja fast schon wieder nahe. Die “Wunder-Methode” sieht das anders: Das Prob- lem muß mit der Lösung nicht in Beziehung stehen. Es reicht aus, einfach etwas ande- res als bisher zu tun, einem Hobby nachgehen, sich mehr der Familie widmen etc.. “Der wichtige Punkt ist nicht die spezifische Lösung, sondern überhaupt eine Lösung - wie weit diese auch immer vom Problem entfernt sein mag -, die für die einzelne Person funktioniert... Anders gesagt, Menschen begrenzen ihre Suche nach möglichen Lösun- gen leider auf solche Lösungen, die angesichts des Problems, das sie zu lösen suchen, Sinn machen” (S. 33).
4. Der einfachste und am wenigsten einschneidende Ansatz ist oft die beste Medizin
“Therapie muß zecken” ist eine typische Aussage in traditionellen Behandlungsmethoden. Man muß erst sein Innerstes umkrempeln, regelrecht durch die Hölle gehen, um dann ein neuer geheilter Mensch zu sein. Nur wenn man alle Abgründe in sich entdeckt hat und sämtliche Kindheitsdefizite aufgearbeitet sind, besteht angeblich eine Chance, da man sonst von alten unverarbeiteten Erlebnissen wieder eingeholt wird. Symptombildung nennt man das in der Psychologie. “Nicht den Weg des geringsten Widerstandes gehen”. “Da, wo die Angst ist, muß man hin”.
Auch hier hat die “Wunder-Methode” eine völlig andere Sichtweise. Der lösungsorientierte Ansatz arbeitet mit einfachen, direkten, flexiblen und individuellen Programmen. Jede kleine schmutzige Lösung, die funktioniert, wird genommen (S. 36). Die Hauptsache ist, DASS sie funktioniert.
5. Menschen können in kurzer Zeit Besserungen erreichen und schaffen es auch
Man ging davon aus, daß Schwere oder Chronizität des Trinkproblems die Behand- lungsdauer beeinflußt. Das hat sich nicht bewährt. Personen in einer Langzeitbehand- lung wurden nicht besser geheilt. Man stellte auch fest, daß Personen mit Trinkproble- men durchaus schnell in der Lage waren, ihren Alkoholkonsum zu reduzieren. Die “Wunder-Methode” geht daher davon aus, daß Heilung schnell erreicht werden kann, aber harte Arbeit bedeutet.
6.Änderung geschieht ständig
“Stabilität ist eine Illusion. Um dies zu veranschaulichen, erzählen wir ... oft, daß das Le- ben eher einem Fluß als einem See gleicht. Anders gesagt, Menschen sind weit entfernt davon, einfach stabil und statisch zu sein, denn sie befinden sich in einem ständigen Fließen, wenn sie sich dem Lauf des Lebens anpassen und entsprechend ändern. Sehr oft hängt eine erfolgreiche Behandlung davon ab, diese natürlichen Veränderungen zu erkennen und den Menschen zu helfen, diese bewußt zu nutzen, um Änderungen zu er- reichen” (S. 37).
Erfolg hängt also davon ab, mit dem Strom zu schwimmen, anstatt ihn zu stauen.
7. Fokussiere auf Stärken und Ressourcen und nicht auf Schwächen und Defiziten
“Stärken und Ressourcen der Menschen sind traditionell aufgrund der verbreiteten An- nahme ignoriert worden, daß Probleme aus zugrundeliegenden Schwächen oder Defizi- ten resultieren. Diese Defizite, so erklären uns ExpertInnen, müssen thematisiert wer- den, wollen wir überhaupt hoffen, unsere Probleme jemals zu lösen. Deswegen haben TherapeutInnen eine nie endende Liste von Schwächen angeboten: gewährendes oder strenges Elternverhalten, rigide und nachgiebige Sauberkeitserziehung, fehlendes und übermäßiges Stillen” (S. 39).
Über allem stehen immer die Schwächen und Defizite, die offengelegt und akzeptiert werden müssen.
Die neue Methode geht davon aus, daß der Mensch sehr wohl in der Lage ist, seinen Konsum zu kontrollieren, wenn er nur will und wenn er daran glaubt, daß er es kann.
“Die Menschen, mit denen wir gearbeitet haben, zeigten eine breite Palette von Fertigkeiten und Ressourcen, die sie bei ihrem Alkoholproblem anwenden können. Diese Stärken sind ein besserer Führer zur Heilung als ihre Schwächen. Stärken entdecken und sie in ein persönliches Heilungsprogramm integrieren, ist eine Strategie, die bei Menschen mit Alkoholproblemen gut funktioniert” (S. 4o).
Und dazu abschließend noch eine gute Aussage:
“Leid kann uns auf den Weg bringen, aber Stärken und Ressourcen helfen uns, auf dem Weg zu bleiben und die Arbeit zu beenden” (S. 41).
8. Fokussiere auf die Zukunft und nicht auf die Vergangenheit
Die traditionellen Ansätze gehen davon aus, daß der Weg zur Heilung damit beginnt, das Tor zur Vergangenheit aufzuschließen. Wenn man die Schäden der Kindheit durch- forstet, findet man die Lösung für das gegenwärtige Problem. Regression ist eines der Stichwörter.
Die lösungsorientierte Arbeit fängt mit dem Ende an. D.h. man arbeitet heraus, wie die Behandlung enden wird. Man hilft den Personen, konkrete realistische Karten zu enwickeln, wo sie hinmöchten. Darum auch die Frage an die Klienten, wie sie wissen werden, wann sie mit der Behandlung fertig sind.
2.2. Die zwölf Schritte der Anonymen Alkoholikern
1. ) Wir haben zugegeben, daß wir Alkohol gegenüber5 machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten.
2. ) Wir kamen zu dem Glauben, daß eine Macht - größer als wir selbst - uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann.
3. ) Wir faßten den Entschluß, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes - wie wir ihn verstanden - anzuvertrauen.
4. ) Wir machten gewissenhaft und furchtlos Inventur in unserem Inneren.
5. ) Wir gestanden Gott, uns selbst und einem anderen Menschen die genaue Art unse- rer Verfehlungen ein.
6. ) Wir wurden vorbehaltlos bereit, unsere Charakterfehler von Gott beseitigen zu las- sen.
7. ) Demütig baten wir ihn, uns von unseren Mängeln zu befreien.
8. ) Wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Unrecht zugefügt hatten, und nahmen uns vor, es an ihnen wiedergutzumachen.
9. ) Wenn immer möglich, bemühten wir uns aufrichtig um direkte Wiedergutmachung an ihnen, ausgenommen, es würde ihnen oder anderen Schaden daraus entstehen.
10.) Wir fuhren fort, persönliche Inventur zu machen, und wenn wir unrecht hatten, gaben wir es sofort zu.
11.) Durch Gebet und Meditation suchten wir unseren bewußten Kontakt mit Gott - wie
wir ihn verstanden - zu verbessern. Wir baten ihn nur, uns seinen Willen für uns wissen zu lassen und uns die Kraft zu geben, den auszuführen.
12.) Nachdem wir durch diese Schritte ein inneres Erwachen erlebt hatten, versuchten wir, diese Botschaft an andere weiterzugeben - und uns in allen unseren Angelegen- heiten nach diesen Grundsätzen zu richten.
Die Tür zur Lösung
Die Tür zur Lösung zu finden, beginnt mit der Entscheidung: Ich will, daß mein Leben anders ist!
Die Tür zur Lösung wird geöffnet,mit der Betrachtung: wie stellen sie sich ihr Leben vor, wenn ihr Problem erst einmal gelöst ist.
Wunderfrage
Nehmen Sie einmal an, heut abend, nachdem Sie ins Bett gegangen und eingeschlafen snd, geschieht ein Wunder! Das Wunder besteht darin, daß das Problem oder die Probleme mit denen Sie kämpfen, gelöst sind! Da Sie aber schlafen, wissen Sie nicht, daß ein Wunder geschehen ist. Sie verschlafen einfach das Ganze. Wenn Sie dann morgen früh aufwachen, was wäre eine der ersten Sachen, die ih- nen auffallen würden, die anders wären und die Ihnen sagen würde, daß das Wunder geschehen und Ihr Problem gelöst ist?
Hinweis: Es ist nicht überraschend, wenn die Antwort nicht mit dem Problem zu tun hat. Denn schließlich geht die Frage davon aus, daß das Problem gelöst ist!
Die 6 Schlüssel
Die Antwort auf die Wunderfrage soll nun mit Hilfe der sechs Schlüssel prazisiert werden, damit die sich die Wahrscheinlichkeit, daß die gewünschte Lösung eintritt vergrößert.
Schlüssel 1
Stellen Sie sicher, daß ihr Wunder für Sie wichtig ist
Ist die Lösung eines Problemes für die Person wichtig, so ist diese auch eher bereit, dafür hart zu arbeiten. Es soll also heraugearbeitet werden, was für eine Person persönlich wichtig ist und wie dies erreicht werden kann.
Schlüssel 2
Halten Sie es klein
Es wird davon ausgegangen, daß die zu behandelnde Person erfolgreich sein will. Häu- fig werden zu hohe Maßstäbe angelegt, dies führt zu dem Gefühl des Versagens und zu Entmutigung.
Schlüssel 3
Machen Sie es spezifisch, konkret und verhaltensbezogen
Der Begriff Alkoholproblem ist sehr vage, es ist dadurch fast unmöglich festzustellen ob und wie Fort- schritte gemacht wurden. Es muß darauf geachtet werden, daß sämtliche Aussagen und Beschreibungen speztifisch und genau sind und nicht in das typische Psycho-Jargon (z.B. “lernen zu kommunizieren”, “die Ko-Abhängigkeit überwinden”) verfallen wird.
Schlüssel 4
Stellen Sie sicher, daß Sie sagen, was Sie tun werden, anstatt was sie nicht tun werden
Wenn sich darauf konzentriert wird, etwas nicht zu tun, ist es fast unmöglich festzustellen ob man darin erfolgreich ist. Wörter wie nein, niemlas, nicht tun, nicht wollen sollen umformuliert werden in etwas Positives oder in eine Aussage, was stattdessen getan wird (z.B. ja, wann oder dann, tun , können, würde, darf).
Schlüssel 5
Sagen Sie wie Sie ihre Reise beginnen werden, und nicht wie Sie sie beenden werden
Wer sich auf den ersten Schritt und dessen Lösung konzentriert, hat die Möglichkeit die Fortschritte auf dem Weg zu erkennen und kann außerdem die kleinen Änderungen hegen und pflegen,
Schlüssel 6
Seien Sie sich im klaren über das wer, wo und wann, aber nicht über das warum
Auf die Frage warum, kann stets eine weitere Frage nach dem warum folgen. Um eine Veränderung zu erreichten muß man jedoch nicht das warum kennen. Viel wichtiger sind dabei das “wer”, “wo” und “wann” der erwünschten Veränderung.
3.3 Drei Hinweise auf die Lösung
Die Hinweise sollen helfen die eigenen Fähigkeiten, Stärken und Lösungen zu erkennen und diese zum eigenen Vorteil nutzen zu können
Hinweis 1
Suche nach Teilen des Wunders, die jetzt schon geschehen
Es handelt sich hier um die Suche nach Ausnahmen. Dadurch werden bereits existierende Lösungen ins Bewußtsein gerückt. Muster der Ereignisse, in der das Wunder bereits geschehen ist, sollen aufgedeckt werden. Dabei besteht die Hoffnung, daß diese Muster verstärkt und die Auftretenswahrscheinlichkeit erhöht wird.
Hinweis 2
Lerne aus Fehlern, die du nicht machst
Hier geht es um das Suchen von Ausnahmezeiten. Zu berücksichtigen sind, Situationen, Zeiten, Personen und Orte die mit den Ausnahmezeiten im Zusammenhang stehen. Ziel ist es solche Zeiten wissentlich zu wiederholen.
Hinweis 3
Suche nach Änderungen vor der Behandlung
Bereits vor der Behandlung treten Veränderungen auf. Es gilt diese zu analysieren, da sie bereits einen Teil der angestrebten Lösung darstellen. Die Veränderungen vor der Behandlung können in den persönlichen Gesundheitsplan mit eingebaut werden.
3.4. Die Lösungsgleichungen
Sämtliche Ideen, Schlüssel und Hinweise sollen nun in eine Lösung-Gleichung umgewandelt werden. Die Informationen, die bisher herausgearbeitet wurde, werden so kombiniert, daß sie zur gewünschten Lösung zusammengefügt werden können.
Daraus entwickeln sich drei Lösungsformeln:
1.Lösungsformel
W(under)
+ A(usnahme)
+ Mache (mehr von dem was funktioniert)
= Lösung
Wenn Sie 1) wissen, was sie wollen, 2) Zeiträume beschreiben können, in denen das geschehen ist, und 3) wissen, was sie getan haben oder gerade tun, um dies geschehen zu lassen, dann ist das einzige was zu tun bleibt, um die Gleichung zu lösen, einfach mehr davon zu tun.
2. Lösungsformel
W(under)
+ A(usnahme)
+ Mache (etwas, was zufällige Ausnahmen wahrscheinlicher macht)
= Lösung
3. Lösungsformel
W(under)
+A(usnahme)
+Tue so, als ob (das Wunder bereits geschehen wäre)
= Lösung
Jede Person muß, die für ihn individuell richtige Lösungsformel herausfinden, um sicher zu stellen, daß das Wunder auch von Dauer ist. Kleine durch die Lösungs-Gleichungen angeregte Veränderungen können größere Veränderungen nach sich ziehen. Allerdings können nur durch harte Arbeit und Übung die relativ einfach wirkenden Ideen in bleibende Lösungen verwandelt werden.
4. Zum Umgang mit Rückschlägen
Anhand des simplen Beispiels Stau auf der Autobahn ohne sichtbaren Grund oder einleuchtende Erklärung wird beschrieben, warum ein Rückfall viele so irritiert.
“Die Leute, die solche Dinge untersuchen, nennen das Phänomen `Schockeffekt`. Sie weisen darauf hin, daß solche Staus dadurch verursacht werden, daß manche Leute zu vorsichtig fahren Nach Meinung von ExpertInnen gibt es so etwas wie eine optimale Geschwindigkeit, bei der die meisten Menschen am besten Auto fahren. Sie erklären die Entstehung von Staus dadurch, daß einige AutofahrerInnen bei erhöhtem Ver- kehrsaufkommen anfangen, langsamer als mit der optimalen Geschwindigkeit zu fahren, und damit auch andere zum Abbremsen zwingen. Diese anderen FahrerInnen fangen nun ihrerseits an, nach dem Grund zu suchen, weswegen sie abbremsen mußten. Und je mehr sie suchen, desto langsamer und vorsichtiger fahren sie. Je langsamer und vor- sichtiger sie fahren, desto ängstlicher werden sie. Je ängstlicher sie werden, desto mehr neigen sie dazu, bei kleinsten Verkehrsereignissen überzureagieren, und voilá - der Stau ist da, und, was am wichtigsten ist, scheinbar völlig ohne Grund” (S. 132).
Ein Rückfall kann sowohl bei dem Rückfälligen als auch dem Therapeuten eine Art Schock auslösen. Das Hauptaugenmerk wird nun auf die Untersuchung und Analyse des Rückfalles gerichtet. Man dachte, wenn man den Grund für den Rückfall weiß, kann man dem besser vorbeugen, bestenfalls für die Zukunft vermeiden. Man müsse nur den aktuellen Rückschlag verstehen. Der laufende Veränderungsprozeß kommt in dem Mo- ment zum stocken, da man ja mit der Rückfallaufarbeitung beschäftigt ist. Durch das Verlangsamen des Veränderungsprozesses werden beide Seiten vorsichtiger und ängstlicher, Überreaktionen treten ein, und die Behandlung gerät in einen Stau.
Staus und Rückschläge sind relativ normale Vorgänge im Leben, die man nur zu händeln wissen muß. Wichtig ist die Frage, wie man nach einem Rückschlag die optimale Reisegeschwindigkeit auf dem Weg zur Lösung wieder aufnehmen kann.
“Wo wir unsere KlientInnen früher vielleicht konfrontiert und auf die Schwächen hinge- wiesen hatten, die zu dem Rückschlag geführt hatten, konzentrierten wir uns nun auf ihre offensichtlichen Stärken und Ressourcen, die sie wieder auf den Weg brachten” (S. 136).
Schlechte Gefühle und Angst, die Behandlung wieder von vorne beginnen zu müssen, haben die Klienten von selbst, darauf muß man sie nicht mehr hinweisen. Man kann auch zitieren: “Shit happens” (De Shazer, 1991). Also: Bevor man wertvolle Zeit mit der Suche nach Ursachen verschwendet, die wenig zur Lösung beitragen, und sinnvollere Dinge zurückstellt, sollte man am bisherigen Erfolg anknüpfen. Denn ein Erfolg, ein Fortschritt, muß ja bereits vorhanden sein, ansonsten kann man keine Rückschläge er- leiden.
4.1. Regel 1 bis 3
Regel 1:
Wenn es nicht kaputt ist, dann repariere es auch nicht!
“Bevor sie also versuchen, herauszufinden, was kaputt ist, und was zu dem Rückschlag geführt hat, sollten sie daher zunächst einmal einfach das tun, was funktioniert hat, bevor der Rückschlag passierte!” (S.138).
Heißt eigentlich nur kurz und knapp:
Weitermachen wie bisher und sich von einer kurzen negativen Episode nicht runterziehen lassen.
Regel 2:
Wenn du weißt, was funktioniert, mach ´ mehr davon!
“Das Allerwichtigste ist jetzt, daß sie ihren Weg wiederfinden und sich wieder in Richtung Lösung bewegen. Alles andere birgt die Gefahr, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Zeitweilige Umwege können frustrierend und entmutigend sein, aber sie sollten nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen” (S. 14o).
Folgende Fragen zu dem Erfolg nach dem Rückschlag können weiterhelfen:
WAS
... hat Ihnen gezeigt, daß es Zeit war, mit dem Trinken wieder aufzuhören (oder es zu reduzieren)?
WIE
... haben Sie es schließlich geschafft, mit dem Trinken aufzuhören bzw. es zu reduzie- ren?
WER
... war bei Ihnen, als Sie sich entschlossen haben, mit dem Trinken aufzuhören bzw. es zu reduzieren? Inwiefern war es hilfreich, daß dieser Mensch bei Ihnen war?
WO
... sind Sie nach dem Rückschlag hingegangen, was hilfreich für Sie war?
Kurz:
Es geht darum herauszufinden, was funktioniert hatte und was man tun kann, falls in Zukunft wieder Probleme auftauchen.
Regel 3:
Wenn es nicht funktioniert, dann wiederhol ´ es nicht, mach ´ etwas ander(e)s!
Oft hält man an einer Methode, an einem Verhalten fest, das letztlich nicht funktioniert. Man probiert und probiert, wird frustrierter und frustrierter und gibt, mangels Erfolg, dann völlig auf. Dies betrifft sowohl den Therapeuten, der krampfhaft an seiner Methode festhält, als auch den Klienten, der mitmacht.
“Sie werden wahrscheinlich schon geahnt haben, daß sich das Problem in dem Moment löst, wo eine oder beide Seiten aufhören, etwas zutun, was nicht funktioniert, und statt- dessen etwas anderes machen. Was genau sie anderes tun, ist dabei gar nicht so wich- tig. Entscheidend für die Lösung des Problems ist lediglich, daß sie etwas, irgendet- was, anderes machen, als das, was nicht funktioniert hat... Wenn Du in einem Loch steckst, hör´ auf zu graben! Hör´ auf mit einer Problemlösestrategie, die nicht funktio- niert. Das Einzige, was dabei herauskommen kann, ist, daß man sich noch tiefer ein- buddelt” (S. 144).
4.2. Wie man etwas anderes findet, was man machen kann
Bemühen Sie sich zu sehr?
Manche werden “Opfer ihres eigenen Enthusiasmus”. Sie setzen sich absurd hohe Ziele und Maßstabe und “verrecken” daran. Der Erfolg bleibt aus, Selbstvorwürfe setzen ein, ein Rückfall ist fast vorprogrammiert. Hier hilft es, realistische Ziele und Maßstäbe zu setzen, kleine Schritte des Fortschrittes zu gehen.
Brauchen Sie einen Urlaub von der Veränderung?
Manchmal braucht man vor lauter Therapie auch einmal eine “Auszeit”, um Abstand von der aktuellen Situation zu bekommen und Dinge neu zu betrachten. Diese Auszeit sollte mindestens 1 - 2 Wochen dauern und in jedem Fall eingehalten werden.
Ist Ihnen Ihr Wunder klar?
Wissen sie (immer noch), was sie wollen, ist das Behandlungsziel noch klar, haben sie ihr Ziel vielleicht schon erreicht und bemerken es nur nicht? Hier ist es sinnvoll, sich die 6 Schlüssel noch einmal vor Augen zu führen.
“Die Arbeit an Zielen, die den sechs Erfolgsqualitäten nicht entsprechen, ist einer der häufigsten Gründe für Mißerfolg...” (S. 15o).
Sind Sie eine Kundin, die etwas verändern will? Eine Klagende? Eine Besucherin?
Im vorausgegangenen Semester hatten wir bereits die Unterscheidung, die ich hier noch einmal kurz aufführen möchte.
Als Kundin ist man sich seines Problems bewußt und gewillt, an dessen Lösung zu arbeiten. Wenn man an der “Wunder-Methode” aktiv mitgearbeitet hat und die entsprechenden Schritte durchgeführt hat, könnte man sich als Kundin bezeichnen.
Klagende dagegen sind Menschen, die bei der Problemlösung lediglich minimalsten Aufwand betreiben wollen. Oft denken sie, andere haben das Problem. Sie warten darauf, daß andere sich verändern bzw. sich das Problem von alleine löst. Hier ist die Frage wichtig, wie man seine eigene Motivation steigern kann, um durch eigenes Handeln eine Veränderung zu bewirken.
Der Besucher hat keine intrinsische Motivation. Er ist überzeugt, kein Problem zu ha- ben, und kommt nur durch Druck von Außen (Gericht, Arbeitgeber, Partner). Er sitzt seine Zeit ab. Diese Zeit könnte er dazu nutzen, darüber nachzudenken, was er will und einen Plan erstellen, wie er das erreichen könnte.
Sind Sie sich Ihrer Sache zu sicher?
Vor lauter “Entschlossenheit” kann man sich zu hohe Ziele setzen und dabei die Gefahr eines Rückfalles unterschätzen. Ich würde dies auch als “Höhenflug” bezeichnen. Durch einen Mißerfolg verdoppeln diese Personen ihre Anstrengungen noch und setzen sich noch höhere Maßstäbe, so daß ein Kreislauf aus immer größeren Anstrengungen mit Versprechungen, sich zu ändern, sowie chronischen Rückfällen entsteht. Was kann hier helfen?
“Hören Sie auf, die Wahrscheinlichkeit von Rückschlägen zu unterschätzen, und nehmen Sie sich jetzt die Zeit, sich angemessen auf diese Möglichkeit vorzubereiten. Sie können damit anfangen, indem Sie zunächst über die Rückschläge nachdenken, die hinter Ihnen liegen, und dann einen Plan entwickeln, wie Sie Situationen und Umstände vermeiden, die Sie einer erhöhten Gefahr aussetzen...” (S. 154).
Auch hier schaffen die Fragen nach dem WAS, WO, MIT WEM und WANN Klarheit.
Last but not least:
Haben Sie noch weitere Ideen, was Sie anders machen können?
Man weidormings weitere Alternativen entwickeln. Hilfreich ist auch eine “Mülleimerliste”, in die man einträgt, was nicht funktioniert hat, damit man die gleichen Fehler nicht noch einmal macht.
Benötigen Sie fremde Hilfe?
Bei der vorgestellten “Wunder-Methode” handelt es sich um ein Selbsthilfe-Buch. Sollte, trotz stärkstem Bemühen, ein Erfolg sich nicht einstellen, kann eine psychologische Behandlung sinnvoll sein.
Im Gegensatz zur herkömmlichen Suchtbehandlung raten die Autoren jedoch:
“Es heißt aber, daß Sie einige Therapieergebnisse nach vier bis fünf Sitzungen, spätestens aber nach der 1o. Sitzung erwarten sollten... Machen Sie einen Bogen um professionelle BehandlerInnen, die behaupten, Behandlung und Genesung seien immer ein lebenslanger Prozeß” (S. 157).
[...]
1 aus: Drogenpolitik-, recht-, hilfe für die neunziger Jahre, Caritas-Korrespondenz 1987/5
2 aus: a.a.O.
3 vergl.: AkT: Ambulantes Gruppenprogramm zum kontrollierten Trinken. Grundlagen, Programmmerkmale und erste Befunde. In: Konturen, Fachzeitschrift des Deutschen Ordens zu Sucht und sozialen Fragen, Ausgabe 5/2ooo, S. 18 ff.
4 aus: Suchtbericht des Drogenbeauftragten der Freien und Hansestadt Hamburg, 1994, S. 79
Häufig gestellte Fragen zu Die Wundermethode
Was ist das Hauptthema von Die Wundermethode?
Das Hauptthema ist ein Vergleich traditioneller Suchtbehandlungsmethoden mit einem neuen, lösungsorientierten Ansatz. Es wird die Verschiebung von repressiven, bestrafenden Maßnahmen hin zu akzeptierenden, ressourcenorientierten Konzepten in der Suchthilfe untersucht.
Was kritisiert der Text an traditionellen Suchtbehandlungsmethoden?
Der Text kritisiert, dass traditionelle Methoden oft auf Bestrafung, Sanktionen und lebenslange Abstinenzforderungen basieren, was zu Therapieunwilligkeit und Rückfällen führen kann. Es wird bemängelt, dass sie sich zu sehr auf die Probleme und Defizite des Patienten konzentrieren und weniger auf seine Stärken und Ressourcen.
Was ist der lösungsorientierte Ansatz, der in Die Wundermethode beschrieben wird?
Der lösungsorientierte Ansatz geht davon aus, dass der Klient selbst in der Lage ist, Lösungsstrategien zu entwickeln. Er betont die Fähigkeiten des Klienten und die Zusammenarbeit zwischen Therapeut und Klient. Der Fokus liegt auf der Zukunft und den Stärken des Klienten, nicht auf der Vergangenheit und den Defiziten.
Welche acht Prinzipien werden dem lösungsorientierten Ansatz zugeschrieben?
Die acht Prinzipien sind: 1. Kein Ansatz passt für alle; 2. Es gibt mehr als eine mögliche Lösung; 3. Lösung und Problem sind nicht notwendigerweise miteinander verbunden; 4. Der einfachste und am wenigsten einschneidende Ansatz ist oft die beste Medizin; 5. Menschen können in kurzer Zeit Besserungen erreichen und schaffen es auch; 6. Änderung geschieht ständig; 7. Fokussiere auf Stärken und Ressourcen und nicht auf Schwächen und Defiziten; 8. Fokussiere auf die Zukunft und nicht auf die Vergangenheit.
Was ist die "Wunderfrage" im lösungsorientierten Ansatz?
Die Wunderfrage ist eine Fragetechnik, bei der der Klient sich vorstellen soll, dass über Nacht ein Wunder geschieht und sein Problem gelöst ist. Er soll dann beschreiben, was am nächsten Morgen anders wäre, was ihm zeigen würde, dass das Wunder geschehen ist. Diese Antwort soll dann anhand von 6 Schlüsseln präzisiert werden um die Wahrscheinlichkeit, dass die gewünschte Lösung eintritt, zu vergrößern.
Welche drei Hinweise gibt es auf die Lösung?
Die drei Hinweise auf die Lösung sind: 1. Suche nach Teilen des Wunders, die jetzt schon geschehen; 2. Lerne aus Fehlern, die du nicht machst; 3. Suche nach Änderungen vor der Behandlung.
Welche Lösungsformeln werden im Text vorgestellt?
Es werden drei Lösungsformeln vorgestellt:
1. W(under) + A(usnahme) + Mache (mehr von dem was funktioniert) = Lösung
2. W(under) + A(usnahme) + Mache (etwas, was zufällige Ausnahmen wahrscheinlicher macht) = Lösung
3. W(under) + A(usnahme) + Tue so, als ob (das Wunder bereits geschehen wäre) = Lösung
Wie geht der Text mit Rückschlägen um?
Der Text betrachtet Rückschläge als normale Vorgänge und rät, nicht in eine detaillierte Analyse des Rückfalls zu verfallen, sondern sich auf die Stärken und Ressourcen des Klienten zu konzentrieren, die ihm wieder auf den richtigen Weg bringen. Es werden drei Regeln für den Umgang mit Rückschlägen vorgestellt: 1. Wenn es nicht kaputt ist, dann repariere es auch nicht; 2. Wenn du weißt, was funktioniert, mach ´ mehr davon; 3. Wenn es nicht funktioniert, dann wiederhol ´ es nicht, mach ´ etwas ander(e)s!
Welche Fragen werden gestellt, um den Erfolg nach einem Rückschlag zu analysieren?
Die Fragen sind: WAS hat Ihnen gezeigt, daß es Zeit war, mit dem Trinken wieder aufzuhören (oder es zu reduzieren)?; WIE haben Sie es schließlich geschafft, mit dem Trinken aufzuhören bzw. es zu reduzieren?; WER war bei Ihnen, als Sie sich entschlossen haben, mit dem Trinken aufzuhören bzw. es zu reduzieren? Inwiefern war es hilfreich, daß dieser Mensch bei Ihnen war?; WO sind Sie nach dem Rückschlag hingegangen, was hilfreich für Sie war?
Welche Unterscheidungen werden bezüglich der Motivation des Klienten getroffen?
Es werden drei Typen von Klienten unterschieden: Die Kundin (motiviert zur Problemlösung), die Klagende (erwartet, dass andere das Problem lösen) und der Besucher (kommt unter Druck von außen und hat keine intrinsische Motivation).
- Quote paper
- Annika Mayer (Author), 2001, Die Wundermethode, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/100553