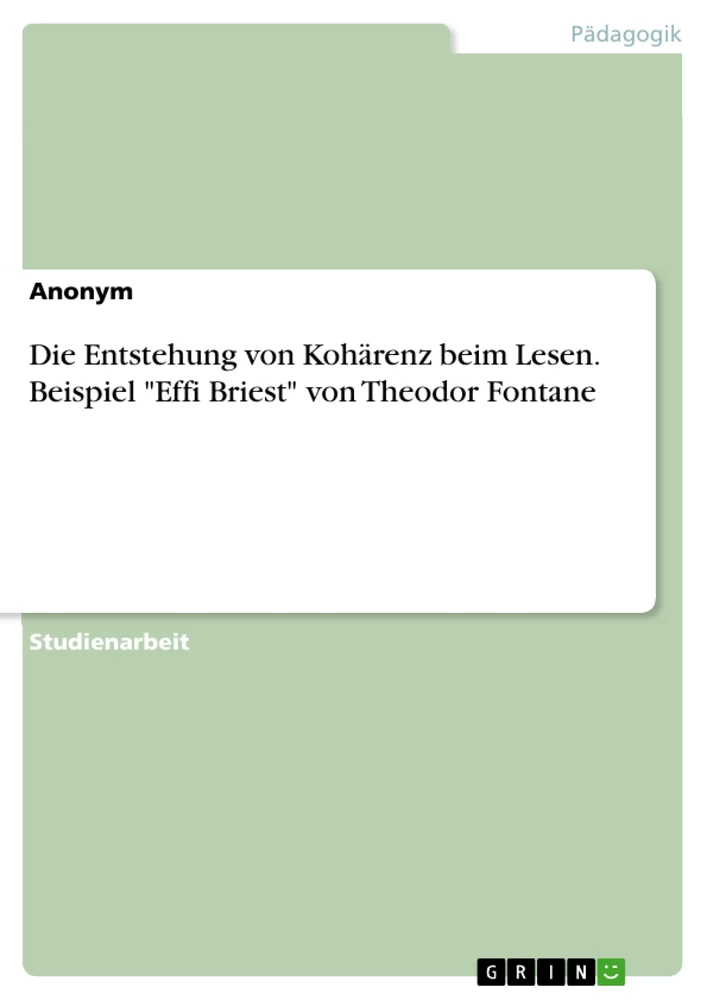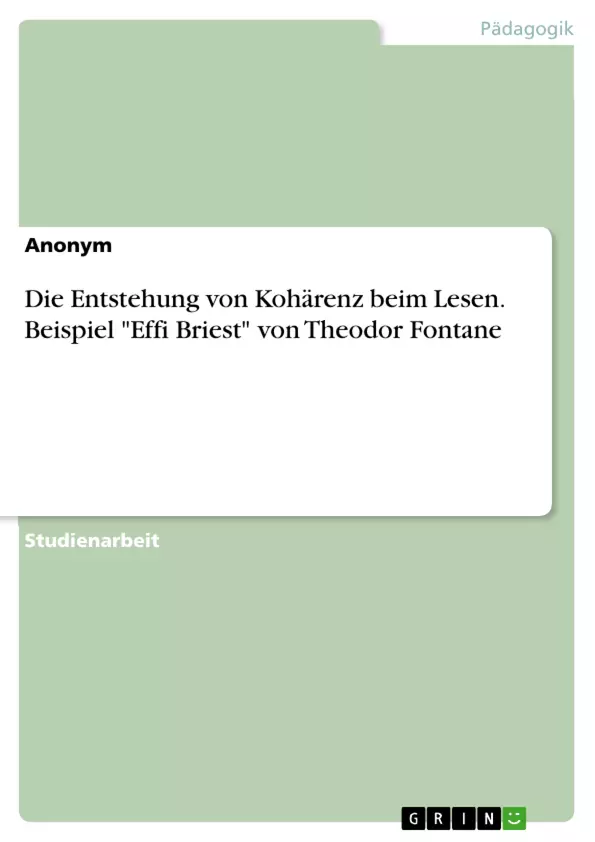Diese Arbeit soll anhand eines konkreten literarischen Textes und der entsprechenden theoretischen Auslegung, die Entwicklung von Kohärenz untersuchen. Der im Anhang beigelegte Abschnitt des literarischen Textes Effi Briest von Theodor Fontane soll Untersuchungsgegenstand sein. Die Arbeit soll im ersten Teil die theoretischen Grundlagen rund um das Themengebiet der Kohärenz festhalten und konkrete wissenschaftliche Befunde benennen, welche belegen, wie Kohärenz beim Lesen entstehen kann. Dabei werden zum einen weitere Theorien im Bereich der Kohärenzbildung erläutert, zum anderen soll auf konkrete Textsorten und Kohärenzsignale, sowie beim Lesen entstehende Verständnisbarrieren, aufmerksam gemacht werden. Der zweite Teil setzt sich konkret mit dem literarischen Text "Effi Briest" von Theodor Fontane auseinander. Die theoretischen Grundlagen sollen hier Anwendung finden.
Es wird darauf eingegangen, inwiefern das Wissen rund um den Begriff der Kohärenz auf die Materialentwicklung und die konkrete Ausführung einer Unterrichtsstunde in einer neunten Klasse zur besseren Vermittlung des Textes und der allgemeinen Lesekompetenz der Schüler beitragen kann. Der Textausschnitt des Gesellschaftsromans „Effi Briest“ von Theodor Fontane wird als konkretes Beispiel herangezogen, da die detailreiche Beschreibung die Konzepte der Kohärenz und Texterschließung anschaulich verdeutlichen kann. Gegen Ende der Arbeit soll eine konkrete Unterrichtsausführung in einer neunten Klasse dargestellt werden, wobei der Text "Effi Briest" von Theodor Fontane erarbeitet werden soll. Dabei soll der Inhalt und die dazugehörige Epoche beachtet werden, mit dem Beispiel soll des Weiteren auf Kennzeichen der globalen und der lokalen Kohärenz aufmerksam gemacht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse der Einleitung des literarischen Textes Effi Briest hinsichtlich Textsorten-, Kohärenzsignalen und Verständnisbarrieren Kohärenz beim Lesen
- Theoretische Fundierung: „Kohärenz“
- Entstehung von Kohärenz
- Beispielhafte Erklärung der globalen und der lokalen Kohärenz
- Textsorten-, Kohärenzsignale, Verständnisbarrieren
- Analyse der Einleitung des literarischen Textes Effi Briest
- kurzer inhaltlicher Überblick/ Eingrenzung der Textstelle zum weiteren Verständnis
- Analyse hinsichtlich der Textsorte des literarischen Textes „Effi Briest“
- Analyse hinsichtlich Kohärenzsignalen im literarischen Text „Effi Briest“
- Analyse hinsichtlich Verständnisbarrieren
- Implikationen für die Praxis, konkrete Unterrichtsausführung
- Theoretische Fundierung: „Kohärenz“
- Résumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Entwicklung von Kohärenz anhand eines konkreten literarischen Textes, des Auszugs aus „Effi Briest“ von Theodor Fontane, zu untersuchen. Die Arbeit beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Kohärenzbildung, klärt die Entstehung von globaler und lokaler Kohärenz, erläutert Textsorten und Kohärenzsignale und geht auf Verständnisbarrieren ein, die beim Lesen auftreten können.
- Theoretische Grundlagen der Kohärenzbildung
- Entstehung von globaler und lokaler Kohärenz
- Textsorten und Kohärenzsignale
- Verständnisbarrieren beim Lesen
- Anwendung der Theorie am Beispiel von „Effi Briest“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Kohärenz im Kontext der Lesekompetenz vor. Es werden die Theorien von Santi und Reed sowie Woolfolk/Schönpflug erläutert, die die Bedeutung von Inferenz und Integration für das Verständnis von Texten betonen. Es wird erklärt, wie lokale und globale Kohärenz beim Lesen entstehen und welche Rolle das aktive Denkvermögen des Lesers spielt.
Analyse der Einleitung des literarischen Textes Effi Briest hinsichtlich Textsorten-, Kohärenzsignalen und Verständnisbarrieren Kohärenz beim Lesen
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Kohärenz und ihrer Abgrenzung zur Kohäsion. Es werden verschiedene Definitionen von Kohärenz, wie z.B. von Halliday und Hasan, sowie Modelle zur Prozessebene des Lesens, wie z.B. von Rosebrock und Nix, vorgestellt.
Theoretische Fundierung: „Kohärenz“
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Entstehung von Kohärenz, sowohl der lokalen als auch der globalen. Es werden Beispiele für pronominale Anaphern als Mittel der lokalen Kohärenz und Hierarchiesysteme als Mittel der globalen Kohärenz erläutert.
Beispielhafte Erklärung der globalen und der lokalen Kohärenz
Anhand von Beispielen werden die Konzepte der globalen und lokalen Kohärenz veranschaulicht. Es wird gezeigt, wie der Leser sein eigenes Weltwissen einsetzt, um einen Text kohärent zu verstehen. Die Beispiele verdeutlichen, wie der Leser logische Schlussfolgerungen zieht und mentale Repräsentationen des Sachverhaltes aufbaut.
Textsorten-, Kohärenzsignale, Verständnisbarrieren
Dieses Kapitel behandelt die spezifischen Textsorten und Kohärenzsignale, die in literarischen Texten vorkommen. Es wird darauf hingewiesen, dass bestimmte Textsorten eigene Merkmale haben, die die Kohärenz beeinflussen. Außerdem werden Verständnisbarrieren behandelt, die beim Lesen auftreten können und die Kohärenz beeinträchtigen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der Arbeit sind Kohärenz, Kohäsion, Textsorte, Textverstehen, Lesekompetenz, Inferenz, Integration, globale Kohärenz, lokale Kohärenz, Verständnisbarrieren, literarische Texte, „Effi Briest“ von Theodor Fontane.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Die Entstehung von Kohärenz beim Lesen. Beispiel "Effi Briest" von Theodor Fontane, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1001522