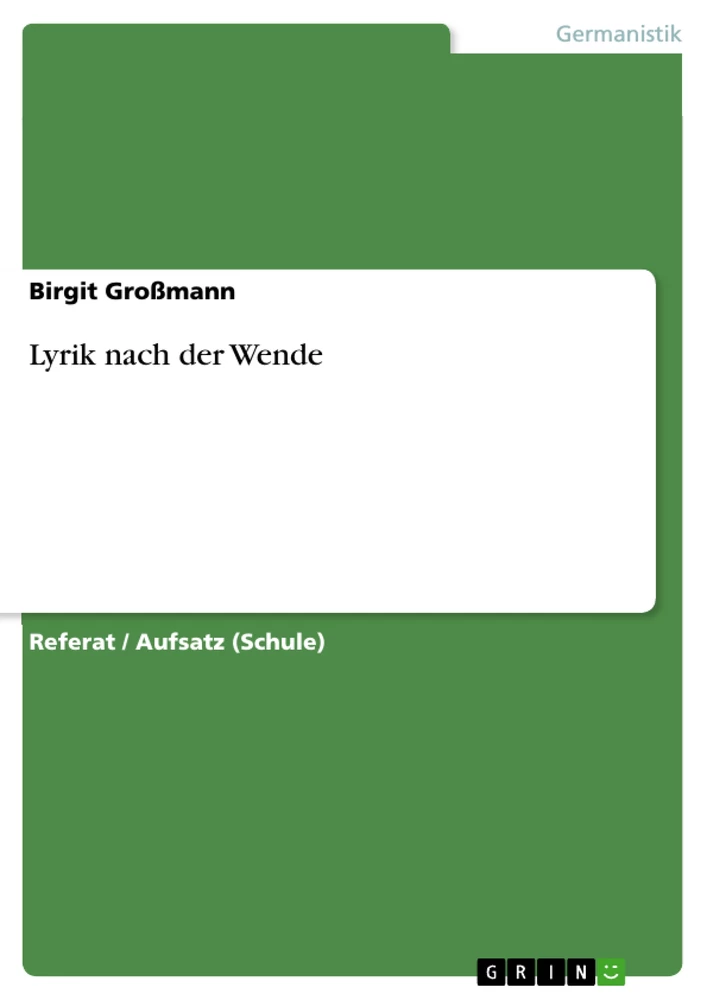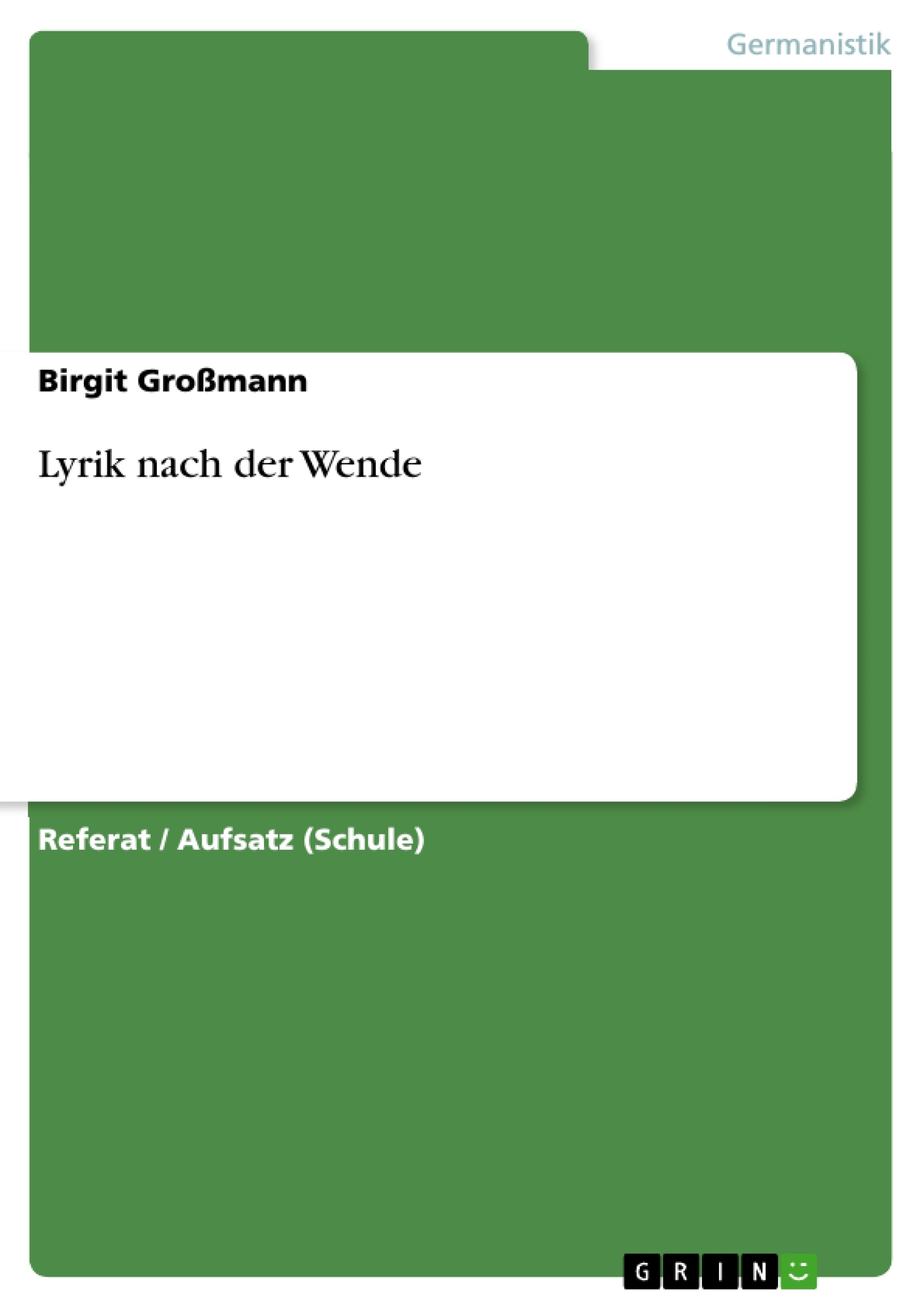Ausbürgerung Wolf Biermann
am 15. 11. 1936 in Hamburg als Sohn eines kommunistischen Widerstandskämpfers gegen das nationalsozialistische Regime geboren
als Kind Konfrontation mit der Ermordung seines Vaters im KZ Auschwitz
aus politischer Überzeugung siedelte er 1953 in die DDR über
Studium der Philosophie, politischer Ökonomie und Mathematik in Ostberlin
nach Abschluß des Studiums Assistent am Berliner Ensemble in Ostberlin
zu Beginn der 60er Jahre erste Gedichte und Lieder (Orientierung an Heinrich Heine, Berthold Brecht, Francois Villon), Auftritte in politischen Kabaretts
aufgrund seiner Kritik am realen Sozialismus, der seinen Vorstellungen von einer neuen und gerechten Gesellschaft widersprach, ab 1965 Liedermacher
daher konnten seine Werke (Lyrik: ,,die Drahtharfe" -1965, ,, Mir Marx und Engelszungen" - 1968, Schallplatte ,,Chauseestraße 131"-1972 und ,,Deutschland. Ein Wintermärchen" -1972) nur in der Bundesrepublik erscheinen
Biermann erhält 1976 Genehmigung für Tour in der BRD, darf aber trotz vorheriger Zusicherung nicht wieder in die DDR einreisen- diese Ausbürgerung führte zu massiven Protesten von Schriftstellerkollegen und Künstlerfreunde in der DDR _ kein Erfolg, viele Kritiker wanderten daraufhin in den Westen aus (darunter Jurek Becker und Reiner Kunze)
nach Wende meldete sich Biermann mit zahlreichen Essays und Polemiken (,,Über das Geld und andere Herzensdinge" -1991, ,,Der Sturz des Dädalus". 1993 zurück- er kritisiert darin die mangelnde Bereitschaft der DDR-Bürger und insbesondere der ehemals staatstragenden Intellektuellen, sich mit ihrer persönlichen Vergangenheit auseinanderzusetzen
1990 Auszeichnung mit dem Büchner Preis
1994 Veröffentlichung der Übersetzung de großen Poems des jüdischen Dichters Jizchak Katzenelson ,,Große Gesang vom ausgerotteten Volk"
zuletzt erschien ,,Wie man Verse macht und Lieder" 1997