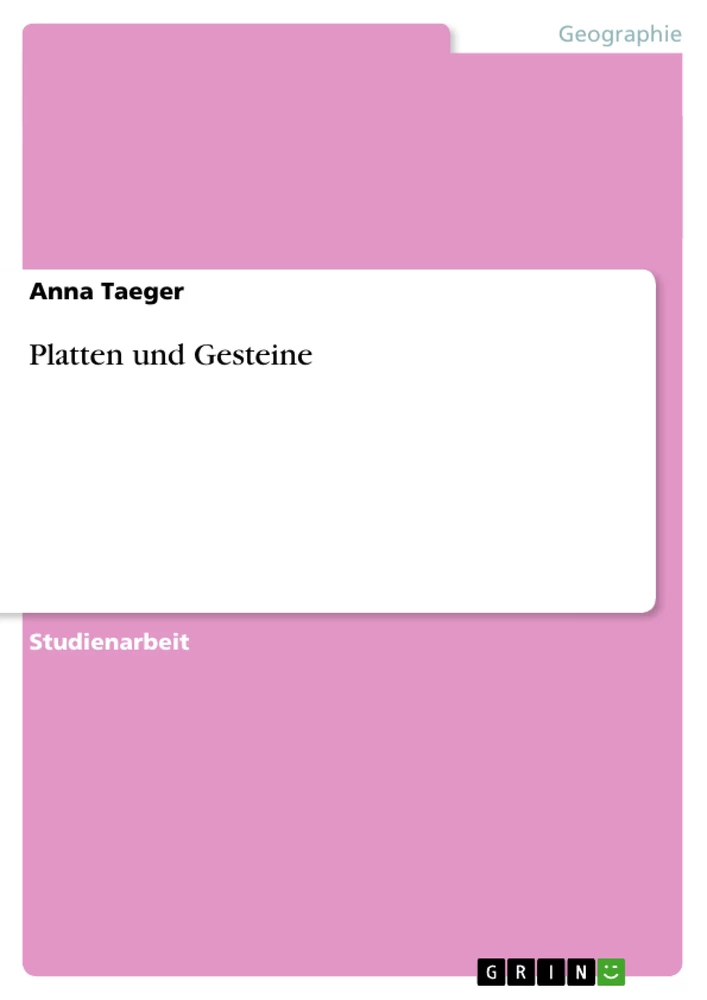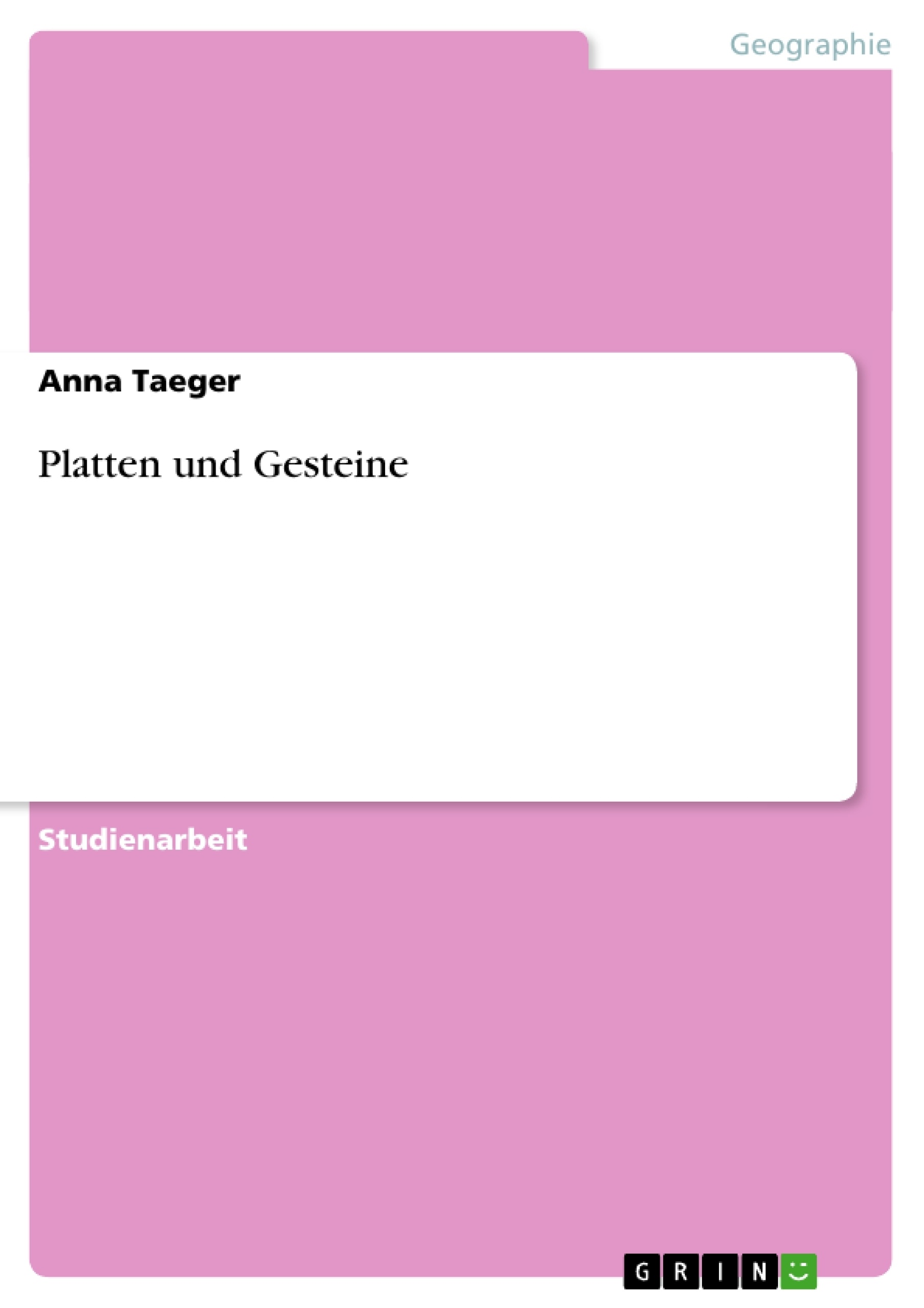Platten und Gesteine
Geodynamik und Plattentektonik Plattentektonik
Alfred Wegeners Kontinentalverschiebungstheorie Die Struktur des Erdkörpers
Erdkruste und Oberer Mantel
Zusammensetzung des Krustenmaterials
endogene Vorgänge
Vorgänge an den Plattenrändern
Subduktionszone
Plattengrenzen
1. divergierende Plattengrenzen:
2. konvergierende Plattengrenze
3. Transformstörungen
Der Gesteinskreislauf
Die Einteilung der Gesteine nach ihrer Entstehung
1. Eruptivgesteine (magmatische G., Magmatite)
2. Sedimentgesteine (Schichtgesteine)
a: mechanische Sedimente
b: chemische Sedimente
c: organische Sedimente
3. Metamorphe Gesteine (Metamorphite) Lagerstätten
Def. Lagerstätte:
Lagerstättentypen / -klassifikationen
Einteilung der Lagerstätten nach der Art des nutzbaren Stoffes
1. die Erze
Einteilung nach der Entstehung:
2. Organogene Lagerstätten
1. Kohlelagerstätten
2. Erdöllagerstätten / Erdgaslagerstätten
3. Salzlagerstätten
Geodynamik und Plattentektonik
geos - die Erde
dynamik - Bewegk ungen
Platte - bewegende Schollen
Tektonik - Veränderungen durch von innen wirkende Kräfte der Erde
Plattentektonik
Auf der Kontinentalverschiebungstheorie aufbauende, umfassende Vorstellung von der Gliederung der Erdkruste.
Die Erdkruste besteht aus:
6 oder 7 großen Platten
und 18 kleineren Platten
(Geschwindigkeit: 3-5 cm/Jahr)
die sich mit unterschiedlichen Richtungen und Geschwindigkeiten auf der Fließzone bewegen.
Alfred Wegeners Kontinentalverschiebungstheorie
vor 200 Mio. Jahren:
Urkontinent Pangäa
Urozeane Pantalessa und Thetysmeer
vor 135 Mio. Jahren:
Pangäa zerfiel in Laurasia ( Nordamerika, Eurasien ) und Gondwana ( Südamerika, Afrika, Australien, Antarktis )
Mobilismustheorie: Platten bewegen sich nur in wagerechten Bewegungen auf der Fließzone ( Alfred Wegener )
Fixmustheorie: Gebirge entstehen durch vertikale Bewegungen
Die Struktur des Erdkörpers
Lithosphäre: Feste Gesteinsscholle der Erde, die sich aus der Erdkruste und dem obersten Erdmantel zusammensetzt.
Erdkruste und Oberer Mantel
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
die meisten Platten bestehen sowohl aus kontinentaler (Sial) als auch aus ozeanischer Kruste (Sima)
Zusammensetzung des Krustenmaterials
Sial (oben): sauer, siliziumreich, aluminiumreich
Sima ( unten): basaltisch, siliziumreich, magnesiumreich
endogene Vorgänge
alle Vorgänge, die vom Inneren der Erde her die Lithosphäre verändern
endogene Kräfte/Vorgänge
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vorgänge an den Plattenrändern
Subduktionszone:
( Abtauchzone )
Plattengrenze, an der sich 2 Platten aufeinander zu bewegen, wobei die dünnere, die den Ozeanboden bildet, unter die mächtigere, einer Kontinent bildende Platte abtaucht. Dabei wird der Rand der ozeanischen Platte aufgeschmolzen.
Hier findet die Orogenese statt.
Es entstehen Tiefseegräben.
Motoren der Plattenbewegungen: Konvektionsströme
Konvektionsströme:
Magmaströmungen im Erdmantel, sie werden durch die unterschiedlichen Temperaturen des Magmas ausgelöst und übertragensich auf die Erdkruste.
Sie sind die Ursache für die Kontinentalverschiebung.
Plattengrenzen
Spiegeln sich im Verteilungsmuster der Erdbebenherde und der aktiven Vulkanen wieder. Diese sind entlang bestimter Linien angeordnet.
Es gibt 3 Arten von Plattengrenzen:
1. divergierende Plattengrenzen:
2 Platten entfernen sich von einander weg.
Aufsteigen von Gesteinsschmelze aus dem Erdmantel. Entstehung neuer Lithosphäre.
Vergrößerung der angrenzenden Plattengrenzen
-konstruktive Plattengrenze
2. konvergierende Plattengrenze
Aufeinanderzubewegung von ozeanischer (oder kontinentaler) und kontinentaler Platten Es kommt zur Subduktion.
(ozeanische Platte (oder Teil der kontinentalen Platte) taucht unter die kontinentale Platte)
- Materialstau innerhalb der Kruste
- Anlage tektonischer Strukturen (Falten, Überschiebungen)
-destruktive Plattengrenze
3. Transformstörungen
Plattengleiten horizontal aneinander vorbei
-konservierende Plattengrenze
Der Gesteinskreislauf
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Kreislauf der Stoffe in räumlicher Darstellung
(von links nach rechts in endloser Wiederholung fortlaufend) (Nach Hans Cloos)
Vorgänge und Bereiche:
I Verwitterung und Abtragung
II Verfrachtung (Transport) durch Flüsse
III Ablagerung (Sedimentation) und Verfestigung von Verwitterungsschutt (Sedimentgesteine)
IV Umwandlung durch gebirgsbildende Vorgänge. Auffaltung von Gesteinsmassen (Dynamo- oder Dislokationsmetamorphose)
V Stärkere Umwandlung durch erhöhten Druck und erhöhte Temperatur (Regionalmetamorphose)
VI Bildung neuer Gesteinsschmelzen
(Granitisierung)
Gesteine:
A Eruptivgesteine (Magmatite)
P = Plutonite (Tiefengesteine z.B.:Granit, Syenit) V = Vulkanite (Ergußgesteine z.B.:Basalt, Porphyr)
B Absätze und Absatzgesteine (Sedimentgesteine, Sedimentite)
1 Kies, Konglomerat, Schutt, Brekzie
2 Sand, Sandstein sowie
3 Ton, Schieferton ( mechanisch gebildete Sedimente, meistens mariner Entstehung )
4 Mergel (Kalk-Tonstein-Gemenge) ( Gemenge aus chemisch und mechanisch gebildeten Sedimenten )
5 Kalkstein und Dolomit sowie
6 Salze
( chemische (marine) Sedimente )
C Umwandlungsgesteine, metamorphe Gesteine (Metamorphite) aus Sedimenten
z.B.:Gneis, Marmor, Quarzit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Einteilung der Gesteine nach ihrer Entstehung
ergibt drei große Gruppen:
1. Eruptivgesteine (magmatische G., Magmatite)
Unterteilung:
a: Plutonite z.B.: Granit b: Vulkanite z.B.:Basalt
entstehen aus silikatischen Schmelzen infolge einer Temperaturerniedrigung.
Erfolgt die Erstarrung innerhalb der Erdkruste, dann entstehen Tiefengesteine (Plutonite).
Gelangt der Schmelzfluß an die Erdoberfläche, dann bilden sich Ergußgesteine (Vulkanite).
Tiefengesteine haben durch ihre langsame Abkühlung ein gleichmäßig körniges Gefüge.
Ergußgesteine jedoch infolge schneller Abkühlung ein glasiges oder sehr feinkörniges bzw. ungleichkörniges Gefüge.
In geringeren Massen treten Ganggesteine als Füllungen klaffender Spalten oder von
Schloten auf. Sie werden aus dem Magma gebildet und haben entweder die gleiche Zusammensetzung wie die Tiefengesteine
(ungespaltene, aschiste Ganggesteine, z. B. Granitporphyr)
oder eine stark abweichende Zusammensetzung
(gespaltene, diaschiste Ganggesteine, z. B. Lamprophyr, Aplit).
In einer gesetzmäßigen Anordnung vollzieht sich die Mineral- und Gesteinsbildung bei den Eruptivgesteinen.
Ihre Aneinanderreihung erfolgt geregelt nach dem Kieselsäuregehalt. Man unterscheidet nach dem SiO2-Gehalt:
- saure G. (mehr als 65%)
- intermediäre G.(65 bis 52%)
- basische G.(52 bis 45 %)
- und ultrabasische G. (weniger als 45 %)
Nach der chemischen Zusammensetzung lassen sich einem Tiefengestein entsprechende Ergußgesteine zuordnen.
z. B. Granit -Liparit
Basalt -Gabbro
Durch verschiedene Namensgebung werden die Ergußgesteine auch nach dem Alter untergliedert.
z.B.:Basalt (Tertiär), Melaphyr (Karbon)
Unterschiede zw.Granit und Basalt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vorkommen in D.: Schwarzwald, Odenwald Eifel, Westernwald
2. Sedimentgesteine (Schichtgesteine)
a: mechanische Sedimente
z.B.: Sandstein
Sedimentgesteine werden im Meeresraum als marine , auf dem Festland als terestische Sedimente abgelagert.
Sie treten als Lockergesteine und nach Verfestigung als Festgesteine auf.
Die zunächst lockeren Sedimente können durch Diagenese zu festen Sedimentgesteinen verfestigt werden.
z. B. Sand zu Sandstein
Ton zu Tonstein
Kalkschlamm zu Kalkstein Torf zu Kohle
Alle an der Erdoberfläche befindlichen Gesteine werden durch Verwitterung zerkleinert.
Das Material kann dann durch Wasser, Wind oder Eis transportiert und schließlich abgelagert werden.
Verwitterungsprodukte, die in fester Form transportiert wurden, sind klastische Sedimente. Nach der Korngröße ihrer Einzelteile unterscheidet man:
-grobkörnige Psephite (Korndurchmesser >2 mm),
z.B. Konglomerat
-mitelIkörnige Psammite (2 bis 0,02 mm),
z.B. Sand
-feinkörnige Pelite (<0,02 mm)
z. B. Ton.
b: chemische Sedimente
z.B.: Gips, Salz
Die durch chemische Verwitterung in wäßrige Lösungen übergeführten Teile werden in
Bächen und Flüssen transportiert und unter bestimmten Bedingungen ausgefällt und abgelagert.
Sie bilden dann die chemischen Sedimente
z. B. Salzgesteine, Gips, Oolithe, Sinter.
c: organische Sedimente
z.B.: Kohle
Bei der Ausfällung und Sedimentation können auch Organismen beteiligt sein
z.B. bei der Bildung von Kalkstein.
Organogene Sedimente sind die Ansammlungen von Kieselsäureskeletten niederer Organismen
z.B. Radiolarien, Diatomeen
3. Metamorphe Gesteine (Metamorphite)
sind Produkte der Metamorphose.
Die durch Druck- und Temperaturerhöhungen vor allem infolge der Regionalmetamorphose entstandenen Gesteine werden kristalline Schiefer genannt
z. B. Gneis.
Es sind Gesteine mit überwiegend gerichteter Anordnung der Minerale.
Durch die rein thermische Kontaktmetamorphose werden die Kontaktgesteine erzeugt z, B. Fleckschiefer
Gesteine die die Wirkung des Durchbewegungsdruckes (Streß) zeigen, heißen Tektonite. Zumeist läßt sich hier aber die Wirkung von Druck und Temperatur nicht trennen.
Metamorphe Gesteine, die aus Eruptivgesteinen umgebildet sind, werden auch Orthogesteine , aus Sedimentgesteinen entstandene Paragesteine genannt.
Bei der normalen Metamorphose verbleibt das Gestein im festen Zustand. Die Erhöhung der Temperatur kann jedoch dazu führen, daß Teile des Gesteins in Schmelze überführt werden; es bilden sich dann Migmatite (Mischgesteine)
z.B.: Gneis.
Diese Umwandlung heißt Ultrametamorphose, sie kann im Extremfall zu der Bildung
palingener Magmen führen. Die daraus entstehenden Gesteine werden zu den Eruptivgesteinen gezählt.
Man unterteilt metamorphe Gesteine nach der Entstehung: a: durch Absenkung in tiefere Bereiche und bei Faltung z.B.: Granit -Gneis
Kalkstein -Marmor Sandstein -Quarzit
Tonstein -Glimmerschiefer
b: durch aufdringendes Magma in der Nachbarschaft z.B.: Tonstein -Knotenschiefer
Sandstein - Quarzit
Lagerstätten
Def. Lagerstätte:
Natürliche Anhäufung von Mineralien, die entsprechend den heutigen technischen
Möglchkeiten und wirtschaftlichen Erfordernissen nutzbringend gewonnen und verarbeitet werden können.
Lagerstättentypen / -klassifikationen
1. tektonisch bedingte Lagerstätten (Erze, Mineralien, Mineralwässer)
2. klimatisch und tektonisch bedingte Lagerstätten (Salze)
3. klimatisch, organisch und tektonisch bedingte Lagerstätten
Einteilung der Lagerstätten nach der Art des nutzbaren Stoffes
1. Erzlagerstätten
2. Kohlelagerstätten
3. Salzlagerstätten
4. Erdöllagerstätten (mit Erdgas)
5. Lagerstätten der Steine und Erden
1. die Erze
Einteilung nach der Entstehung:
1. magmatogene Lagerstätten (primäre)
-umfassen alle Bildungen, die aus dem Magma direkt oder aus den von ihm abgespaltenen Spätphasen stammen
-entstanden in der Kruste beim Aufsteigen des Magmas aus dem Erdmantel
-Minerale werden je nach Dichte, Schmelzpunkt und Chemismus selektiv ausgeschieden (magmatische Differentation)
-es kommt so zur Trennung der einzelnen Mineralbestandteilen ·es gibt 3 Kristallisationsphasen
1. Erstkristallisation
-bei 1400°C
-liquidmagmatische Lagerstätten (Chrom, Nickel, Titan, Platin)
2. Hauptkristallisation
-1300 - 700°C
-mineralgemisch - selten Lagerstätten
3. Restkristallisation
-pegmatische Lagerstätten ( 700°C)
(Molybdän, Zinn, Wolfram, Lithium)
-pneumatolitische Lagerstätten (600°C)
(Arsen, Wofram, Kupfer, Eisen)
-hydrothermale Lagerstätten (400°C)
(Kupfer, Quecksilber, Gold, Blei, Eisen, Silber)
2. sedimentare Lagerstätten (sekundäre)
-umfassen alle nach Abtragung und Transport erzhaltiger Gesteine durch Ablagerúng entstandene Lagerstätten
-Ragte eine Lagerstätte über den Grundwasserspiegel hinaus. gelangt sie unter Einfluß der
Atmosphäre. Die sich bildene Oxidationsschicht wird auf Grund von Anreicherungen an Eisenoxiden auch "Eisener Hut" genannt.
2. Organogene Lagerstätten
1. Kohlelagerstätten
Def. Kohle:
brennbares Sedimentgestein, über lange Zeiträume
aus Holz oder anderen pflanzlichen Stoffen entstanden
Entstehung:
Ausgangsmaterial: Sumpfmoorwälder
Entsehungsorte: große, feuchtwarme Gebiete mit Moorlandschaft und reichlichem Pflanzenwuchs
-Abgestorbene Pflanzen und Pflanzenreste gerieten unter Wasser unter Luftabschluß (keine Verwesung)
-Entstehung eines Waldmoores - Faulschlamentstehung
-Einsetzung der Vertorfung unter Mitwirkung anaerober (ohne O2 lebende) Organismen ·kräftige Absenkung des Beckens (Verstärkung der Torflagen)
-Überschüttung von Fluß- oder Meeressedimenten (Geröll-, Sand- und Schlammschichten) ·Entwicklung eines neuen Waldmoores
- Wiederholung dieses Vorganges
-Entstehung von Wechsellagerungen von Kohlefölzen und Gesteinsschichten
-Verbiegung, Schiefstellung und Verwerfung der Kohlefölze durch gebir gsbildene Prozesse
vor ca.280 Mio. Jahren (Karbon): Steinkohleentstehung
vo ca. 60 Mio. Jahren (Tertiär): Braunkohleentstehung
Entstehung von Kohle aus Torf durch Abnahme von Sauerstoff und Wasserstoff und Zunahme von Kohlenstoff
Inkohlungsprozeß:
Stufen der Inkohlung:
1. biochemische Phase:
in einem Gärungsprozess mit Hilfe von Bakterien entstehen Moder - Torf - Braunkohle
2. geochemische Phase:
3.
unter hohem Druck und unter hohen Temperaturen entstehe Steinkohle - Antrazit - Grafit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vorkommen:
Appalachen
östliche Küste Chinas
Steinkohle in Deutschland: an der Ruhr, an der Saar Braunkohle in Deutschland: Köln-Aachen
Cottbus-Senftenberg-Spremberg Leipzig- Borna-Halle-Bitterfeld
2. Erdöllagerstätten / Erdgaslagerstätten
Def. Erdöl:
natürlich vorkommendes dünn bis
zähflüssiges Gemisch verschiedener
Kohlenwasserstoffe von hell- gelber, grauer, brauner bis schwarzer Farbe
Entstehung:
Ausgansmaterial: planktonische Lebewesen Entstehungsorte: abgeschlossene
Meeresteile, Lagunen und Buchten warmer Meere
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
-Absterben und Absinken der toten Lebewesen in tiefe Regionen, in denen wegen Luftabschluss keine Verwesung möglich ist
-Anreicherung mit anorganischen Sedimenten als Faulschlamm am Meeresboden ·Fäulnisbakterien entziehen den organischen Bestandteilen den Sauerstoff ·Organismenreste werden zu Kohlenwasserstoffen
-unter Druck und geringen Temperaturen werden die langkettigen KW zu Erdöl mit kurzkettigen KW (Bitumen)
-Erdöl und Erdgas steigen nach oben und sammeln sich in porösen Sedimentgesteinen
(Speichergesteinen), die von undurchlässigen Schichten (z.B.: Ton, Granit, Basalt) umgeben sind
Vorkommen:
Persischer Golf Westsibirien
2.+3.Baku (RUS) Texas (USA)
Nordsee
Kaspisches Meer
Vorkommen in Deutschland: Emsmündung
Weser-Ems
Elbe-Weser
Molassebecken (bei München)
3. Salzlagerstätten
Def. Salz:
Verbindung von Metall und Säure (NaCl) Man unterscheidet Stein- und Kalisalze
Entstehung:
Ausgangsmaterial: Salzwasser Entstehungsorte: Randmeere
-bei trockenem Klima Verdunstung des Wassers über dem Randmeer ·Salzwassernachstrom aus dem Ozean
-Zunahme der Salzkonzentration im Randmeer
-Ansammlung des schweren Salzwassers in der Tiefe ·Ablagerung der Salze am Grund
-Durch hohen Überlagerungsdruckund hohe Temperaturen können die Salze plastisch werden und in Spalten aufsteigen - Entstehung von Salzstöcken
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Quelle: Harms Handbuch der Geografie.Physische Geografie.M ü nchen: List Verlag)
Vorkommen:
Rotes Meer
Persischer Golf Sibirien
Russland westlich der Urals
Kanada östlich der Rocky Mountains
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen von "Platten und Gesteine"?
Die Hauptthemen umfassen Geodynamik, Plattentektonik (einschließlich Alfred Wegeners Kontinentalverschiebungstheorie), die Struktur des Erdkörpers, die Zusammensetzung der Erdkruste, endogene Vorgänge, Vorgänge an Plattenrändern (Subduktionszonen, Plattengrenzen), den Gesteinskreislauf und Lagerstätten.
Wie werden Gesteine nach ihrer Entstehung eingeteilt?
Gesteine werden in drei Hauptgruppen eingeteilt: Eruptivgesteine (Magmatite), Sedimentgesteine (Schichtgesteine) und Metamorphe Gesteine (Metamorphite).
Was sind die verschiedenen Arten von Sedimentgesteinen?
Sedimentgesteine werden in mechanische, chemische und organische Sedimente unterteilt.
Was ist eine Lagerstätte und wie werden Lagerstätten klassifiziert?
Eine Lagerstätte ist eine natürliche Anhäufung von Mineralien, die wirtschaftlich gewonnen und verarbeitet werden können. Lagerstätten können nach der Art des nutzbaren Stoffes (z.B. Erze, Kohle, Salze) oder nach ihrer Entstehung (tektonisch, klimatisch bedingt) klassifiziert werden.
Was sind die verschiedenen Arten von Plattengrenzen?
Es gibt drei Arten von Plattengrenzen: divergierende, konvergierende und Transformstörungen.
Was ist eine Subduktionszone?
Eine Subduktionszone ist eine Plattengrenze, an der sich zwei Platten aufeinander zu bewegen, wobei die dünnere ozeanische Platte unter die mächtigere kontinentale Platte abtaucht.
Was ist der Gesteinskreislauf?
Der Gesteinskreislauf beschreibt den Kreislauf der Stoffe in räumlicher Darstellung, der die Umwandlung von Gesteinen durch Verwitterung, Transport, Ablagerung, Metamorphose und magmatische Prozesse umfasst.
Wie entstehen Kohlelagerstätten?
Kohlelagerstätten entstehen aus abgestorbenen Pflanzenresten, die unter Luftabschluss in Mooren abgelagert und über lange Zeiträume durch Inkohlungsprozesse in Kohle umgewandelt werden.
Wie entstehen Erdöllagerstätten?
Erdöllagerstätten entstehen aus planktonischen Lebewesen, die in sauerstoffarmen Meeresböden abgelagert und unter Druck und Temperatur in Kohlenwasserstoffe umgewandelt werden. Diese sammeln sich dann in porösen Gesteinen unter undurchlässigen Schichten.
Wie entstehen Salzlagerstätten?
Salzlagerstätten entstehen durch die Verdunstung von Meerwasser in Randmeeren unter trockenen Klimabedingungen, wodurch sich die Salzkonzentration erhöht und Salze am Grund abgelagert werden.
Was sind endogene Vorgänge?
Endogene Vorgänge sind alle Vorgänge, die vom Inneren der Erde her die Lithosphäre verändern. Dazu gehören beispielsweise Plattentektonik, Vulkanismus und Erdbeben.
- Arbeit zitieren
- Anna Taeger (Autor:in), 1999, Platten und Gesteine, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99915