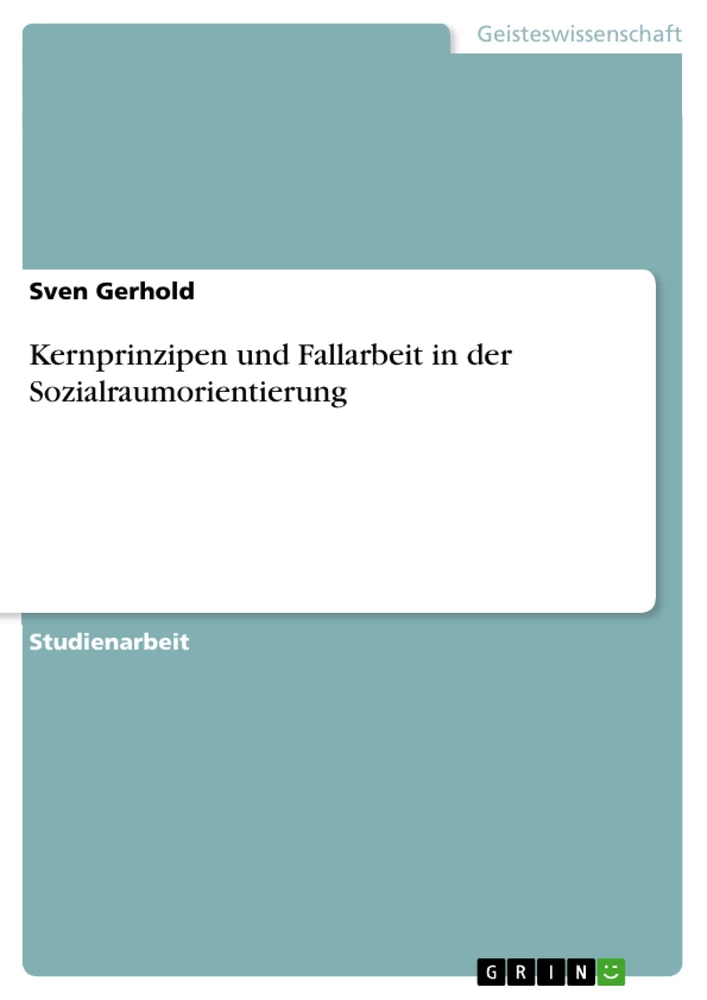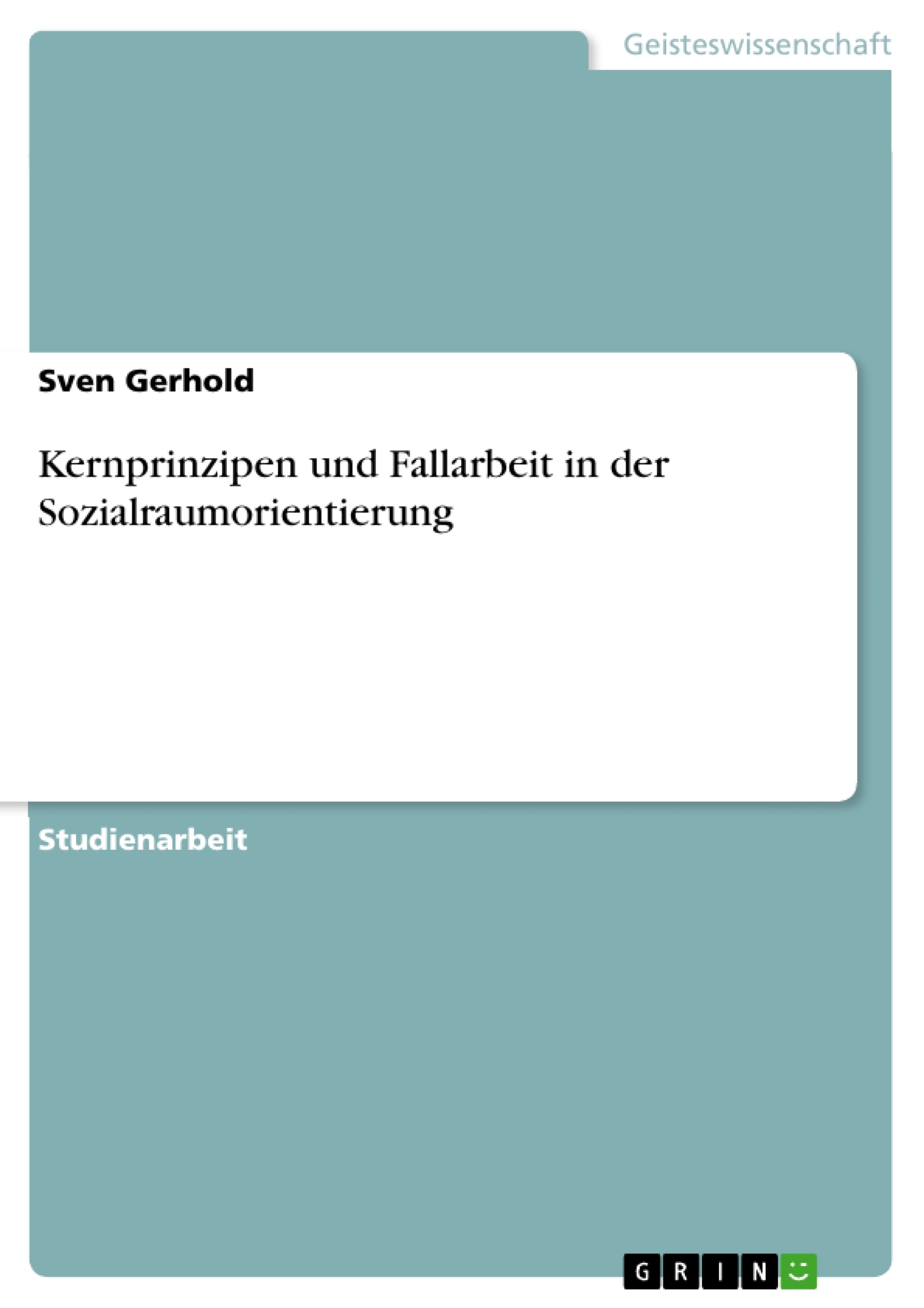Die Arbeit thematisiert die Entstehung und Entwicklungen der Sozialraumorientierung. Der Antrieb und die Motivation des Autors ist es, Hintergründe und Prozesse der Sozialraumorientierung, deren Ziele und Wirkung genauer zu beleuchten und entsprechend Rückschlüsse zu ziehen. Des Weiteren ist es auch Ziel des Autors, ein weiteres Fachkonzept der Sozialen Arbeit kennenzulernen, deren Anwendungsfelder zu beleuchten sowie die Vorgehens – und Arbeitsweiseweise zu studieren, um Rückschlüsse auf die alltägliche Arbeit ziehen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffe und Definitionen
- Das ISSAB
- Grundsätzliche Kritik am Hilfesystem
- Kernprinzipen der Sozialraumorientierung
- Orientierung an den Interessen und am Willen
- Unterstützung von Selbsthilfe und Eigeninitiative
- Konzentration auf die vorhandenen Ressourcen
- Zielgruppen und bereichsübergreifende Arbeitsweise
- Vernetzung und Integration
- Fallarbeit in der Sozialraumorientierung
- Die fallspezifische Arbeit
- Die fallübergreifende Arbeit
- Die fallunspezifische Arbeit
- Umsetzbarkeit und Umsetzungshindernisse
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Sozialraumorientierung und erörtert seine Relevanz in der Sozialen Arbeit. Sie analysiert die Hintergründe und Prozesse der Sozialraumorientierung sowie deren Auswirkungen auf die Klient*innen. Des Weiteren soll die Arbeit ein vertieftes Verständnis für das Fachkonzept der Sozialraumorientierung vermitteln, einschließlich seiner Anwendungsfelder, Vorgehensweisen und Arbeitsweisen.
- Die Bedeutung der Sozialraumorientierung in der Sozialen Arbeit
- Kritik am bestehenden Hilfesystem und die Notwendigkeit sozialräumlicher Ansätze
- Kernprinzipien der Sozialraumorientierung, wie Ressourcenorientierung und Selbstbestimmung
- Die Implementierung der Sozialraumorientierung in der Praxis und die Rolle des ISSAB
- Die verschiedenen Formen der Fallarbeit im Kontext der Sozialraumorientierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Motivation des Autors für diese Arbeit dar und skizziert die verwendeten Informationsquellen.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Begriffen „Sozialraum“ und „Sozialraumorientierung“. Es werden verschiedene Definitionen und ihre Ursprünge in der Stadtsoziologie und Pädagogik beleuchtet.
- Kapitel drei widmet sich dem Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB) und beschreibt dessen Rolle bei der Förderung sozialraumorientierter Strukturen.
- Im vierten Kapitel wird eine grundsätzliche Kritik am Hilfesystem geäußert, wobei die Defizite des bestehenden Systems und die Notwendigkeit präventiver Ansätze im Vordergrund stehen.
- Kapitel fünf analysiert die Kernprinzipien der Sozialraumorientierung, wie die Orientierung an den Interessen der Klient*innen, die Förderung von Selbsthilfe und Eigeninitiative sowie die Konzentration auf vorhandene Ressourcen.
- In Kapitel sechs wird die Fallarbeit in der Sozialraumorientierung in ihren verschiedenen Ausprägungen - fallspezifisch, fallübergreifend und fallunspezifisch - dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert die Sozialraumorientierung als ein zentrales Konzept in der Sozialen Arbeit. Im Fokus stehen die Kritik am bestehenden Hilfesystem, die Kernprinzipien der Sozialraumorientierung, die Rolle des ISSAB, die verschiedenen Formen der Fallarbeit und die Herausforderungen bei der Umsetzung sozialräumlicher Ansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Sozialraumorientierung?
Es ist ein Fachkonzept der Sozialen Arbeit, das nicht nur das Individuum, sondern dessen gesamtes Lebensumfeld (den Sozialraum) in die Unterstützung einbezieht.
Was sind die Kernprinzipien der Sozialraumorientierung?
Dazu gehören die Orientierung am Willen der Klienten, die Unterstützung von Selbsthilfe, die Nutzung vorhandener Ressourcen und eine vernetzte, bereichsübergreifende Arbeitsweise.
Was ist der Unterschied zwischen fallspezifischer und fallübergreifender Arbeit?
Fallspezifische Arbeit konzentriert sich auf die Hilfe für eine einzelne Person. Fallübergreifende Arbeit bündelt ähnliche Bedarfe mehrerer Klienten zu gemeinsamen Angeboten im Stadtteil.
Was ist das ISSAB?
Das Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB) ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung, die Konzepte zur Sozialraumorientierung entwickelt und implementiert.
Warum wird das traditionelle Hilfesystem kritisiert?
Kritisiert wird oft eine zu starke Defizitorientierung und eine "Komm-Struktur", die Klienten eher verwaltet, statt sie in ihrem natürlichen Umfeld zu stärken.
- Arbeit zitieren
- Sven Gerhold (Autor:in), 2021, Kernprinzipen und Fallarbeit in der Sozialraumorientierung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/998824