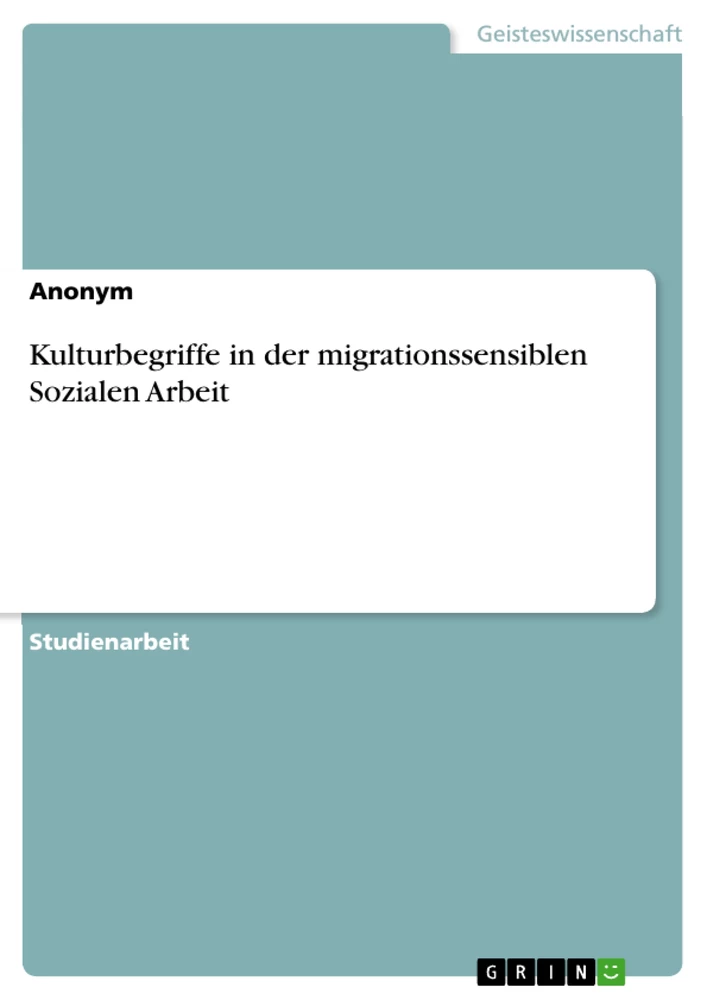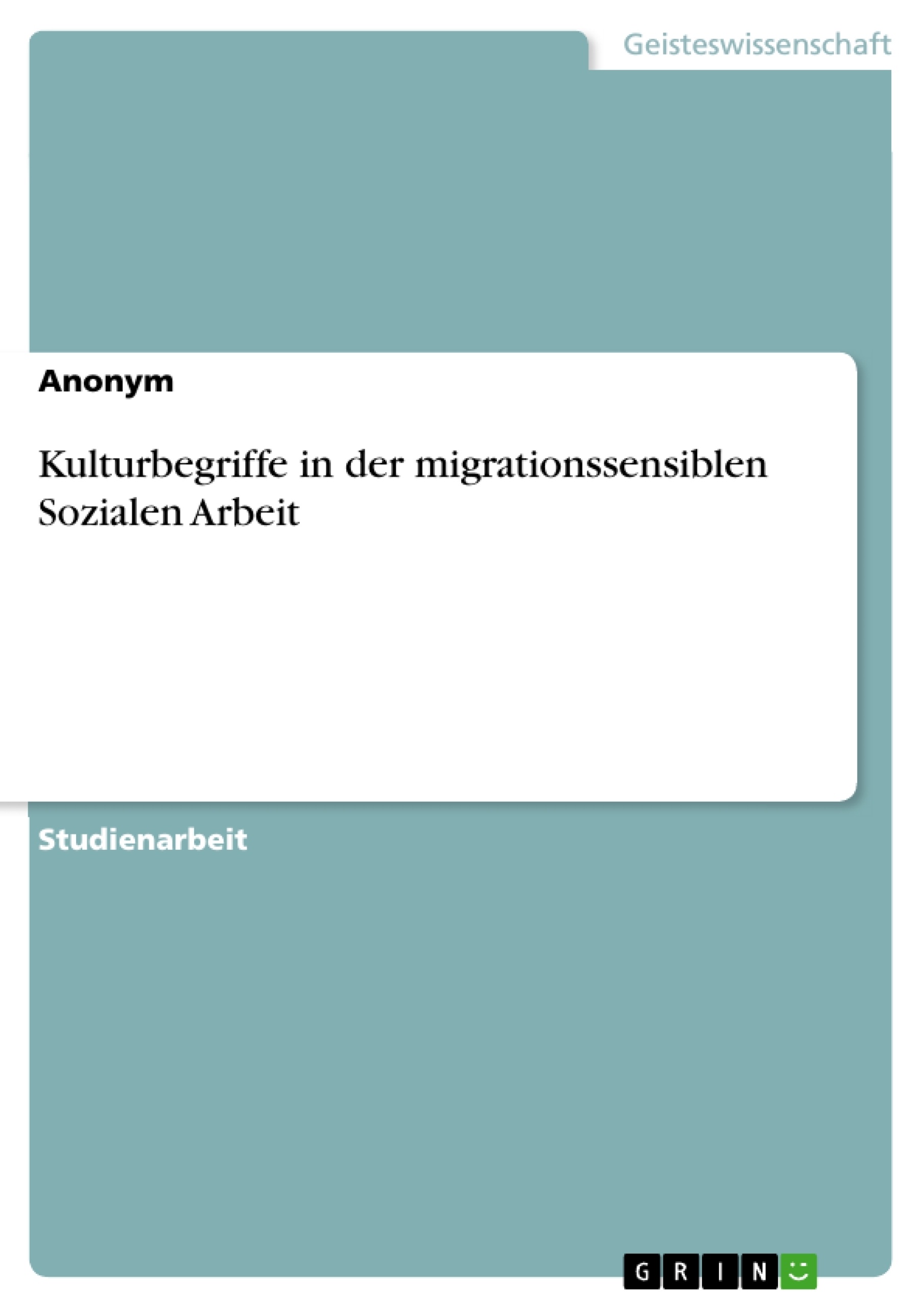In Deutschland lebt eine Vielzahl von Menschen mit unterschiedlichen Kulturen zusammen. Migration nimmt zu und hat sich zu einem wichtigen Berufsfeld der Sozialen Arbeit entwickelt. Oft befinden sich Menschen mit Migrationshintergrund in herausfordernden Lebenssituationen und sind obendrein mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert. Es existieren zusätzlich zahlreiche Zugangsbarrieren, die Migrant*innen davon abhalten, Soziale Dienste in Anspruch zu nehmen. Sozialer Arbeit kommt unter anderem die Aufgabe zu, diese zu erkennen und abzubauen. In dieser Arbeit sollen einige dieser Barrieren aufgeführt und erläutert werden. Außerdem wird der Begriff der Kultur untersucht, welcher, obwohl er nicht einheitlich definiert ist, immer wieder zu Kontroversen in Politik und Gesellschaft führt und für migrationssensible Soziale Arbeit von großer Bedeutung sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Kulturbegriff
- Der neue Rassismus
- Ethnozentrismus und kulturelle Identität
- Ethnozentrismus
- Kulturelle Identität
- Zugangsbarrieren
- Zugangsbarrieren der Migrant*innen gegenüber Sozialarbeiter*innen
- Zugangsbarrieren von Sozialarbeiter*innen gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund
- Interkulturelle Öffnung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Zugangsbarrieren für Migrant*innen in der Sozialen Arbeit und beleuchtet den komplexen Kulturbegriff im Kontext von Migration. Ziel ist es, die Herausforderungen der interkulturellen Sozialen Arbeit zu verdeutlichen und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Der vielschichtige und oft kontrovers diskutierte Kulturbegriff
- Der neue Rassismus und seine Ausprägungen in der Gesellschaft
- Ethnozentrismus und seine Auswirkungen auf interkulturelle Beziehungen
- Zugangsbarrieren für Migrant*innen in der Sozialen Arbeit
- Möglichkeiten der interkulturellen Öffnung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der interkulturellen Sozialen Arbeit in Deutschland ein. Sie hebt die Herausforderungen hervor, vor denen Migrant*innen in Bezug auf soziale Dienstleistungen stehen, und betont die Notwendigkeit, Zugangsbarrieren zu identifizieren und abzubauen. Der Kulturbegriff wird als zentraler Aspekt für migrationssensible Soziale Arbeit hervorgehoben, obwohl seine Uneinheitlichkeit zu Kontroversen führt.
Der Kulturbegriff: Dieses Kapitel analysiert den Begriff „Kultur“ aus verschiedenen Perspektiven. Es beginnt mit der etymologischen Herleitung des Wortes und beleuchtet den anthropologischen Kulturbegriff, der die Unterschiede zwischen Menschengruppen durch soziokulturelle Entwicklung erklärt. Die UNESCO-Definition von Kultur wird vorgestellt, die ihre Vielschichtigkeit und Dynamik unterstreicht. Kritisch wird der Gebrauch des Begriffs „Kultur“ zur Ab- und Ausgrenzung in Bezug auf Begriffe wie „Leitkultur“ und „Hochkultur“ diskutiert.
Der neue Rassismus: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Phänomen des „neuen Rassismus“, der sich hinter scheinbar unpolitischen Begriffen wie „Kultur“ oder „Ethnie“ verbirgt. Es wird argumentiert, dass Rassismus oft unbewusst stattfindet und strukturelle sowie institutionelle Ausmaße hat. Das Kapitel untersucht, wie rassistische Denkweisen trotz des Verbots des Begriffs „Rasse“ weiter existieren und sich manifestieren. Beispiele wie die Rede von Achille Demagbo werden analysiert, um zu verdeutlichen, wie vermeintlich unüberwindbare kulturelle Differenzen als Rechtfertigung für Ausgrenzung und Diskriminierung herangezogen werden.
Ethnozentrismus und kulturelle Identität: Dieses Kapitel untersucht Ethnozentrismus als ein zentrales Konzept, das die eigene Kultur als maßgeblich betrachtet und andere Kulturen als unterlegen bewertet. Es wird der Zusammenhang zwischen Ethnozentrismus, der Bildung rassistischer Stereotype und der Verstärkung von Minoritätsgefühlen bei Migrant*innen diskutiert. Der historische Kontext der Ethnologie wird kritisch beleuchtet, um den Einfluss des Kolonialismus und die Entwicklung des Ethnozentrismusbegriffs im Dekolonialisierungsprozess zu verstehen.
Schlüsselwörter
Kulturbegriff, Migration, Interkulturelle Soziale Arbeit, Rassismus, Ethnozentrismus, kulturelle Identität, Zugangsbarrieren, Diskriminierung, migrationssensible Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Zugangsbarrieren für Migrant*innen in der Sozialen Arbeit
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Zugangsbarrieren für Migrant*innen in der Sozialen Arbeit. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Kulturbegriff im Kontext von Migration, dem neuen Rassismus, Ethnozentrismus und der interkulturellen Öffnung der Sozialen Arbeit.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Der Kulturbegriff, Der neue Rassismus, Ethnozentrismus und kulturelle Identität (mit Unterkapiteln zu Ethnozentrismus und kultureller Identität), Zugangsbarrieren (mit Unterkapiteln zu Zugangsbarrieren der Migrant*innen und von Sozialarbeiter*innen), Interkulturelle Öffnung und Fazit.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Arbeit untersucht Zugangsbarrieren für Migrant*innen in der Sozialen Arbeit und beleuchtet den komplexen Kulturbegriff im Kontext von Migration. Ziel ist es, die Herausforderungen der interkulturellen Sozialen Arbeit zu verdeutlichen und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Schwerpunkte liegen auf dem vielschichtigen Kulturbegriff, dem neuen Rassismus und seinen Ausprägungen, Ethnozentrismus und seinen Auswirkungen auf interkulturelle Beziehungen, Zugangsbarrieren für Migrant*innen in der Sozialen Arbeit und Möglichkeiten der interkulturellen Öffnung.
Wie wird der Kulturbegriff behandelt?
Das Dokument analysiert den Kulturbegriff aus verschiedenen Perspektiven, von der etymologischen Herleitung bis hin zur UNESCO-Definition. Kritisch wird der Gebrauch des Begriffs „Kultur“ zur Ab- und Ausgrenzung im Zusammenhang mit Begriffen wie „Leitkultur“ und „Hochkultur“ diskutiert.
Wie wird der „neue Rassismus“ beschrieben?
Das Dokument beschreibt den „neuen Rassismus“ als ein Phänomen, das sich hinter scheinbar unpolitischen Begriffen wie „Kultur“ oder „Ethnie“ verbirgt. Es wird argumentiert, dass Rassismus oft unbewusst stattfindet und strukturelle sowie institutionelle Ausmaße hat.
Welche Rolle spielt Ethnozentrismus?
Ethnozentrismus wird als zentrales Konzept untersucht, das die eigene Kultur als maßgeblich betrachtet und andere Kulturen als unterlegen bewertet. Der Zusammenhang zwischen Ethnozentrismus, der Bildung rassistischer Stereotype und der Verstärkung von Minoritätsgefühlen bei Migrant*innen wird diskutiert.
Welche Zugangsbarrieren werden thematisiert?
Das Dokument thematisiert Zugangsbarrieren von beiden Seiten: die Barrieren, denen Migrant*innen im Umgang mit Sozialarbeiter*innen begegnen, und die Barrieren, die Sozialarbeiter*innen im Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund erfahren.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Kulturbegriff, Migration, Interkulturelle Soziale Arbeit, Rassismus, Ethnozentrismus, kulturelle Identität, Zugangsbarrieren, Diskriminierung und migrationssensible Soziale Arbeit.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Kulturbegriffe in der migrationssensiblen Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/998133