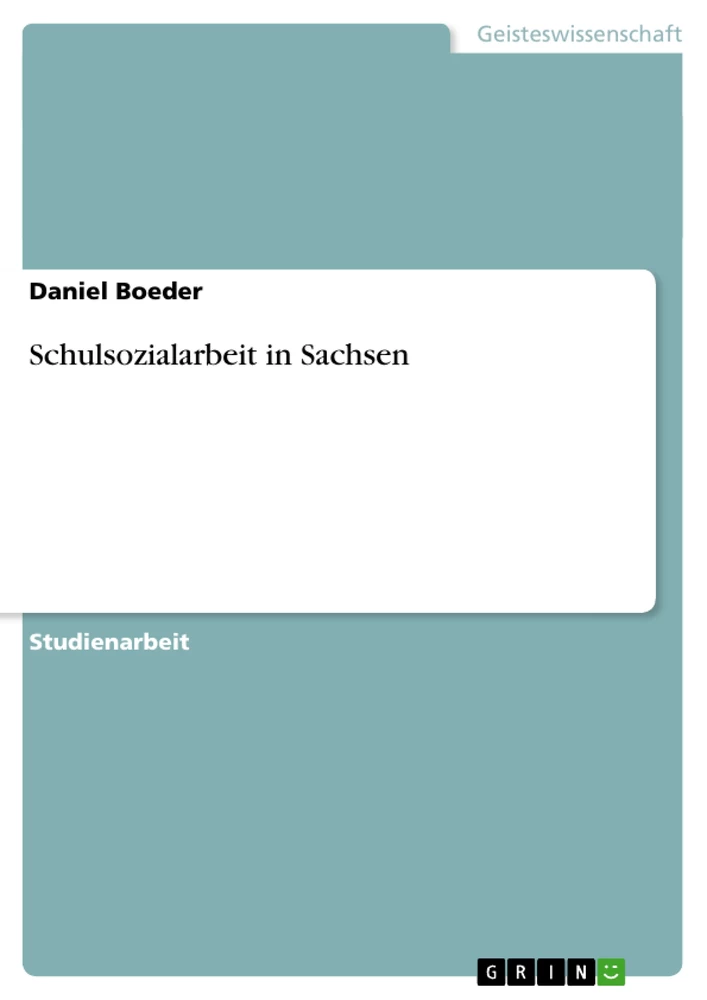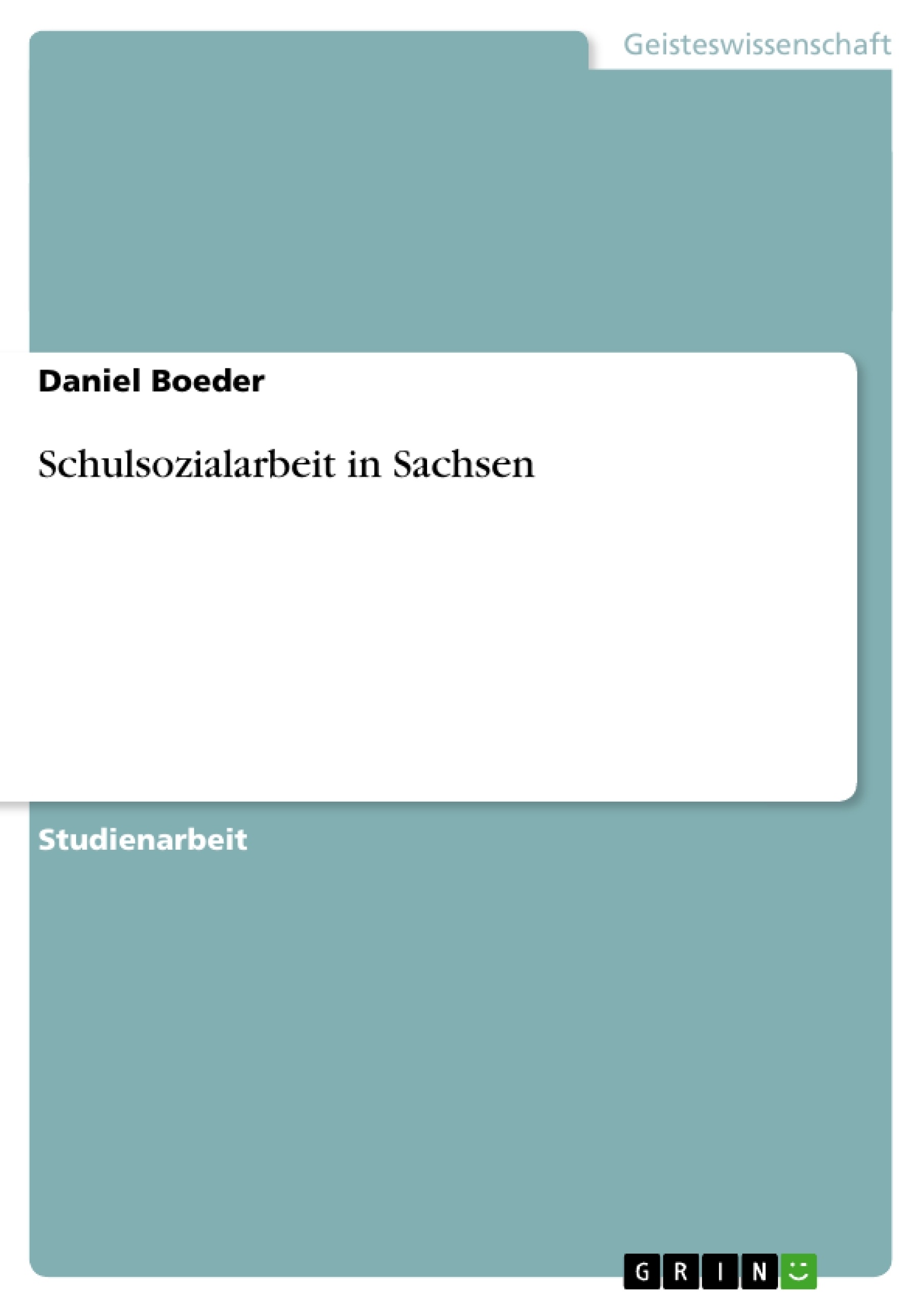Gliederung
1. Einleitung
2. Entwicklung der Schulsozialarbeit in Sachsen
2.1. Rahmenbedingungen
2.2. Gesetzliche Regelungen
2.3. Kooperation - Ansätze und Desiderate
2.4. Konzeption zum Modellversuch der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung
2.5. Schulsozialarbeit im kommunalen Kontext
3. Schlußgedanke
Quellennachweis
1.Einleitung
Schulsozialarbeit rückt immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses, wenn es darum geht, soziale Probleme bei Jugendlichen zu bekämpfen. Erste Versuche entstanden in den alten Bundesländern Deutschlands. Seit den 90er Jahren gibt es auch verschiedene Projekte in den neuen Bundesländern. Genauer gesagt gibt es diese Versuche erst seit der Umstellung des Bildungssystems von Polytechnischen Schulen auf Grundschulen, Gymnasien und Realschulen. Dieses Ereignis brachte viele Probleme für Jugendliche mit sich. Hinzu sind gesellschaftliche Probleme bereits seit der Wiedervereinigung offensichtlich. Im folgenden werden Modelle zur Schulsozialarbeit in Sachsen dargestellt und die Hintergründe dazu erläutert. Basis dafür ist eine Studie zur Schulzozialarbeit in Sachsen der wissenschaftlichen Begleitung, durchgeführt vom Deutschen Jugendinstitut.
2. Entwicklung der Schulsozialarebit
2.1. Rahmenbedingungen
Als Problemlagen, welche eine Schulsozialarbeit in Sachsen notwendig werden lassen, kann man in erster Linie die Einführung des gegliederten Schulsystems in Sachsen ansehen. Ab dem Schuljahr 1992/93 wurden die Polytechnischen Oberschulen in Sachsen in Grundschulen, Realschulen und Gymnasien umgewandelt. Diese Umwandlung trug dazu bei, gesellschaftliche Problemlagen, die seit der Wende ohnehin schon bestanden, zu schüren. Mit einer sich verschärfenden Situation an Sachsens Schulen, begann man sich Gedanken zu machen, wie dem beizukommen sei und gleichzeitig das neue Schulsystem mit der Mittelschule als Kernstück attraktiv zu machen. Dazu riet auch der sogenannte ,,Runde Tisch gegen Gewalt". Desweiteren wurde gefordert, daß Lehrern die Möglichkeit gegeben werden muß, ihre Erfahrungen mit anderen Lehrern auszutauschen, um gemeinsam Problemlösungen zu erarbeiten. Auch die Schulaufsichtsbehörde schloß sich dieser Meinung an und forderte baldmöglichstes Handeln. Es entstand das Projekt ,,Problemschüler an Mittelschulen" unter der Zusammenarbeit vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus und diversen Institutionen (Schulen, Städte, Vereine und andere). Ziel sollte es sein die betroffenen Schüler sowohl in ihrem sozialen als auch in ihrem schulischen Umfeld zu stärken. Hierbei sollten Sozialpädagogen Unterstützung leisten. Überdies sollte ein Übergang ins Berufsleben ermöglicht sowie Sozialverhalten gegenüber anderen verbessert werden. Etwas später wurde dieses Projekt um eine Idee erweitert, nämlich der, die Schulatmosphäre generell zu verbessern.
Nachdem die Schulen aufgefordert wurden, vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus, im Folgenden übrigens SMK genannt, personelle und finanzielle Hilfen zu fordern, wurden sowohl 54 Lehrerstunden mehr, sowie ein Sozialpädagoge und Honorarkräfte beantragt. Die Schwerpunkte wurden noch einmal geändert und es kam zu einer erweiterten Form des ersten Projekts. Es entstand ein Modellversuch der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung (BLK) namens ,,Handlungsmöglichkeiten von Lehrern und Sozialpädagogen zur Überwindung von Schwierigkeiten benachteiligter Kinder und Jugendlicher in sozialen Brennpunkten", welcher im April 1994 eingerichtet wurde und zum Ziel hat, denen am Projekt beteiligten Mittelschulen sozialpädagogische Kompetenzen zu verleihen.
Das SMK beteiligte sich an der Konzeption des Modellversuchs mit folgenden Ansätzen:
- auf den einzelnen Schüler ausgerichtete Unterstützung bei außerschulischen Problemen
- Kooperation mit sozialpädagogischen Institutionen
- außerunterrichtliche sozialpädagogische Angebote
- Hilfen bei der Persönlichkeitsentwicklung, sowie Lernhilfen mittels Unterricht
- Einzelfallhilfe und soziale Gruppenarbeit
Hierbei sind Lehrer als Fachkräfte vorgesehen, da nicht genügend Sozialarbeiter zur Verfügung stehen. Es ist eine präventive Hilfe vorgesehen.
Zusätzlich sind an dem Projekt beteiligten Schulen 54 Unterrichtsstunden zugesichert, die zur Erfüllung von sozialpädagogischen Aufgaben von den bereits vorhandenen Lehrern vorgesehen sind. Hierbei geht man von einer bisherigen Nichtauslastung der vorhandenen Lehrer aus.
Die wissenschaftliche Begleitung soll helfen, die Zielgruppe konkret zu beschreiben. Als Zielgruppe werden Schüler gesehen, die noch die Schule besuchen, jedoch gefährdet sind, die Schule zu verlassen, was zu Folge haben kann, daß sie nicht nur zu Schulaussteigern, sondern auch zu gesellschaftlichen Aussteigern werden. In den Vorstellungen der SMK werden diejenigen, welche bereits die Schule vorzeitig verlassen haben außer acht gelassen. In den Mittelpunkt des Interesses geraten sozial benachteiligte, verhaltensauffällige Schüler mit Sozialisations- und Lernproblemen. Hier soll präventiv geholfen werden, indem die Schule so gestaltet werden soll, daß sie für betroffene Schüler zu einem neuen Lebensraum wird, an dem sie sich sozial akzeptiert fühlen sollen und ihre Alltagsprobleme bewältigen können. Ziel ist eine gesteigerte Fähigkeit im Bildungswettbewerb mitzuhalten und sich sozial zu integrieren. Inwieweit die Schulen dazu fähig sind hängt zum einen von den jeweiligen Handlungsstrategien, als auch von der Intensität der Zusammenarbeit mit betreffenden Eltern und anderen sozialen Einrichtungen.
Mit Hilfe einer wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuches soll die Entwicklung desselbigen analysiert werden. Anhand der erfaßten Daten, sollen neue Handlungsstrategien entdeckt werden, mit denen das Modell verbessert werden kann.
Eines der verschiedenen Datenerhebungsverfahren ist die Befragung, bei der Eltern, Lehrer und Schüler mit den Erfahrungen, die sie mit dem Projekt gemacht haben, konkret Informationen liefern, inwieweit der Modellversuch im Sinne der Konzeption erfolgreich war und wie Verbesserungen eingebracht werden können.
2.2. Gesetzliche Regelungen
Im Grunde gibt es in Sachsen eigentlich keine konkrete Regelung, die Schulsozialarbeit eine feste Rechtsgrundlage bietet.
Laut Sächsischem Ausführungsgesetz zu SGB VIII sind das Kultusministerium und das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Familie die zwei Obersten Landesjugendbehörden, die für Jugendarbeit und Jugendverbände zuständig sind. In Anlehnung an §13 des KJHG ist das Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Familie die Oberste Landesjugendbehörde in Angelegenheiten der Jugendsozialarbeit.
Das bedeutet nun, daß dagegen für Jugendarbeit das Kultusministerium zuständig ist. Eine Abgrenzung der beiden Tätigkeitsbereiche ist schwierig. Da keine richtige Kooperation zwischen diesen beiden Staatsministerien herrscht, ist ein einheitliches Programm nicht möglich. Beide Ministerien erarbeiten statt dessen in Eigeninitiative Problemlösungen, die nicht auf die Lösungen des anderen Ministeriums abgestimmt sind. Fragen des Bedarfs und der Finanzierung, die sich den Kommunen stellen, werden auf Landesebene von zwei verschiedenen Behörden bearbeitet. Die beiden Lösungsvorschläge müssen nun von den Kommunen wieder auf einen Nenner gebracht werden.
Um generell die Stellung von Schulsozialarbeit in Sachsen zu legitimieren und zu festigen soll die Verabschiedung des Landesjugendplanes dienen. Auch eine Erneuerung des Landesgesetzes soll zur Etablierung von Schulsozialarbeit in Sachsen beitragen.
2.3. Kooperation - Ansätze und Desiderate
Zwar ist eine Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schulen vorgesehen, jedoch gestaltet sich dieser Grundsatz als äußerst problematisch., da fortlaufend gravierende Verständigungsprobleme auftreten. Laut Sozialarbeitern sind die Schulen nicht imstande, soziale Probleme von Schülern rechtzeitig zu erkennen, so daß die Jugendhilfe erheblich zu spät eingeschaltet wird, so daß eher eine Abschiebung sozial benachteiligter Schüler die Konsequenz ist. Eine rechtzeitigere Zusammenarbeit zwischen Schulen und Jugendhilfe sollte solche Fälle verhindern. Hier sollte von seiten der zuständigen Staatsministerien Empfehlungen zur besseren Zusammenarbeit gemacht werden. Um dies zu erreichen, sollte die Jugendhilfe bereits während des Schulbetriebs sozialpädagogische Angebote schaffen. Da laut Kultusminister Rößler ,,die Schulgebäude hervorragende Rahmenbedingungen für Freizeitangebote am Nachmittag bieten, da zu dieser Zeit die Räume gar nicht oder nur wenig genutzt werden" ist eine passende Grundlage für diesen Denkansatz bereits vorhanden.
Wie die ausgearbeiteten Ideen und Planungen der Schulsozialarbeit nun definitiv aussehen sollen, wird im Folgenden aufgezeigt.
2.4. Konzeption zum Modellversuch der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung
,,Handlungsmöglichkeiten von Lehrern und Sozialpädagogen zur Überwindung von Schwierigkeiten benachteiligter Kinder und Jugendlicher in sozialen Brennpunkten" Diese Konzeption soll einen Handlungsrahmen zur Erarbeitung von Handlungsstrategien der Schulen liefern.
Legitimiert ist dies durch das sächsische Schulgesetz, den neunten Jugendbericht, das KJHG und durch Vorschläge der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter aus dem Jahr 1993. Ziele sollen sein:
- Soziale Benachteiligungen bedingt durch gesellschaftliche Veränderungen, welche eine Abschiebung der betroffenen Schüler zur Folge haben kann, abzubauen. Diese Benachteiligungen können das Sozial- und Lernverhalten entscheidend beeinflußen.
- Schule soll neben ihrem Lehrauftrag zu einem Ort werden, an dem sich Schüler wohl fühlen können.
- Es soll bei der Bewältigung von Alltagsproblemen Hilfestellung geleistet werden.
- Es soll den Schülern ein Verantwortungsgefühl für ihr eigenes Leben übermittelt werden.
- Schule soll über Flexibilität verfügen.
Deswegen sollen folgenden Grundsätze gelten:
- Prävention von Schulversagen
- Hilfen zur Alltagsbewältigung
- Integration statt Selektion
- Förderung von Eigeninitiative
- Nutzung von Kooperationsmöglichkeiten
Dies soll möglich gemacht werden, durch Ganztagesangeboten. Leistungen dieses Programms könnten sein:
- Hausaufgabenbetreuung
- Nachhilfestunden
Damit die Schüler auf das Leben nach der Schulzeit gut vorbereitet sein werden, soll den Schülern Beratung angeboten werden, welche den Schülern eine Erleichterung der Berufswahl ermöglichen soll.
In den letzten beiden Schuljahren soll dies unter Mitarbeit der Schüler selbst erarbeitet werden. Hierbei soll außerdem mit außerschulischen potentiellen Anbietern von Ausbildungsplätzen zusammengearbeitet werden.
Auch beim Übergang von der Grund- zur Mittelschule soll den Schülern Unterstützung geleistet werden, indem Grundschul- und Mittelschullehrer eng zusammenarbeiten.
Gemeinsame Veranstaltungen könnten beispielsweise den Rahmen dafür bieten.
Auch soll auf die individuellen Bedürfnisse und Probleme der Schüler eingegangen werden. Um dies zu verwirklichen muß zuallererst eine Vetrauensbasis geschaffen werden. Zweck dessen soll es sein, daß Schüler diese Einrichtung nicht zwanghaft in Anspruch nehmen, sondern daß sie freiwillig den Beratungsdienst aufsuchen, wenn sie Probleme haben. Hierdurch soll eine ,,Vermittlungsinstanz" zwischen Eltern und Lehrern entstehen, welche sozusagen eine ,,Anwaltfunktion" übernehmen soll. Auch sollen ,,andere Kompetenzen und Lebensweltbezüge in die Schule geholt werden". Zuletzt ist den Lehrern zu ermöglichen, in schwierigen Fällen selbst beraten zu werden.
Auch im Freizeitbereich, das heißt die Zeit nach der Schule, sollen verschiedene vernünftige und sinnvolle Angebote gemacht werden.
Beispiel für die gebundene Freizeit wären eventuell Arbeitsgemeinschaften oder Hobbykurse. Am Ende sollte dann ein Ergebnis zu sehen sein, wie beispielsweise eine Aufführung. Sinn und Zweck sowohl der gebundenen als auch der ungebundenen Freizeit soll es sein, Spiel oder Erholung in einem pädagogischen Rahmen anzubieten.
Der Brauch von bestimmten Jahresereignissen an der Schule (zum Beispiel: Sommer- oder Sportfest) soll das Gefühl eines gewissen Höhepunktes erwecken, welches sich wiederum positiv auf das Verhältnis der Schüler zur Schule auswirken soll.
Außerdem soll auf Mittags- und Pausenversorgungen nicht verzichtet werden, um auch einen gesundheitspädagogischen Aspekt zu erfüllen und die Elternhäuser zu entlasten. Um dies alles realisieren zu können sind diverse räumliche Beschaffenheiten der Schulen voraussetzlich.
Es sollten folgende Bereiche in Betracht gezogen werden:
- ,,Erholungs- und Zertreuungsbereich"
- ,,Lern- und Beratungsbereich"
- ,,Begegnungsbereich"
- ,,Aktionsbereich"
- ,,Orientierungs- und Selbsterfahrungsbereich"
Am 19.12.1995 gründete sich die Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit in Sachsen. Sie sollte von nun an zentrale Anlaufstelle für sämtliche Interessenten an Schulsozialarbeit in Sachsen sein. Bei ihrer Gründung beschloss die Arbeitsgemeinschaft gleich ein Grundsatzpapier, welches mit der BLK-Konzeption im Wesentlichen übereinstimmt. Ergänzt werden in diesem Grundsatzpapier strukturelle Rahmenbedingungen einer Schulsozialarbeit.
Es werden Aussagen über die Träger gemacht, welche sein können:
- ,,anerkannte freie Träger der Jugendhilfe"
- ,,örtliche Träger deröffentlichen Jugendhilfe"
- ,,kreisangehörige Städte und Gemeinden"
Auch wird die notwendige Kooperation von Schulamt und Jugendamt explizit hervorgehoben. Personelle Vorstellungen werden auch dargestellt; nämlich daß jede betroffene Schule Anspruch auf zwei Sozialpädagogen hat.
Um dem qualitativen Anspruch der Schulsozialarbeit gerecht zu werden, wird Fortbildung und Supervision als Mittel dafür festgelegt. Hierfür beitet die Landesarbeitsgemeinschaft in regelmäßigen Zeitabständen Fortbildungsveranstaltungen an.
Die Vorstellungen über die räumlichen Voraussetzungen decken sich wieder mit der BLKKonzeption.
2.5. Schulsozialarbeit im Kommunalen Kontext
Beispiel Leipzig:
Das Dezernat Jugend, Schule und Sport in Leipzig ist für das Arbeitsfeld Schule und Jugend zuständig. Seit 1992 besteht die Arbeitsgruppe ,,Vernetzung", die sich aus verschiedenen Personen zusammensetzt, die mit Kindern und Jugendlichen Kontakt haben. Seit einer Fachtagung im November 1994 wurden wichtige Ansätze zur Zusammenarbeit zwischen Schulen und Jugendhilfe erarbeitet. Seit 1995 gibt es einen Arbeitskreis ,,Schulsozialarbeit" welcher sich aus Sozialarbeitern von Leipzigs Schulen zusammensetzt. Bei der Schaffung von Schulsozialarbeitsprojekten, wird dem Arbeitskreis vom Dezernenten für Schule, Jugend und Sport maßgeblich unter die Arme gegriffen. Als Ergebnis dieser Unterstützung wurden bereits 8 Stellen bei freien Trägern geschaffen wurden, welche durch Kommunen und Land finanziert werden.
Im Januar 1996 bewilligte das Schulverwaltungsamt die finanziellen Mittel zur Einrichtung von Schulclubs, in welchen gemäß den Vorstellungen des Jugendamtes Schulsozialarbeit geleistet werden soll. Schulsozialarbeit wurde offiziell Bestandteil der Kommunalen Jugendhilfe. Als Rechtsgrundlage dient der §13 KJHG. Zielgruppe dieser Schulsozialarbeit sind in erster Linie Schüler und Schülerinnen der Mittelschulen. Eventuell könnten auch Schüler von Grund-, Berufs- und Förderschulen Empfänger von Schulsozialarbeit sein. Ziele der Schulsozialarbeit in Leipzig sind:
- ,,offene Freizeitangebote"
- ,,ganzheitliche, persönlichkeitsstärkende oder problemorientierte Informations- und Bildungsangebote"
- ,,soziale Gruppenarbeit"
- ,,Beratung"
- ,,Einzelfallhilfe"
- ,,Vermittlung und Begleitung zu spezialisierten Hilfsangeboten"
Diese Aufgaben sind von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen zu übernehmen.
Seit August 1995 wird an 9 Mittelschulen, einer Grundschule und einer Förderschule von 8 freien Trägern Schulsozialarbeit praktiziert. Zur Verfügung stehen 17 feste Arbeitskräfte (davon 9 ABM-Stellen).
Um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu garantieren, bestehen Kooperationsverträge zwischen Schulen und Trägern.
Beispiel Dresden:
In Dresden unterliegt der Arbeitsbereich Jugend dem Dezernat Kultur und Jugend, welches wiederum Teil des Schulverwaltungsamtes ist.
1993 wurde das erste Schulsozialarbeitsprojekt Dresdens gestartet. Ursache dafür waren die Erfahrungsberichte diverser Straßensozialarbeiter, welche einen dringenden Bedarf erkannten. Den Grund für die Notwendigkeit von Schulsozialarbeit sahen die Sozialarbeiter in einer scheinbar offensichtlichen Überforderung der Lehrer im Bezug auf soziale Probleme von Schülern. Eine Unterstützung von seiten der Jugendhilfe wäre von den Lehrkräften nicht vollständig akzeptiert. Nährboden für diese Situation sei das Nichtbestehen eines expliziten Kooperationsvertrages zwischen Schule und Sozialarbeitern.
Daraus ergab sich ein Bericht mit grundlegenden Forderungen der Sozialarbeiter, um einen Erfolg im Sinne der Schulsozialarbeit zu ermöglichen. Dabei heißt es, daß eine Zusammenarbeit sowohl zwischen Schulamt und Jugendamt, als auch zwischen Träger und Schule vertraglich festgelegt werden müsse. Hierbei soll sich die Zusammenarbeit aber nicht nur auf den Vertrag stützen, sondern muß von beiden Parteien wirklich erwünscht sein. Überdies sollten gemeinsame Fortbildungen möglich gemacht werden. Weiter solle eine Mitarbeit an Projekten von seiten der Lehrer, die Lehrer selbst mit in die Schulsozialarbeit einbinden. Außerdem sollte die Arbeitsstelle der Sozialarbeiter vertraglich gesichert sein.. Ab dem Jahr 1995 wurden im Stadtgebiet Dresden 2 Schulsozialarbeitsprojekte eingerichtet, die jeweils von einer Fachkraft geleitet werden. Träger sind ein Schulförderverein und ein weiterer freier Träger. Überdies werden in 5 Stadtteilen Dresdens weitere Projekte in Form eines Clubs geführt, welcher vom Jugendamt getragen wird.
Beispiel Zwickau:
In Zwickau unterliegt das Jugendamt dem Dezernat Gesundheit, Soziales und Jugend. Diesem Dezernat gehört das Schulverwaltungsamt an, welches für die Schulen zuständig ist. Im August 1993 wurde eine ,,Rahmenkonzeption zum Aufbau der Schulsozialarbeit" durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen. Hiermit sollte den diversen Problemen, welche sich aus der Wende ergaben und sowohl Schüler als auch generell Jugendliche betreffen, entgegengewirkt werden. Der Beschluß stützt sich auf §§ 1, 11, 13, 14 KJHG. Ziele sollen sein:
- ,,koordinierende und kooperative Tätigkeit mit Ämtern, Institutionen und freien Trägern.
- ,,individuelle Lernförderung in Klassen 7 bis 9"
- ,,Einzelfallhilfe und soziale Gruppenarbeit"
- ,,offene Freizeitangebote in der Schule"
- ,,Angebote zur Unterstützung des Übergangs Schule-Beruf"
- ,,Veranstaltungen, Seminare und Projektarbeit"
- ,, Gespräche mit Lehrern, Eltern und Schülern"
-,, beobachtende Teilnahme an schulischen Veranstaltungen"
Hierbei sollen Schüler ab der 5. Klasse der Mittelschule angesprochen werden, wobei schulische und sozialpädagogische Aufgabenstellung klar getrennt sein sollen.
Die Durchführung der Schulsozialarbeit unterliegt dem freien Träger der Jugendhilfe, währenddessen allerdings die betroffenen Schulen vom Schulamt ausgewählt werden.
Auch hier soll ein zwischen dem Träger der Jugendhilfe, dem staatlichen Schulamt und dem Jugendamt ein Kooperationsvertrag bindend sein.
Vorgesehen ist pro Schule jeweils ein Sozialpädagoge und zwei Honorarkräfte. Die Finanzierung wird übernommen von Mitteln des kommunalen Jugendamtes, vom Freistaat Sachsen, vom Land und durch AFG-Mittel nach §97 oder §249.
Seit 1995 wird nun an der Dr. Theodor-Neubauer-Mittelschule in Zwickau-Eckersbach Schulsozialarbeit angeboten. Ein Kooperationsvertrag verteilt die Zuständigkeiten bei diesem Projekt. Der neue Jugendhilfeplan sieht Schulsozialarbeit an einer weiteren Mittelschule vor, wobei allerdings derselbe Träger fungieren soll. Es ist also keine Trägerpluralität erwünscht.
3.Schlußgedanke
Es wurde gezeigt, daß zur Realisierung der Schulsozialarbeit zwar sicherlich brauchbare Konzepte vorliegen, die Verwirklichung dieser Probleme jedoch schwieriger ist als geplant. Das größte Problem stellt wohl die mangelhafte Zusammenarbeit zwischen Schulen und Jugendhilfe dar, wobei eine generelle Abwehrhaltung wohl eher von den Sclulen ausgeht. Sie befürchten vermutlich einen Eingriff der Sozialarbeitern in ihre Kompetenzen als Unterrichtende. Es muß noch viel geschehen, daß Schulsozialarbeiter die Kompetenzen erreichen, wie es vorgesehen ist. Sie sollten nicht mehr nur gesehen werden als eine Art ,,Feuerwehr", wie es von einem Schulsozialarbeiter in seinem Bericht über ein Schulsozialarbeitsprojekt beschrieben wurde. Damit meinte er, daß die Sozialarbeiter erst geholt wurden, wenn es zu spät ist, das heißt, wenn ein soziales Problem bereits entstanden ist. Es wurde sozusagen ein ,,Feuerwehreinsatz" gefahren. Jedoch ist dies ja aber nicht das Ziel der Schulsozialarbeit. Ein wichtiger Grundsatz der Schulsozialarbeit ist ja die Prävention.
Die Etablierung von Schulsozialarbeit ist davon abhängig, wie erfolgreich Projektversuche sind. Über Ergebnisse der in dieser Arbeit beschriebenen Projekte kann ich keine Aussagen machen, da mir hierfür kein Matrial zugänglich ist. Jedoch ist es wünschenswert, daß diese Projekte einigermaßen Erfolg mit sich gebracht haben, so daß die Akzeptanz gegenüber Schulsozialarbeit steigt damit es zu einer festen Etablierung derselbigen kommt.
Quelle:
Grit Elsner, Schulsozialarbeit in Sachsen
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck der Schulsozialarbeit in Sachsen, wie in dieser Studie dargestellt?
Die Schulsozialarbeit soll soziale Probleme bei Jugendlichen bekämpfen, insbesondere im Kontext der Veränderungen des Bildungssystems und der gesellschaftlichen Herausforderungen seit der Wiedervereinigung. Ziel ist es, Modelle zur Schulsozialarbeit in Sachsen darzustellen und die Hintergründe zu erläutern. Grundlage dafür ist eine Studie zur Schulsozialarbeit in Sachsen der wissenschaftlichen Begleitung, durchgeführt vom Deutschen Jugendinstitut.
Welche Rahmenbedingungen führten zur Entwicklung der Schulsozialarbeit in Sachsen?
Die Einführung des gegliederten Schulsystems (Grundschulen, Realschulen, Gymnasien) ab 1992/93 führte zu Problemlagen, die Schulsozialarbeit notwendig machten. Dies verschärfte bestehende gesellschaftliche Probleme seit der Wende. Das Projekt ,,Problemschüler an Mittelschulen" entstand zur Stärkung betroffener Schüler in ihrem sozialen und schulischen Umfeld, unterstützt durch Sozialpädagogen.
Was sind die wichtigsten Punkte des Modellversuchs der Bund-Länder-Kommission (BLK) zur Schulsozialarbeit?
Der Modellversuch ,,Handlungsmöglichkeiten von Lehrern und Sozialpädagogen zur Überwindung von Schwierigkeiten benachteiligter Kinder und Jugendlicher in sozialen Brennpunkten" (ab April 1994) hatte zum Ziel, den beteiligten Mittelschulen sozialpädagogische Kompetenzen zu verleihen. Das Sächsische Staatsministerium für Kultus (SMK) beteiligte sich mit Ansätzen wie individueller Unterstützung, Kooperation mit sozialpädagogischen Institutionen, außerunterrichtlichen Angeboten, Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und Einzelfallhilfe.
Gibt es konkrete gesetzliche Regelungen für Schulsozialarbeit in Sachsen?
Es gibt keine feste Rechtsgrundlage für Schulsozialarbeit in Sachsen. Das Sächsische Ausführungsgesetz zu SGB VIII weist dem Kultusministerium und dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Familie unterschiedliche Zuständigkeiten für Jugendarbeit bzw. Jugendsozialarbeit zu. Eine mangelnde Kooperation zwischen den Ministerien erschwert ein einheitliches Programm. Die Verabschiedung des Landesjugendplanes und eine Erneuerung des Landesgesetzes sollen zur Etablierung von Schulsozialarbeit beitragen.
Wie gestaltet sich die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schulen in Sachsen?
Die Zusammenarbeit ist problematisch aufgrund von Verständigungsproblemen. Sozialarbeiter bemängeln, dass Schulen soziale Probleme von Schülern oft zu spät erkennen. Eine rechtzeitigere Zusammenarbeit sollte durch Empfehlungen der Ministerien und sozialpädagogische Angebote während des Schulbetriebs gefördert werden.
Was beinhaltet die Konzeption zum Modellversuch der BLK genauer?
Die Konzeption ,,Handlungsmöglichkeiten von Lehrern und Sozialpädagogen zur Überwindung von Schwierigkeiten benachteiligter Kinder und Jugendlicher in sozialen Brennpunkten" soll einen Handlungsrahmen zur Erarbeitung von Handlungsstrategien der Schulen liefern. Ziele sind der Abbau sozialer Benachteiligungen, die Förderung des Wohlfühlens in der Schule, Hilfestellung bei Alltagsproblemen und die Vermittlung von Verantwortungsgefühl. Grundsätze sind Prävention von Schulversagen, Hilfen zur Alltagsbewältigung, Integration statt Selektion und Förderung von Eigeninitiative.
Welche Angebote sind im Rahmen der Schulsozialarbeit geplant?
Es sind Ganztagesangebote wie Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfestunden geplant. Beratung soll die Berufswahl erleichtern. Unterstützung wird auch beim Übergang von der Grund- zur Mittelschule angeboten. Individuelle Bedürfnisse sollen durch eine Vertrauensbasis und eine "Vermittlungsinstanz" zwischen Eltern und Lehrern berücksichtigt werden. Freizeitangebote sollen Spiel und Erholung in einem pädagogischen Rahmen bieten.
Wie ist die Schulsozialarbeit im kommunalen Kontext in Leipzig, Dresden und Zwickau organisiert?
Leipzig: Die Arbeitsgruppe ,,Vernetzung" und der Arbeitskreis ,,Schulsozialarbeit" fördern die Zusammenarbeit. Stellen bei freien Trägern wurden geschaffen, finanziert durch Kommunen und Land. Schulsozialarbeit ist offiziell Bestandteil der Kommunalen Jugendhilfe. Dresden: Das Dezernat Kultur und Jugend im Schulverwaltungsamt ist zuständig. Erste Projekte entstanden 1993 aufgrund von Überforderung der Lehrer und mangelnder Kooperation. Eine vertragliche Festlegung der Zusammenarbeit wird gefordert. Zwickau: Das Jugendamt im Dezernat Gesundheit, Soziales und Jugend ist zuständig. Eine ,,Rahmenkonzeption zum Aufbau der Schulsozialarbeit" wurde 1993 beschlossen, um Problemen aus der Wende entgegenzuwirken. Kooperationsverträge sind bindend.
Was ist das Fazit der Studie zur Schulsozialarbeit in Sachsen?
Die Realisierung der Schulsozialarbeit ist schwieriger als geplant, vor allem aufgrund der mangelhaften Zusammenarbeit zwischen Schulen und Jugendhilfe. Sozialarbeiter sollten nicht nur als "Feuerwehr" agieren, sondern präventiv tätig sein. Die Etablierung der Schulsozialarbeit hängt vom Erfolg der Projektversuche ab.
- Quote paper
- Daniel Boeder (Author), 1997, Schulsozialarbeit in Sachsen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99715