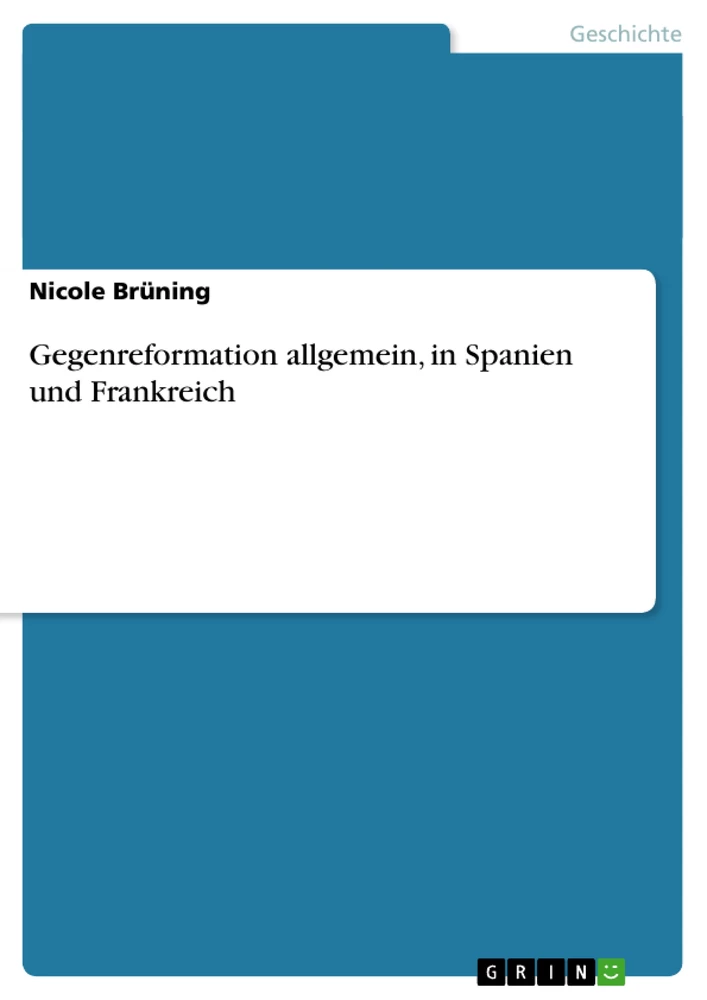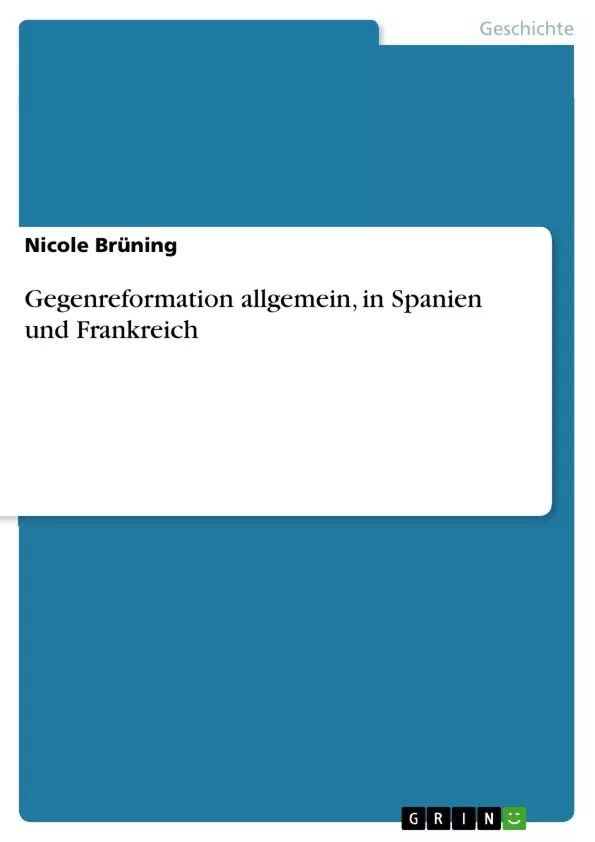Was ist die Gegenreformation in Frankreich und Spanien?
Die Gegenreformation war eine Bewegung innerhalb der katholischen Kirche im 16. und 17. Jahrhundert, die versuchte, dem Protestantismus entgegenzuwirken und protestantisch gewordene Gebiete zu rekatholisieren. Sie entstand teilweise aus innerkatholischen Erneuerungsbestrebungen, erhielt aber entscheidende Impulse durch die Auseinandersetzung mit dem Protestantismus.