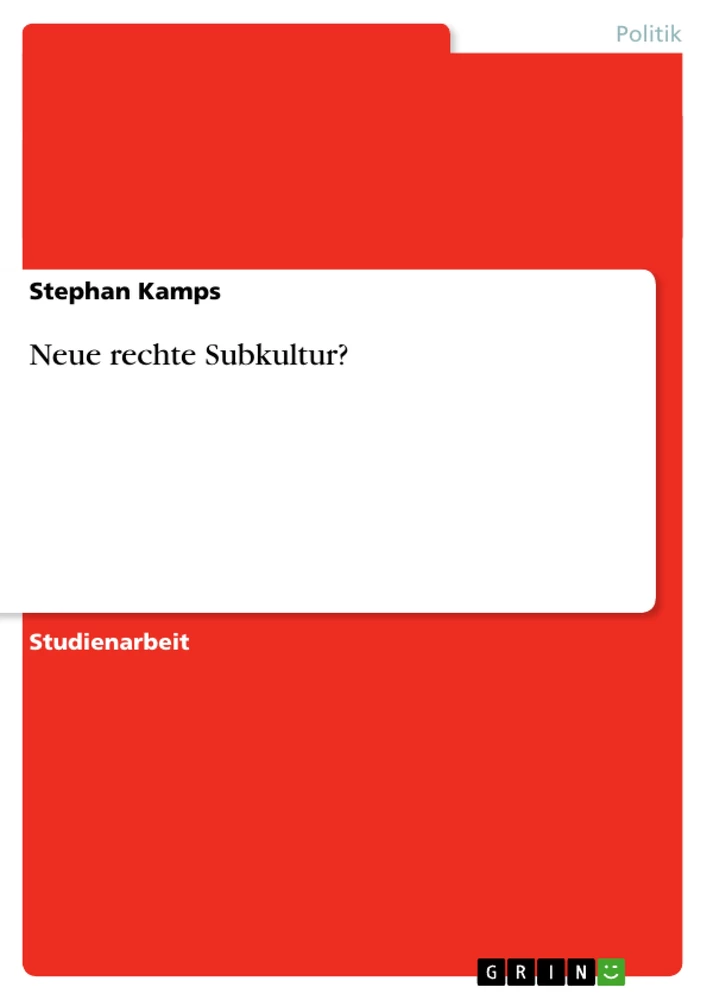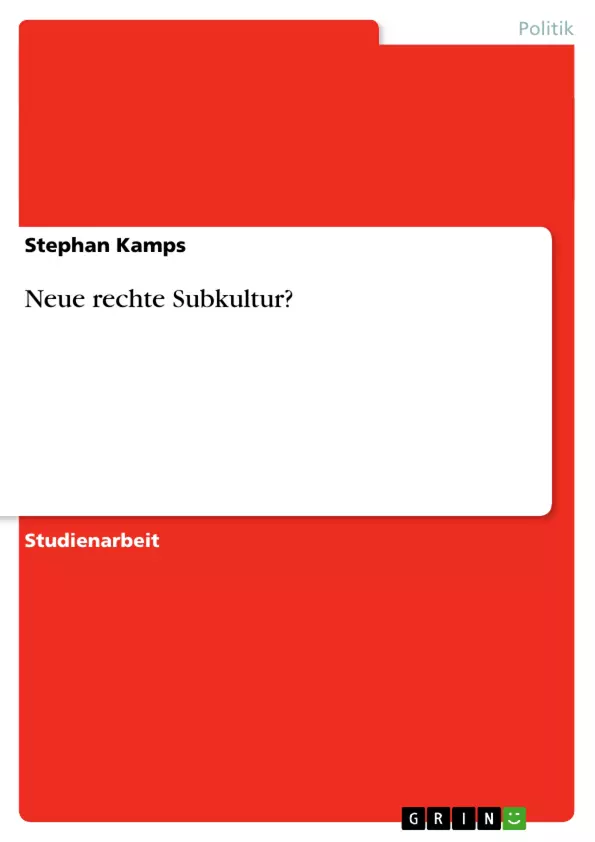Inhalt
EINLEITUNG
1 ÜBERLEGUNGEN ZUR ENTSTEHUNG DER RECHTEN JUGENDSZENE
1.1 Ausdifferenzierung und Modernisierung des rechten Lagers
1.2 Die neue rechte Jugendszene - eine neue Subkultur?
2 KULTURSOZIOLOGISCHE MERKMALE UND KOMMUNIKATIONSMITTEL DER RECHTEN JUGENDSZENE MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER SKINHEAD-SZENE
2.1 Strukturen und Kommunikationsmittel
2.2 Die Skinhead-Szene als hervorstechendes Merkmal rechter Jugendkultur
2.2.1 Ursprünge der Skinheadbewegung
2.2.2 Die deutsche Skinheadszene
3 (SUB-)KULTURELLE FUNDAMENTALOPPOSITION NACH DEM MUSTER DER LINKEN SUBKULTUR?
SCHLUß
LITERATUR
Einleitung
Seit Mitte der achtziger Jahre ließ sich ein Anwachsen rechtsextremer Bestrebungen auf verschiedenen parteipolitischen und gesellschaftlichen Ebenen beobachten. Zumindest was ihre Medienpräsenz betrifft, erreichten diese Aktivitäten in den Jahren nach 1989 einen vorläufigen Höhepunkt. ”Die Themen der neunziger Jahre werden Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit, Nationalismus [...] sein” (zit. nach Pfahl-Traughber 1993: 11), lautete 1992 die Prognose des Leiters der Hamburger Verfassungsschutzbehörde, Ernst Uhrlau. Während lange Zeit hauptsächlich der Linksextremismus im Blickfeld von Verfassungsschutz und Öffentlichkeit stand (vgl. Bundesministerium des Innern 1994, sowie Endlich/Grix/Willberg 1990: 5 ff.), erregten nun die zunehmenden Gewalttaten am anderen extremen Rand des politischen Spektrums Aufmerksamkeit. Es entwickelte sich ähnlich wie bei den ”Punks” und ”Autonomen” in den siebziger und achtziger Jahren, die mit anarchistischen und linksextremistischen Parolen zu provozieren versuchten, eine rechte Jugendszene, die eine eigene Musik, eine eigene kommunikative Symbolik, eigene Fanzeitschriften und eine spezielle Art zu Leben für sich beansprucht. Nicht nur für die Medien und den Verfassungsschutz stellen dabei die sogenannten ”Skinheads” eine der markantesten Erscheinungsformen in diesem Umfeld dar.
Diese Arbeit soll einen Überblick schaffen über die soziokulturelle Struktur und die Kommunikationsmittel der rechten Jugendszene und steht unter folgender Leitfrage: Handelt es sich bei dieser rechtsextremen Jugendbewegung tatsächlich um eine eigenständige neue Subkultur, die auf ähnliche Weise wie einst die Linke Fundamentalopposition gegen das politische System der Bundesrepublik Deutschland betreibt? Obwohl es nicht Aufgabe dieser Arbeit sein soll, soziologische Erklärungen zu liefern, werden Ansätze aus der Literatur dazu in aller Kürze angerissen.
1 Überlegungen zur Entstehung der rechten Jugendszene
1.1 Ausdifferenzierung und Modernisierung des rechten Lagers
Die Geschichte der Bundesrepublik zeigt, daß Rechtsextremismus und Neonationalsozialismus keine Phänomene sind, die erst in den achtziger Jahren auftauchten, auch wenn in der Literatur Einigkeit darüber besteht, daß in dieser Zeit eine Zunahme derartig ausgerichteter Bestrebungen erkennbar wurde (vgl. Einleitungen zu Pfahl-Traughber 1993: 11 ff., Bergmann/Erb 1994: 7 ff., Endlich/Grix/Willberg 1990: 5 ff. u.a.). Nach Bergmann/Erb hat die Bundesrepublik mehrere Phasen ”rechtsextremer Mobilisierung” erlebt (Bergmann/Erb 1994: 7). So erzielte zum Beispiel die ”Nationaldemokratische Partei Deutschlands” (NPD) 1966 und 1967 beachtliche Erfolge bei einigen Landtagswahlen. Vor allem in den siebziger Jahren wurden kleinere terroristische Vereinigungen, die sich ”Wehrsportgruppen” nannten, aktiv. Rechtsextremistische Aktionen wurden jedoch lange Zeit für ”unsere Demokratie nie wirklich als bedrohlich empfunden” (Endlich/Grix/Willberg 1990: 5):
”Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus war[en] ein Problem des Verfassungsschutzes und der Polizei. Lange Zeit stand der Linksextremismus im Blickfeld der Öffentlichkeit, vor allem die ‘Rote Armee Fraktion’ (RAF) mit ihren gewalttätigen Aktionen” (Endlich/Grix/Willberg 1990: 5).
Die gegenwärtige Situation unterscheidet sich allerdings von den vorangegangenen.
(a) hat sich das soziale Spektrum verbreitert. Auffallend ist das in der Literatur durchweg konstatierte Anwachsen der Zahlen jugendlicher Mitläufer, Sympathisanten und Täter. Schon 1985 stellten Hartmann/Steffen/Steffen eine Zunahme rechtsradikalen und -extremen Potentials unter Jugendlichen und sogar Kindern fest:
”Faschistische Symbole werden an Tafeln und Wände [der Schulen, Anm. d. Verf.] gemalt, Hakenkreuze, SS-Runen und Totenköpfe an Kleidungsstücken und Schultaschen sind keine Seltenheit, insbesondere in letzter Zeit mehren sich Beschimpfungen, Provokationen und Tätlichkeit gegenüber jüdischen Lehrern und Ausländerkindern” (Hartmann/Steffen/Steffen 1985: 41).
Abgesehen von diesem nicht-organisiertem, vorpolitischen Feld fanden aber auch rechtsextreme Organisationen und Skinheadgruppen Ende der achtziger, Anfang bis Mitte der neunziger Jahre steigenden Zuspruch unter Jugendlichen (vgl. Innenminister des Landes Schleswig-Holstein 1993, Innenministerium des Landes Baden-Württemberg 1994, Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern 1994 u.a.). Die Altersstruktur der Tatbeteiligten an Gewalttaten mit rechtsextremistischer Motivation zeigte 1993 ein Übergewicht der unter 20jährigen, gefolgt von den 21 bis 30jährigen (Innenministerium des Landes Baden-Württemberg 1994: 26 - vgl. Abb.1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(b) war der Rechtsextremismus bis Ende der siebziger Jahre vor allem geprägt durch das Festhalten an einer antimodernen Ideologie, völkischen Stilelementen und durch seine Vorliebe für straffe Organisation und Disziplin (vgl. Pfahl-Traughber 1993: 228 ff., Bergmann/Erb 1994: 7 ff.). ”Traditionell” ausgerichtete neonationalsozialistische Gruppierungen im politischen und vorpolitischen Feld (Beispiele: GdNF [”Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front”], ”Wiking-Jugend”, ”Wehrsportgruppen”) orientierten sich an den als typisch deutsch und damit als vorbildlich angesehenen ”völkischen” Tugenden und einem streng nach dem Führerprinzip ausgelegten, hierarchischen Kommandosystem (vgl. Analyse zu rechten Jugendgruppen wie ”Junge Nationaldemokraten” [JN] und ”Wiking-Jugend”: Hartmann/Steffen/Steffen 1985). Militanz und Kaderorganisation verfehlten aber aus soziologischer Sicht die soziale Form einer offenen Szene, die ohne formale Mitgliedschaften und entsprechende Führungs- und Befehlsstrukturen auskommen muß, um auf breiter Basis ansprechend wirken zu können.
”Eine Szene ist eine soziale Verdichtung, die sich durch gemeinsame Orte, durch ein lokales Stammpublikum und durch die Ähnlichkeit von Inhalten auszeichnet. Der Zutritt erfolgt nicht über formale Aufnahmeverfahren oder eine bereits ausgeprägte ideologische Voreinstellung, sondern neue Mitglieder werden rasch durch Anwesenheit und Teilnahme an der szenetypischen Kommunikation sozialisiert” (Bergmann/Erb 1994: 8).
Logische Folge daraus ist, daß eine rechte Jugendszene erst entstehen konnte, als der Rechtsextremismus nach und nach sektiererische Starrheit und Kaderorganisation partiell ablegte und sich das rechte Lager modernisierte und ausdifferenzierte:
(a) Eine Ausdifferenzierung läßt sich heute am Zustand der rechtsextremistischen ”Bewegung” deutlich erkennen, denn es handelt sich eben nicht, auch wenn dies die „Fanzines“ (engl. von „Fan-Magazine“) oder Flugblätter rechter Splittergruppen glauben machen wollen, um eine einheitliche Bewegung (vgl. Abb. von Flugblättern und Ausschnitte aus rechten Publikationen in Bundesminister des Innern 1993, insb. Rannacher 1993: 69 ff.). An der Vielfalt der Organisationen und Richtungen innerhalb des Rechtsextremismus zeigt sich ein breit gestreutes, heterogenes Spektrum, das, wenn man den Versuch macht, ein grobes Raster anzulegen, auf der einen Seite die ”traditionell” an der Ideologie des Dritten Reiches orientierten Neonationalsozialisten aufweist mit ihren Parteien und Gruppierungen, auf der anderen Seite jugendliche Gewaltszenen, welche die rechten Skinheads, auf die noch näher eingegangen werden soll, und Hooligans umfassen (das soll natürlich nicht heißen, daß Gewalt kein Moment sein kann, welches beide Lager vereint). Zwar ist eine ausdifferenzierte extreme und radikale Rechte kein Phänomen allein der achtziger und neunziger Jahre, neu ist allerdings die breite Fächerung im vorpolitischen, unorganisierten und sozialen Bereich.
Zwischen den erwähnten beiden Hauptlagern findet man rechtsextremistische Parteien und Organisationen wie ”die Republikaner” oder auch intellektuelle Zirkel wie das ”Thule- Seminar”, die ”Gesellschaft für freie Publizistik (GfP)” oder die ”Gesellschaft für biologische Anthropologie, Eugenik und Verhaltensforschung” (vgl. Pfahl-Traughber 1993: 101 ff. - letztere seien hier vor allem erwähnt, da sie mit ihrer ”kulturellen” und pseudo- wissenschaftlichen Veranstaltungen und Veröffentlichungen als rechtsintellektuelle Vorhut so etwas wie ”rechte Kulturarbeit” leisten oder zu leisten versuchen). In der Schnittmenge zwischen diesen beiden Lagern, dort also, wo etwa die ”Jungen Nationaldemokraten” zusammen mit Skinheads auf Konzerten rechtsextremer Bands feiern oder mit ihnen auf Rudolf-Heß-Gedenkfeiern erscheinen, wo ”Wiking-Jugend”, ”Deutsche Alternative”, Arnulf Priems Nazi-Rocker und Alt-Nazis auf dem sogenannten ”Heldengedenktag” auf dem Soldatenfriedhof Halde zusammenkamen und -kommen (vgl. Hasselbach/Bonengel 1993: 90 ff.), dort ist tatsächlich so etwas wie eine ”vernetzte” (vgl. Bergmann/Erb 1994: 173 ff.) rechte Szene zu beobachten. Über Organisationen wie die der NPD kann dann auch die Brücke von ”Oi-Musik” hörenden Skinheads und Hooligans zu den traditionell-völkisch konzipierten rechten Jugend- und Kulturorganisationen (z.B. WJ) geschlagen werden, welche versuchten und versuchen, sich mit ”deutsch-nationalen” Kulturaktivitäten hervorzutun.
(b) Eine Modernisierung vollzog sich im Rechtsextremismus vor allem im Hinblick auf die Jugend. Hier entstand so etwas wie eine neue ”Jugendszene”, die durchaus Vergleiche zu anderen populärkulturellen Phänomenen dieser Art zuläßt. Stock und Mühlberg etwa behandeln das Phänomen ”Skinheads” zusammen mit anderen Subkulturen wie „Grufties“, „Heavy Metals“, „Punks“ (Stock/Mühlberg 1990: 11 ff.).
Mit der ”Übernahme von Formen und Ausdrucksweisen der internationalen populären Jugendkultur” (Bergmann/Erb 1994: 11) habe sich der Rechtsextremismus teilweise modernisiert, stellen Bergmann/Erb fest. Sie legen dar, daß der Rechtsextremismus damit ”parasitär an bereits entwickelten Formen” (Bergmann/Erb 1994: 11) partizipiert, ohne selbst innovativ zu sein. Überraschend an dieser ”Aneignung” sei allerdings, ”daß mit der internationalistischen, stark angelsächsisch geprägten Kulturform ein Muster übernommen wurde, das der deutsch-völkischen, nationalistischen Tradition widerspricht” (Bergmann/Erb 1994: 11). Diese sich aus der Modernisierung ableitende Widersprüchlichkeit ergebe natürlich Konfliktpotential innerhalb der rechten Szene.
”Richtige” Neonazis und Rechtsterroristen wie Ekkehard Weil, Christian Worch und Gottfried Küssel oder der in der Szene bekannte Altnazi und angebliche ”Ritterkreuzträger” Riehs äußerten sich wiederholt abschätzig über das exzessiv-rebellische, antibürgerlich ausgerichtete Verhalten von Hooligans und Skinheads, mit denen sie eher aus taktischen Gründen paktierten und paktieren (vgl. Kap. über die genannten Personen in Hasselbach/Bonengel 1993). Altnazis werten diese neuen Strömungen und diese Zuchtlosigkeit als Dekadenz, Traditionslosigkeit und Kulturverfall, wie sie angeblich typisch für die ”heutige Zeit” sind (s. Bergmann/Erb 1994: 11). Leute wie Worch oder der verstorbene Michael Kühnen traten und treten trotzdessen als eine Art ”Vermittler” auf, die eine ”Scharnierfunktion” (Bergmann/Erb 1994: 11) übernahmen und -nehmen.
1.2 Die neue rechte Jugendszene - eine neue Subkultur?
In den achtziger und neunziger Jahren ist politisch unabhängig von den Rechtsparteien eine stark von Jugendlichen geprägte rechtsorientierte Subkultur entstanden, die sich in ”Habitus und Stil in den Formen moderner Populärkultur artikuliert” (Bergmann/Erb 1994: 7). Diese rechte ”Subkultur” bildet heute ”im Anschluß an die Pluralisierung der Lebensstile Jugendlicher in den westlichen Industriegesellschaften einen Teil dieses modernen Spektrums” (Bergmann/Erb 1994: 7).
Nach Bergmann/Erb sei ferner für Szenen und Subkulturen generell typisch, daß unterschiedliche Motive das Individuum dazu bewegen, an ihnen teilzuhaben (vgl. Bergmann/Erb 1994: 8 ff.). Nicht jeder Fan von ”Oi-Musik” muß etwa gleich Nazi-Ideologie vertreten. So entstand selbst innerhalb der Neonazi-Szene fälschlicherweise der Eindruck, jeder Skinhead oder Hooligan sei für ihre Kaderorganisationen rekrutierbar (vgl. Farin 1996: 122 ff.). Außerhalb der Szene, so wird in der Literatur (vgl. Bergmann/Erb 1994, Farin 1996, Stock/Mühlberg 1990 u.a.) mehrfach betont, wird die Bedeutung politisch-ideologischer Motive oftmals überschätzt, was mithin auf eine mangelhafte Berichterstattung der Medien zurückzuführen ist.
Mit dem Begriff ”Neonationalsozialismus” kann das Phänomen ”rechte Subkultur” also nicht allein charakterisiert werden (in Szeneberichten - Beispiel: Hasselbach/Bonengel 1993 - wird sogar deutlich, daß manche Skinheads und Hooligans, die auf Konzerten und in Fanzines rechte und ausländerfeindliche Parolen konsumieren, mangels nötiger Bildung nicht einmal erklären können, was Nationalsozialismus überhaupt bedeutet). Wie aber läßt sich eine rechte Subkultur beschreiben - kann man bei ihr überhaupt von einer Subkultur gesprochen werden, wenn, wie Bergmann/Erb behaupten, hier keine Innovation, sondern nur Epigonentum vorherrscht?
2 Kultursoziologische Merkmale und Kommunikationsmittel der rechten Jugendszene mit besonderer Berücksichtigung der Skinhead-Szene
2.1 Strukturen und Kommunikationsmittel
Mit Rechtsextremismus und besonders mit ”rechter Jugendkultur” wird auf Anhieb das markanteste Phänomen der Bewegung assoziiert: die Skinheads. Bevor auf diese besonders eingegangen wird, noch einige Anmerkungen zu Erscheinungsform und Kommunikationsmitteln einer rechten ”Subkultur”, die auch bei rechtsgerichteten Jugendlichen außerhalb der Skinhead-Szene gültig sind (etwa bei NPD/JN, „Bund Heimattreuer Jugend“ [BHJ], WJ, „Aktionsfront Nationaler Sozialisten“ [ANS], „Wehrsportgruppen“ [WSG] - Hinweis: diese Gruppen, denen in Hartmann/Steffen/Steffen jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet wird, sind z.T. mittlerweile als verfassungsfeindlich eingestuft und verboten worden, Anm. d. Verf.).
(a) Die Struktur der neuen ”rechtsradikalen” Jugendbewegung, die als ”rudimentär” bezeichnet wird (Lau/Soeffner in Bergmann/Erb 1994: 18), weist allgemeine „Züge der Moderne“ auf (Lau/Soeffner in Bergmann/Erb 1994: 18 - bei seiner Analyse von Entstehung und Struktur der rechten Bewegung verwendet Bergmann später eindeutig den Begriff Moderne, wie er ihn auch in seiner Forschungsliteratur vorfindet: „Es besteht in der Forschung weitgehend Konsens, daß wir z.Z. eine Phase der Modernisierung erleben, die zu strukturellen Spannungen sowie kollektiven Problemdefinitionen und Lernprozessen geführt hat. Heute scheinen kulturelle Konflikte gegenüber politischen und sozioökonomischen zu dominieren. Ulrich Beck spricht von einem Kulturkampf der zwei Modernen“ [Bergmann in Bergmann/Erb 1994: 184 ff. - Hervorhebung laut Vorlage, Anm. d. Verf.]). Brumlik führt im Zusammenhang mit den sozialen Prozessen der Modernisierung den Begriff der „(Re-) Barbarisierung“ (Brumlik 1993: 56) an und nennt dafür folgende Ebenen:
„(1) Die Ebene tiefgreifenden, epochalen und säkularen Strukturwandels beziehungsweise dessen, was derzeit allgemein als Modernisierungsprozeß bezeichnet wird. Dieser Strukturwandel betrifft die Gesellschaft im Ganzen ebenso wie Institutionen und Psychen.
(2) Die Ebene der nationalen und kulturellen Eigenheiten der deutschen Nachkriegsgeschichte, die sich wiederum eigensinnig und widersprüchlich auf Gesellschaft, Institutionen und Psychen auswirkt.
(3) Die Ebene des halbwegs autonomen politischen Systems, dessen Bestandteile wie politische Klassen, konkurrenzdemokratische Selektionsverfahren, Parteien, Klientel- und Patronageaggregationen vor dem Hintergrund instabiler werdender Mehrheitsverhältnisse an ihrer Selbstbehauptung arbeiten müssen“ (Brumlik 1993: 56).
Vor allem Punkt eins ist für die Erklärung einer rechtsradikalen Jugendszene von besonderem Interesse: es kann angenommen werden, daß die Entstehung der rechtsradikalen Jugendkultur Folge eines gesellschaftlichen Strukturwandels ist, der hierzulande in der Wiedervereinigung einen zusätzlichen Katalysator fand. Mit diesem Prozeß einher geht auch die Entwicklung anderer Jugendkulturen - selbst der „Punk“ erlebte in den späten achtziger und frühen neunziger Jahren eine gewisse Rückkehr bei der mittelständischen Jugend.
Soziologisch augenfällig, nicht nur für die rechte, sondern für alle in diesem angenommenen Modernisierungs- und Umstrukturierungsprozesses entstandenen Jugendkulturen, ist das Fehlen von ”Führern”. Zu werten ist dies als eine direkte Folge der Pluralisierung und Individualisierung der modernen Gesellschaft: ”die Suche des Individuums zielt nicht so sehr auf einen Führer, ein anderes großes Individuum (das man ja letztlich selbst sein könnte), sondern auf die Gruppe - auf die Aktion im Kollektivkörper” (Lau/Soeffner in Bergmann/Erb 1994: 18). Die oben erwähnten rechten Leitfiguren fungieren eher als Führer kleinerer Gruppen, Parteien und Aktionseinheiten - viele Anschläge auf Asylantenheime oder Sachbeschädigungen durch Anbringen rechter Symbole gehen aber nicht auf geplante und geleitete Organisationen zurück, sondern auf unabhängige Einzeltäter (vgl. hierzu neueste Informationen in Bundesministerium des Innern 1997: 169ff.). Dagegen zeigte sich der Linksterrorismus in den siebziger und achtziger Jahren organisierter, und die aus der 68er Bewegung hervorgegangene Linke verfügte zumindest über die intellektuelle Kraft, gesamtgesellschaftliche Konzepte zu entwerfen. Eine anerkannte Elite im eigentlichen Sinne gibt es nicht für die rechte Jugendszene - jeder scheint zunächst eher persönlichen Zielen verhaftet als einer übergreifenden „Idee“. Dies ist ein wichtiges Merkmal dieser Pluralisierung und Individualisierung.
(b) Ohne Führungspersonen bleiben die rechtsextremistisch motivierten Aktionen also folgenschwer, aber vereinzelt und unkoordiniert. Damit ist natürlich auch die polizeiliche Bekämpfung um so schwerer. Das gleiche gilt für die Ausdrucksmittel der rechten Szene:
”Dadurch [...], daß durch ein individuelles Zusammenklauben verschiedenster Stilmittel und Tatelemente aufgrund des Fehlens einer stilbildenden Führungselite jedem einzelnen die Möglichkeit gegeben wird, am Phänomen Rechtsradikalismus teilzuhaben, ist deren Verbreitung [die der Stilmittel, Anm. d. Verf.] so schwer kontrollierbar. Über [...] Appelle oder ähnliche Bekehrungsversuche ist dem agierenden Personal kaum beizukommen: Es hat und produziert seine eigene Szene” (Bergmann /Erb 1994: 18).
Die Verbreitung der szenerelevanten Kommunikationsmittel und Deutungsmuster erfolgt nicht nur über die ”großen”, sondern auch über die szeneinternen Medien:
Mailboxen (vgl. dazu Bundesministerium des Innern 1994: 147 ff., Innenministerium des Landes Baden-Württemberg 1993: 65 ff., Bergmann/Erb 1994: 176 ff.) waren zwar schon früh vorhanden, blieben aber eher einer Minderheit überlassen. Eine größere Bedeutung kommt mit der zunehmenden Verbreitung von leistungsfähigen PCs und Modems dem Internet zu (vgl. Jüngel 1998). Dank vereinfachter Betriebsmöglichkeiten durch eine grafische Benutzeroberfläche löste das „World Wide Web“ (WWW) die Mailboxszene ab, und rechtsextremistische Organisationen nutzen ausgiebig die erweiterten Fähigkeiten, um ihre Symbole und Inhalte auf relativ unkomplizierte Weise weltweit zu verbreiten (vgl. Jüngel 1998). Jeder, der will, kann sich zu Hause ohne lange Suche rechtsextremistisches Gedankengut ”herunterladen”. Eine weitere Facette im Computerbereich stellen die - meist schlecht gemachten und indizierten - Spiele wie ”Anti-Türken-Test”, ”KZ-Manager” oder ”Hitler 2000” dar (vgl. Bundesministerium des Innern 1994: 149, Lau/Soeffner in Bergmann/Erb 1994: 19 ff.). Der Reiz dürfte hier wohl aber eher in der Tabuverletzung und in dem Bewußtsein liegen, etwas Verbotenes zu besitzen. Zu bedenken ist hier auch, daß die sozial oft minderbemittelten Jugendlichen der rechten Szene häufig keinen Zugriff auf die neuen Medien haben, und diese eher der Mittelschicht überlassen bleiben. Trotzdessen argumentiert der Verfassungsschutz:
„Mit der Perfektionierung der Informationstechnik entstanden für die rechtsextremistische Szene neue Möglichkeiten der Strukturierung und informellen Vernetzung, die auch als Steuerungsmittel wirksam nutzbar sind. [...]. Dies steigert die Gefährlichkeit dieses Personenkreises, der dadurch die ‘Szene’ kurzfristig mobilisieren, größere Aktionen steuern und auf die Maßnahmen der Sicherheitsbehörden flexibel reagieren kann“ (Bundesministerium des Innern 1994: 147).
Videomittschnitte der offiziellen Berichterstattung und TV-Dokumentationen der Aufmärsche und Versammlungen, Kassetten mit Aufnahmen indizierter Tonträger, Infotelefone und vor allem die Fanzines spielen zur Zeit noch weit wichtigere Rollen für die rechtsextremistische ”Basis” (Lau/Soeffner in Bergmann/Erb 1994: 19 - vgl. u.: Skinhead-Szene). ”Die gegenüber den Gerichten und Sozialarbeitern erkennbare Sprachlosigkeit des neuen Rechtsradikalismus wird ausgeglichen durch einen überquellenden Symbolismus im Bereich der Abzeichen, Wappen, Embleme und Fahnen” (Lau Soeffner in Bergmann/Erb 1994: 24).
Auf Argumentation wird bewußt verzichtet, womit man gleichzeitig gegen die Generation der ”68er” revoltiert, die als diskurserfahrenen gilt. Zwar gibt es eine Reihe von Verlagen, darunter auch der des DVU-Vorsitzenden Frey, die sich der Verbreitung von Publikationen verschrieben haben, welche von der Verharmlosung des Dritten Reiches bis zur Propagierung der sogenannten ”Auschwitz-Lüge” reichen (vgl. Pfahl-Traughber 1993: 56 ff.). Tatsächlich gelesen werden dürften diese aber wohl eher nur vom harten Kern der rechtsextremen Szene. Die meisten Skinheads und Hooligans ziehen sicherlich - wenn überhaupt - eher einfacher zu konsumierende Medien vor (vgl. dazu „Charakter“-Beschreibungen in Hasselbach/Bonengel 1993).
Natürlich stellt dieser Symbolaktionismus eine besondere Attraktion für die Medien dar. Die Hochstilisierung zur eigenen Subkultur ist also sicherlich auch eine Folge der Behandlung im Fernsehen und in den Printmedien: in Talkshows traten Skinheads oder rechtsradikale Populisten auf, in der Jugendzeitschrift „BRAVO-Girl“ wurden ”Skins” und ”Faschos” als Szenevertreter zusammen mit ”Punks”, ”Technos” und ”Antifas” gezeigt, Bekleidungsvorschriften und Fotos inklusive (Lau/Soeffner in Bergmann/Erb 1994: 24 ff.).
Handwerkliches Unvermögen im Erstellen ihrer Kommunikationsmittel und Innovationslosigkeit, welche den Medien der rechten Jugendszene in der Literatur größtenteils unterstellt werden, zeigen, daß es sich bei den modernen Rechtsradikalen nicht um eine Elite oder Avantgarde handelt (als die sich z.B. die ”68er” verstanden), sondern um eine Anti- oder Nicht-Elite. Genau das ist es, als was die Skinhead-Bewegung von Anfang an verstand.
(c) Männliche Mitglieder stellen in der rechten Jugendszene die dominierende Mehrheit und somit ein entscheidendes äußeres Charakteristikum dar. Der Hauptanteil liegt bei den 17 bis 20jährigen. Die Herkunft ist eher in den unteren sozialen Schichten zu suchen (s. hierzu Beschreibungen in Pfahl-Traughber 1993, Bergmann/Erb 1994, Möller/Schiele 1996 sowie in den Verfassungsschutzberichten). Diese soziale Struktur gilt ganz besonders auch für die
Skinheadszene. Abb. 2 stellt die Altersgruppenverteilung in der Skinhead-Szene dar, stimmt aber mit dem, was man als ”rechte Jugendszene” oder ”Subkultur” bezeichnet, weithin überein.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.2 Die Skinhead-Szene als hervorstechendes Merkmal rechter Jugendkultur
Spricht man von „neuer rechter Jugendkultur“, so kann man diesen Begriff kaum vom Skinheadphänomen lösen, denn hier finden sich die Merkmale, die eine jugendliche Subkultur ausmachen: eine eigene Lebenseinstellung, Mode, Musik, Kommunikationsmittel wie Zeitschriften, Videos, CDs, ein eigenes Selbstbewußtsein und Zusammengehörigkeitsgefühl. Es scheint sogar so zu sein, daß wenn in der Literatur von „rechter Subkultur“ die Rede ist, sie vorwiegend auf die Skinheadszene referiert (vgl. z.B. Bergmann/Erb 1994 - hier schon auf dem Titelbild). Für Farin stellen Skinheads gar „eine Jugendsubkultur wie viele andere dar und sind deshalb auch nicht anders zu behandeln als HipHop-, Techno- oder Metalfans, Raver, Punks“ (Farin in Moeller/Schiele 1996: 124). Wie alle Jugendszenen vereine die Skinheadkultur emanzipatorische als auch reaktionäre Elemente.
Dagegen ist die Mitgliedschaft in einer rechtsextremistischen Vereinigung laut Pfahl-Traughber das vorläufige Endprodukt eines politischen Entwicklungsprozesses, denn am Anfang steht der vorpolitische Raum. In diesem haben sich laut Traughber ”vergleichsweise diffuse rechtsextreme Orientierungen [...am deutlichsten ... ] in einer jugendlichen Subkultur artikuliert: den Skinheads“ (Pfahl-Traughber 1993: S. 150 u. 151). Unter diesem Gesichtspunkt, der auch in den meisten Schriften der Innenministerien vertreten wird, fällt auf, daß ein beachtlicher Teil der Begutachter der Szene im Gegensatz zu Farin eben nicht der Meinung ist, daß Skinheads wie jede andere jugendliche Subkultur zu behandeln seien.
Es handelt sich dieser Argumentation zufolge bei Skinheads um Jugendliche, die sich zunächst völlig unpolitisch über eine bestimmte Mode und Musik definierten, aber im Laufe der Zeit immer stärker in Richtung rechtsextremer Orientierungen politisiert wurden und nun, so Traughber, in teilweise enger politischer Zusammenarbeit mit neonationalsozialistischen Kräften agieren (Pfahl-Traughber 1993: S. 151).
2.2.1 Ursprünge der Skinheadbewegung
Die Skinhead-Kultur entstand Ende der sechziger Jahre in Großbritannien, in den Arbeitervierteln von Liverpool, Glasgow, Birmingham und vor allem im Londoner East End. Sie war von Anfang an auf Protest angelegt, eine Gegenbewegung von unten (vgl. Farin in Moeller Schiele 1996: 118 ff., Pfahl-Traughber 1993: 151 ff.).
Die klassischen Arbeitermilieus zerfielen, die Mittelschicht vergrößerte sich, Jugendliche der Mittelschicht begannen, das Hippietum zu kultivieren, wobei die Propagierung von Toleranz und Frieden einen wichtigen Aspekt darstellte (Farin in Moeller/Schiele 1996: 118). Demonstrativ grenzten sich die Skinheads davon ab.
Als äußeres Merkmal wurden Utensilien gewählt, die man als Symbole vergangener und besserer, vor allem aber auch proletarischer Zeiten empfand: billige Arbeiterschuhe von Doc Martens, „Hosenträger über grob genähten Bergarbeiterhemden“, Jeans und kurzgeschorenes Haar (Farin in Moeller/Schiele 1996: 118). ”Skinhead war, wer sich keine teuren Klamotten kaufen konnte und dies auch zeigen wollte”, beschreibt ein Skinhead die Anfänge der neuen Subkultur, das Motto lautete: ”Wir sind Prolls - stolz darauf!” (zit. nach Farin in Möller/Schiele 1996: 118).
”Skinheads” wurden sie anfangs von ihren Gegnern genannt, machten sich diese Bezeichnung aber bald selbst zu eigen. Farin zählt die sinn- und identitätsstiftenden Hobbys der Mitglieder dieser Gangs auf: „Fußball, Bier und Prügeleien“ (Farin in Moeller/Schiele 1996: 118). Gewalt gegen jeden, der nicht in ihr Weltbild paßte, begleitete die Bewegung von Anfang an. Obwohl - zusammen mit Rekruten, Studenten, Hippies oder einfach rivalisierenden Skinheadgangs - viele Ausländer zu den Opfern zählten, spielten nach Farin Rassismus und Politik keine besondere Rolle (vgl. auch Pfahl-Traughber 1993: 152). Vielmehr war es zunächst oftmals sogar schwarze Musik - „Ska“ und „Rocksteady“, ”der Sound der jamaikanischen Einwandererkids” (Farin in Moeller/schiele 1996: 119), schwarze DJs und Musiker, die zu den Idolen der Skinheadkultur gehörten.
Eine Wandlung vollzog sich Mitte der 70er Jahre mit der zweiten Skinhead-Generation. Den rechtsextremen Organisationen ”British Movement” und ”National Front” gelang es, eine Reihe von Skinheads über die agitatorische Verknüpfung von sozialen Problemen mit ausländerfeindlichen Parolen für sich einzunehmen (vgl. Farin in Moeller/Schiele 1996: 120 ff., sowie Pfahl-Traughber 1993: 152 ff.). ”Scheitel-Nazis” schreibt Farin, ließen sich die Haare scheren, um in die Skin-Szene einzutauchen. Bei militanten Aktionen jener politischen Gruppen traten seitdem immer wieder Skinheads in ”der ersten Reihe auf, und auf diese Weise erhielt diese jugendliche Subkultur ihr rechtes Image” (Pfahl-Traughber 1993: 152).
Etwa zur gleichen Zeit inszenierten ein ”paar clevere Businessleute” (Farin in Moeller/Schiele 1996: 120) das „Punk“-Phänomen, das wider Erwarten von der Jugend angenommen wurde. Einige Bands begannen, sich gegen die Kommerzialisierung und die aus der bürgerlichen Mittelklasse stammenden Punks zu wenden: ”sie nannten ihren Sound nicht mehr einfach Punk, sondern Streetpunk, Realpunk oder Working Class Punk - und schließlich nach ihrem Schlachtruf in den Fußballstadien: Oi!” (Farin in Möller/Schiele 1996: 120). Und die Punks bzw. Skinheads der unteren Klassen erkannten, womit sie provozieren konnten:
„sie ließen sich die Haare scheren, flickten ihre Hosen, ersetzten die Sicherheitsnadeln im Ohr durch Tattoos auf den Armen und registrierten erstaunt, daß die in Mode gekommenen Hakenkreuz-T-Shirts kombiniert mit dem neuen Outfit plötzlich wieder Provokationswert besaßen. Hatten Lehrer und Linke gerade mühsam gelernt, den ‘No Future’-Rebellen Verständnis bis Sympathie entgegenzubringen, die neonazistischen Symbole als provokante Kapitalismuskritik zu deuten, so wurden die jetzt glatzköpfigen Provokateure und ihre Runen nun ernstgenommen“ (Farin in Moeller/Schiele 1996: 120).
Die Medien nahmen mit Vorliebe die rechte Seite und ihre spektakulärer erscheinenden Darstellungsformen auf, und die szenerelevanten Kommunikationsmuster fanden so schnell, ohne großes Zutun der Szenemitglieder, Verbreitung: ”Bald wußte jeder rechtsradikale Schläger, wie er sich zu stylen hatte, um Gleichgesinnte zu finden” (Farin in Möller/Schiele 1996: 121). Diese Tatsache erleichtert auch heute noch Jugendlichen den Einstieg in sämtliche vertretenen Szenekulturen, ob es nun Punk, Techno oder die Skinheadbewegung ist, da sie dank ausreichendem Material aus Zeitungen und Magazinen wissen, was sie tun müssen, um wenigstens äußerlich akzeptiert zu werden.
Mit diesem rechtsextremistischen Ruf gelangte die Skinheadbewegung Ende der 70er Jahre auch nach Deutschland.
2.2.2 Die deutsche Skinheadszene
Ende der 70er Jahre bildete sich in der Bundesrepublik eine Skinhead-Szene heraus, die zunächst nur Alltagskultur und Mode der englischen Skins übernahm. Fast ausschließlich Jugendliche aus sozialen Randlagen waren und sind Mitglieder dieser Szene. Zu Beginn diente der Zusammenschluß in Gruppen laut Pfahl-Traughber dazu, über diese rauhen, aber als kameradschaftlich angesehenen Freundschaften Probleme in der Schule und im Elternhaus auszugleichen (Pfahl-Traughber 1993: 152).
Als Hauptgründe für den Einstieg in die Szene sieht Farin (Farin in Moeller/Schiele 1996: 122 ff.) auch heute weniger politische Beweggründe. Vielmehr die ”kulturellen” Gründe seien es, welche Jugendliche zum Einstieg in die Skinhead-Szene veranlassen: Farin bezeichnet sie als die ”subkulturellen Signale der Szene (Musik, Outfit, hart aber smart, die Erfahrung, auch als ‘Versager’ in Beruf oder Schule von seiner Umwelt plötzlich mit Respekt behandelt zu werden)” (Farin in Moeller/Schiele 1996: 125) sowie die Suche nach einer Clique und verbindlichen Freundschaften (”Kameradschaft”).
In letzter Zeit gewinne die Formel ”Skins gegen Politik” Anhänger aus den rechten und linken Fraktionen der Szene. Skinhead-sein bedeute demnach, so Farin, ”’a way of life’, Musik, Spaß und Freude“ (Farin in Moeller/Schiele).
Weder der Verfassungsschutz bzw. die Innenministeren, noch Pfahl-Traughber teilen diese Harmlosigkeit suggerierenden Ausführungen. Mit den Worten „unser freiheitlicher Rechtsstaat steht in einer Bewährungsprobe“ eröffnet der Innenminister des Landes MecklenburgVorpommern, Rudi Geil, die Broschüre „Skinheads“ (Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern 1994: 5). Pfahl-Traughber argumentiert:
„Das wichtigste Kriterium für politischen Extremismus ist in der Ablehnung der Wertvorstellungen des demokratischen Verfassungsstaates als Garant von Bürger- und Menschenrechten zu sehen, auf welcher Ebene politischer Reflexion sich die Gegnerschaft zu diesen konkret artikuliert, bleibt demgegenüber zweitrangig. Von daher hat ein politikwissenschaftliches bzw. sozialwissenschaftliches Verständnis von Rechtsextremismus auch über eine organisationszentrierte Sichtweise hinauszugehen und nach rechtsextremen Tendenzen im vorpolitischen Raum zu fragen“ (Pfahl-Traughber 1993: 150).
In der Folge kennzeichnet Pfahl-Traughber die Skinhead-“Kultur“ als zu einem großen Teil der Gewalt und Intoleranz zugeneigt, für ihn Eigenschaften, die sich aus der Propagierung körperlicher Überlegenheit und Zurschaustellung von „Mannhaftigkeit“ ableiten (Pfahl- Traughber 1993: 154 ff.).
1996 gab es laut Farin (Farin in Moeller/Schiele 1996: 122) etwa sechs- bis achttausend Skinheads in Deutschland, Tendenz leicht steigend. Unter zehn Prozent davon sind direkt in das neonazistische Netzwerk eingebunden, ein Drittel denkt jedoch deutschnationalfremdenfeindlich bis rassistisch (Farin in Moeller/Schiele 1996: 122). Pfahl-Traughber sprach 1993 vom ”überwiegenden Teil der Skinhead-Szene”, der sich als Vorkämpfer und Verteidiger der ”nordisch-arischen Rasse” sieht und sich gegen ethnische Minderheiten und gesellschaftliche Gruppen wendet (Pfahl-Traughber 1993: 155).
Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung allerdings liegt der Täteranteil von Skinheads bei Gewalttaten mit rechtsextremen und/oder rassistischem Hintergrund bei 8,6 Prozent (BKA- Statistik 1994 - nach Farin 1996: 122). Farin leitet daraus ab , daß im Mittelpunkt der Skinhead-”Kultur”, dem also, was meistens unter ”rechter Subkultur” verstanden wird, weniger politische Anliegen als Musik, Parties, Freundschaften stehen und schildert das ”kulturelle” Szeneleben so:
”Quasi an jedem Wochenende organisiert irgendein Skin in irgendeiner Stadt eine Party (bisweilen [...] mit Live-Band), zu der Skins aus allen Regionen des Landes und des benachbarten Auslands anreisen” (Farin in Möller/Schiele 1996: 123 ff.). Kontakt pflege man in etwa 60 deutschsprachigen Fanzines oder ”Skin-Zines”, welche in der Regel eine Auflage zwischen 200 und 500 Exemplaren erreichen. Rund 150 Bands waren 1996 in der Szene aktiv, bekannt meist durch selbstvervielfältigte Demokassetten, Konzerte in Scheunen, Privatwohnungen, Kneipenhinterzimmern oder randstädtischen Jugendclubs. Diese Parties und Konzerte sind die hauptsächlichen Treff- und Kommunikationspunkte der Skinhead-Szene, der rechten wie der übrigen. Hier werden bei exzessivem Alkoholgenuß (”Kampftrinken” - Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern 1994: 3) die Parolen skandiert und die eigene Einstellung von der Masse bestätigt.
Gerade im rechten Lager der Skinhead-Szene, dem der ”Fascho-”, ”Nazi-” oder ”Partei”-Skins (mit hauptsächlicher Mitgliedschaft in NPD und DVU, früher FAP oder Nationale Alternative - vgl. Verfassungsschutzberichte sowie Hasselbach/Bonengel 1993), wird zudem den Fanzines und Songtexten eine große meinungsbildende Funktion zugeschrieben (Pfahl-Traughber 1993: 154).
1993 wies das Innenministerium des Landes Baden-Württemberg im Verfassungsschutzbericht ausdrücklich darauf hin, daß in den Liedern in ”hohem Maße rechtsextremistisches, insbesondere fremdenfeindliches Gedankengut” vermittelt wird.
Gruppen-, Fanzine- oder Plattennamen wie ”Oithanasie”, ”Musik fürs Vaterland”, ”Sturmtruppen”, ”Endsieg” oder ”Heimatfront” sprechen für sich. In den Liedertexten bekennen sich die Bands zu einer diffusen ”arisch-nordischen” Rassenideologie. Einsteiger in die Szene, stellt das Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern fest (Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern 1994: 16), werden zunächst von diesen Liedertexten geprägt, bevor sie dann vielfach den Weg in diese Subkultur finden. Die Inhalte vieler Texte sind eindeutig:
”Hängt dem Adolf Hitler, hängt dem Adolf Hitler,
hängt dem Adolf Hitler den Nobelpreis um!
Hißt die rote Fahne, hißt die rote Fahne,
hißt die rote Fahne mit dem Hakenkreuz!
Schon als ein kleiner Junge, da war es mir klar,
daß dieses Symbol leitend für mich war.
Und heut’, da steh ich noch voll dazu,
es gibt nur eines, und das bist du.
Wie es auf alten deutschen Fahnen,
so führt es mich auf rechten Bahnen.
Für mich gilt es auch noch heut’:
Rasse, Stolz und Hakenkreuz!”
(Text der Gruppe ”Radikahl”, zit. nach Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern 1994, 19)
”Bei den extrem lauten Konzerten wird die Botschaft der Musik durch stakkatoartige Rhythmen der aufgepeitschten Anhängerschaft regelrecht in die Köpfe ‘gehämmert’” (Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern 1994: 20). Die aufgeladene Stimmung entlädt sich dann oftmals in Prügeleien zwischen den Konzertbesuchern und führt im Anschluß oft zu Ausschreitungen gegenüber den auserkorenen Gegnern.
Auf Plattencovern und Fanzine-Titelseiten tauchen immer wiederkehrende, eindeutige Symbole auf, Zeichnungen vom ”Ku Klux Klan”, das ”Keltenkreuz”, welches das ”gemeinsame Kulturerbe der nordischen Rasse” (Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern 1994: 3) symbolisieren soll, und dessen Verbreitung mittlerweile verboten ist, Schriften in Form der SS-Runen u.v.m. Aufmachung und inhaltliche Qualität gelten als im Schnitt eher bescheiden, der Vertrieb erfolgt per Post, bei Konzerten oder von Hand zu Hand.
Im Verfassungsschutzbericht des Landes Baden-Württemberg wird eingeräumt, daß das strafrechtliche Vorgehen gegen Bands und Fanzine-Herausgeber zu einer Mäßigung in der Ausdrucksweise geführt hat: ”rechtsextremistisches Gedankengut wird nicht mehr offen formuliert, sondern in harmlos erscheinende, für Szenenangehörige jedoch leicht zu entschlüsselnde Parolen verpackt” (Innenministerium des Landes Baden-Württemberg 1994: 30).
Abschließend bleibt zu diesem kurzen Überblick über die Sinhead-Subkultur sagen, daß die Literatur den Einfluß des rechten Lagers hier unterschiedlich bewertet. Im allgemeinen wird aber das lebendige Bestehen einer Subkultur angenommen, bei der vor allem die rechte Fraktion im Vordergrund der Untersuchungen steht und auch ein Übergewicht zu haben scheint, obwohl Farin den Trend zur Depolitisierung und anti-nazistische Töne herauszuhören glaubt und zugleich die neuesten Ergebnisse vorweisen kann (vgl. Farin in Möller/Schiele 1996: 124ff.).
3 (Sub-)Kulturelle Fundamentalopposition nach dem Muster der linken Subkultur?
Im folgenden soll nun die Überlegung angestellt werden, ob aus dem bisher gesagten das Vorhandensein einer latenten systemfeindlichen und damit für den Staat gefährlichen Einstellung innerhalb der rechten Jugendsubkultur abgeleitet werden kann. Zum Vergleich einige kurze Beispiele aus dem linksextremen Spektrum, dem meist relativ schnell eine fundamentaloppositionelle Rolle zugeordnet wird:
(a) Die Medien und „kulturellen“ Kommunikationsmittel der linksextremistisch und -radikal orientierten Subkulturen, welche die sogenannten „Autonomen“ und „Antifagruppen“ umfassen, repräsentieren eine deutliche Ablehnungshaltung gegenüber dem demokratisch- parlamentarischen Verfassungsstaat. Der „Kampf gegen das kapitalistische System“, gegen „Imperialismus“ und für eine „herrschaftsfreie“ Gesellschaft (vgl. Bundesministerium des Innern 1997: 166 ff.) sind die Hauptziele, welche den ideologischen Überbau und die Legitimation für linksterroristische Übergriffe gegen öffentliche und private Einrichtungen liefern. Das Bundesministerium des Innern unterstreicht, daß die Grenzen zwischen dem RAF- und Revolutionäre Zellen-Terrorismus der siebziger und achtziger und zwischen den autonomen, anarchistischen und Antifa-Aktionsbündnissen fließend sind (Bundesministerium des Innern 1997: 167 ff.). Bedeutsam ist das hier nur, da die Autonomen, jüngeren Punks und die Antifaszene es sind, was man als linken Gegenpart zur rechten Jugendkultur bezeichnen kann.
(b) Natürlich ist nicht jeder Teilhaber an dieser linken Jugendsubkultur ein potentieller Terrorist. Beliebte Punkgruppen wie „Slime“, „Normahl“ oder „Toxoplasma“ äußerten in ihren eindeutigen, zum Teil indizierten Liedtexten („Das Lied der RAF“, „Deutschland muß sterben“, „Bullenschweine“, „Polizei SA-SS“) zwar immer wieder offene Feindschaft gegenüber dem parlamentarischen Rechtsstaat, Fanzines, Aufkleber, Computerspiele („RAF“) und Videos sind hier aber von ähnlicher Bedeutung für jüngere Anhänger der linken Szene wie ihre beschriebenen Pendants in der rechten Subkultur (vgl. Verfassungsschutzberichte, v.a. Bundesministerium des Innern 1994): sie können das Individuum sicherlich in seinen Ansichten bestätigen und das Gemeinschaftsgefühl von Szenemitgliedern stärken, müssen aber letztendlich nicht unbedingt zu Gewaltanwendung und militantem Aktionismus führen.
Unzweifelhaft kann die linke Subkultur aber auf einen intellektuell-ideologischen Überbau zurückgreifen, der von Marx/Lenin über Mao Zedong und Che Guevara bis zu Marcuse reicht, und vor allem in den endsechziger und siebziger Jahren gefestigt wurde. Grundton ist hier stets der Versuch, eine mögliche Alternative zum bestehenden System zu finden - also Fundamentalopposition zu führen. Spuren davon finden sich bis heute bei jedem, der mit „Destroy Deutschland“ und „Gegen Nazis“-Aufnähern an der linken Subkultur partizipiert, selbst wenn die meisten der Jüngeren auch hier keine speziellen theoretischen Kenntnisse haben dürften.
Wie sieht es dagegen mit der rechten Subkultur aus? Wird hier eine Ablehnung des Systems und der bürgerlichen Gesellschaft propagiert, oder einfach „nur“ diffuser Fremdenhaß vertreten - was ja im strengen Sinne nicht als Fundamentalopposition bezeichnet werden könnte.
„Griffen die linken, intellektuell geprägten Aktivisten - ihrem Selbstverständnis entsprechend - als ‘Gegeneliten’ die bestehenden Machteliten an [...], so wählen sich die Garden des Ressentiments der ‘kleinen Leute’ die Schwachen der Gesellschaft - Asylsuchende, Obdachlose, Behinderte - zum Opfer: Die ihrer Ansicht nach zu Unrecht Unterprivilegierten stürzen sich auf andere Unterprivilegierte, Randgruppen auf Randgruppen“ (Lau/Soeffner in Bergmann/Erb 1994: 21).
Mit Blick auf die Erhebungen der Innenministerien (vgl. Bundesminister des Innern 1993, Bundesministerium des Innern 1994, Bundesministerium des Innern 1997, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein 1993, Innenministerium des Landes Baden-Württemberg 1994, Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern 1994) muß festgehalten werden:
(a) Rechtsextreme Organisationen und Parteien wie die z.T. verbotenen FAP, GdnF, NDP/JN, DA („Deutsche Alternative“), NA („Nationale Alternative“), ANS („Aktionsfront Nationaler Sozialisten“) etc. betreiben in ihren Programmen und Äußerungen eindeutig oder verdeckt verfassungsfeindliche Agitation (Beispiele von Aufklebern der NPD/JN: „BRD heißt das System, morgen wird es untergehn!“, „Das System hat keine Fehler! Das System ist der Fehler!“ - zit. nach Bundesministerium des Innern 1994: 131 - s. hier auch weitere Beispiele für explizite Äußerungen gegen das „System“ und alles, was darunter verstanden wird). Zunehmend wird hier auch, ganz ähnlich dem Linksextremismus, Feindseligkeit gegenüber dem Kapitalismus und einflußreichen Persönlichkeiten in Politik und Wirtschaft geschürt.
(b) Im vorpolitischen und unorganisierten Feld, für das hier exemplarisch die Skinheadszene als Pendant zur Punk-, Autonomen- und Antifaszene steht, zeigt sich dagegen kein „geschlossenes politisches Weltbild“ (Pfahl-Traughber 1993: 153). Die Vorstellungen bleiben diffus und ideologisch schwer faßbar, „daher artikulieren sich die politischen Vorstellungen der Skins auch nicht durch fundierte programmatische Ideologien, sondern durch Aktionen gegen Angehörige als gegnerisch eingeschätzter gesellschaftlicher Gruppen“ (Pfahl-Traughber 199: 154). Zwar gibt es Tendenzen zu neonationalsozialistischem Gedankengut, Faschismus und argumentationsfähige Parlamentarismuskritik als gefestigte theoretisch-ideologische Basis dürften hier allerdings kaum anzutreffen sein.
„Entlang der beschriebenen rassistischen Orientierung entwickelte sich auch jene diffuse Skinhead-Weltanschauung heraus, die aus den folgenden Ideologiefragmenten besteht: Die als ‘Herrenrasse’ angesehene ‘weiße Rasse’ gelte es vor der Bedrohung durch ‘Rassenvermischung’ und eine ‘multikulturelle Gesellschaft’ zu bewahren. Von daher müsse auch gegen ‘jüdische Machenschaften’, Kommunismus und Kapitalismus sowie die parlamentarische Demokratie vorgegangen und ein anderes politisches System begründet werden“ (Pfahl-Traughber 1993: 155).
Es fällt also schwer, hier den Begriff „Fundamentalopposition“ anzuwenden. Denn Opposition setzt voraus, daß eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem System geführt wird, das es zu alternieren gilt. Dies findet hier nicht statt - wie schon angeklungen, sind Diskurs und Argumentation nicht Absichten der rechten Subkultur, sondern allenfalls Konfrontation. Die bisher aufgezeigten Facetten rechter, „kultureller“ Bestrebungen deuten auch nicht auf ein konsequent oppositionelles Verhalten hin. Die Gegnerschaft gegenüber dem Bestehenden scheint sich vielmehr aus dem Gefühl der rechten Protagonisten zu begründen, auf irgendeine Weise gegenüber anderen benachteiligt zu sein. Unzufriedenheit mit der eigenen, individuellen Situation, das (wenn auch nicht immer selbstverschuldete) Unvermögen, diese Situation zu verbessern oder wenigstens zu ändern, sind wichtige Ursachen für die Suche nach „Gegnern“, nach Opponenten, an denen man die Frustration über die eigene Ohnmacht austoben kann. Diese Überlegung korreliert durchaus mit der Studie von Bergmann/Erb oder den Feststellungen Farins, in denen die neue rechte Jugendkultur als typische Erscheinung der modernen, individualisierten und pluralisierten Gesellschaft gesehen wird. Nicht mehr übergesellschaftliche Ziele zur Behebung der vermeintlichen oder realen Mißstände sind es, wie etwa noch bei der Linken der sechziger und siebziger Jahre, welche das Individuum zur Aktion schreiten lassen, sondern der Versuch, Sündenböcke für die eigene desolate oder als solche empfundene Lage zu finden, um sich an diesen abreagieren zu können. Eine leitende Ideologie ist im Grunde nicht wichtig, darauf zielt auch nicht die Demagogie der rechten Parteien, die
Ausländer zu denjenigen erklären, welche die Arbeitsplätze vereinnahmen und die Kriminalitätsrate steigern. Tatsächlich ist es das Individuum, vielmehr dessen Unzufriedenheit, das es anzusprechen gilt, und das angesprochen wird und sich im schlimmsten Fall durch Gewalt äußert.
Schluß
„Rechte Subkultur“ weist viele verschiedene Aspekte auf. Festzuhalten bleibt, daß eine Einheitlichkeit im Gedankengut und der Ausdrucksform nur schwer zu erkennen ist, dafür sind die Fraktionen zu unterschiedlich. Also ist auch „Neonationalsozialismus“ kein geeigneter Begriff, um dem Thema in seiner Komplexität gerecht zu werden. Vielmehr reicht das Spektrum von tatsächlich am Dritten Reich orientierten Gruppierungen bis zu „Oi-Punks“ über viele Zwischenstationen. Dabei zeigt sich allerdings ein Übergewicht bei den jüngeren Generationen, und hier kann, ganz besonders im Hinblick auf die am auffälligsten agierende Skinheadszene mit ihren ausgeprägten subkulturellen Merkmalen, die Frage nach einen „neuen rechten Jugendkultur“ eindeutig beantwortet werden: Modernisierung, Ausdifferenzierung und daraus folgende Anpassung an zeitgenössische Jugendszenen und -“kulturen“ haben in den achtziger Jahren zur Entstehung einer Jugendsubkultur geführt, die es in dieser Form zuvor nicht gegeben hat, und der mehrfach Gleichrangigkeit mit anderen jugendlichen Subkulturen zugebilligt wird.
Genauso wird bei den anderen Jugendszene-Phänomenen der achtziger und neunziger Jahren, zeigen aber auch hier Pluralisierung und Individualsierung ihre Wirkung: Es geht nicht um den Entwurf von Perspektiven mit Gesamtanspruch. Das Individuum ohne ausgeprägte Führerschaft steht im Mittelpunkt und agiert, indem es individuellen und möglicherweise egoistischen Zielen folgt. Die daraus entstehenden negativen Folgen sind der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zuzuschreiben, andererseits regt die Vielfalt der Jugendszenen und der individualistische Anspruch zu der Überlegung an, ob es nicht der positive Effekt dieser Entwicklung sein könnte, daß sich das Individuum nicht mehr so schnell einer massenkonformen Gleichschaltung beugt.
Literatur
Bergmann, Werner / Erb, Rainer (Hrsg.): Neonazismus und rechte Subkultur. Berlin 1994
Bundesminister des Innern (Hrsg.): Extremismus und Gewalt. Band I. Bonn 1993
Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Verfasssungsschutzbericht 1993. Bonn 1994
Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Texte zur Inneren Sicherheit. Bonn 1997
Butterwege, Christoph / Isola, Horst (Hrsg.): Rechtsextremismus im vereinten Deutschland. Randerscheinung oder Gefahr für die Demokratie? Berlin 1990
Endlich, Hans / Grix, Rolf / Willberg, Klaus: Extremismus, Radikalismus, Demagogie von rechts. Entwicklungen und Bestandsaufnahme. Frankfurt a.M. 1990
Hartmann, Ulrich / Steffen, Hans-Peter / Steffen, Sigrid: Rechtsextremismus bei Jugendlichen. Anregungen, der wachsenden Gefahr entgegenzuwirken. München 1985
Hasselbach, Ingo / Bonengel, Winfried: Die Abrechnung. Ein Neonazi steigt aus. Berlin 1993
Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.): Skinheads in Schleswig-Holstein. Kiel 1993
Innenministerium des Landes Baden-Württemberg (Hrsg.): Verfassungsschutzbericht 1993. Stuttgart 1994
Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.): Skinheads. Rostock 1994
Möller, Kurt / Schiele, Siegfried (Hrsg.): Gewalt und Rechtsextremismus. Ideen und Projekte für soziale Arbeit und politische Bildung. Schwalbach 1996
Pfahl-Traughber, Armin: Rechtsextremismus. Eine kritische Bestandsaufnahme nach der Wiedervereinigung. Bonn 1993
Stock, Manfred / Mühlberg, Philipp: Die Szene von Innen. Skinheads, Grufties, Heavy Metals, Punks. Berlin 1990
Bevorzu gt v erw end ete K apitel/A u fsätze/A rtik el:
Brumlik, Micha: „Der Prozeß der Rebarbarisierung. Interaktion von Politik und anomischer Jugend“ in Otto, Hans-Uwe / Merten, Roland (Hrsg.): Rechtsradikale Gewalt im vereinigten Deutschland. Jugend im gesellschaftlichen Umbruch. Bonn 1993. 55-63
Farin, Klaus: ”Skinheads” in Möller, Kurt / Schiele, Siegfried (Hrsg.): Gewalt und Rechtsextremismus. Ideen und Projekte für soziale Arbeit und politische Bildung. Schwalbach 1996. 118-127
Jüngel, Sebastian: „Hakenkreuze im Netz“ in FAZ Hochschul-Anzeiger 37 (SS 1998). 26
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über die rechte Jugendszene?
Die Arbeit untersucht die soziokulturelle Struktur und die Kommunikationsmittel der rechten Jugendszene in Deutschland seit den 1980er Jahren. Sie analysiert, ob es sich um eine eigenständige Subkultur handelt, die eine Fundamentalopposition gegen das politische System betreibt, ähnlich wie linke Subkulturen in der Vergangenheit.
Was sind die Hauptmerkmale der rechten Jugendszene?
Die rechte Jugendszene zeichnet sich durch eine Zunahme jugendlicher Mitläufer, Sympathisanten und Täter aus. Sie hat sich modernisiert und ausdifferenziert, indem sie Elemente der populären Jugendkultur übernommen hat. Die Szene ist heterogen, mit verschiedenen Organisationen und Richtungen, von traditionellen Neonationalsozialisten bis hin zu Skinheads und Hooligans.
Welche Rolle spielen Skinheads in der rechten Jugendszene?
Skinheads sind eine markante Erscheinungsform der rechten Jugendkultur. Sie haben eine eigene Lebenseinstellung, Mode, Musik und Kommunikationsmittel. Die Arbeit untersucht die Ursprünge der Skinheadbewegung in Großbritannien und ihre Entwicklung in Deutschland, wobei sowohl unpolitische als auch rechtsextreme Einflüsse berücksichtigt werden.
Wie hat sich der Rechtsextremismus im Laufe der Zeit verändert?
Früher war der Rechtsextremismus durch das Festhalten an einer antimodernen Ideologie, völkischen Stilelementen und straffer Organisation geprägt. Inzwischen hat er sich modernisiert, indem er Formen und Ausdrucksweisen der internationalen populären Jugendkultur übernommen hat. Dies hat jedoch auch zu Widersprüchen und Konflikten innerhalb der Szene geführt.
Welche Kommunikationsmittel werden in der rechten Jugendszene genutzt?
Die rechte Jugendszene nutzt verschiedene Kommunikationsmittel, darunter szeneinterne Medien wie Mailboxen, das Internet, Videomittschnitte, Kassetten, Infotelefone und vor allem Fanzines. Diese Medien dienen der Verbreitung von Symbolen, Inhalten und Deutungsmustern.
Inwiefern ist die rechte Jugendszene eine Subkultur?
Die Arbeit diskutiert, ob die rechte Jugendszene als Subkultur bezeichnet werden kann. Einige Forscher betonen, dass sie keine Innovation, sondern nur Epigonentum darstellt. Andere sehen sie als Teil des modernen Spektrums der Jugendkulturen, die sich durch Habitus und Stil in den Formen moderner Populärkultur artikuliert.
Welche Rolle spielt Gewalt in der rechten Jugendszene?
Gewalt ist ein wichtiges Thema in der rechten Jugendszene, insbesondere bei den Skinheads. Die Arbeit untersucht die Ursachen und Ausprägungen von Gewalt in diesem Kontext und diskutiert, inwieweit politische Motive eine Rolle spielen.
Betreibt die rechte Jugendszene eine Fundamentalopposition gegen das System?
Die Arbeit untersucht, ob die rechte Jugendszene eine systemfeindliche Einstellung vertritt, ähnlich wie linke Subkulturen. Während einige rechtsextreme Organisationen und Parteien verfassungsfeindliche Agitation betreiben, fehlt im vorpolitischen Feld, wie der Skinheadszene, oft ein geschlossenes politisches Weltbild. Stattdessen dominiert diffuser Fremdenhass und das Gefühl, benachteiligt zu sein.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die rechte Jugendszene eine Jugendsubkultur darstellt, die sich durch Modernisierung, Ausdifferenzierung und Anpassung an zeitgenössische Jugendszenen und -kulturen entwickelt hat. Sie betont jedoch auch, dass Pluralisierung und Individualisierung eine wichtige Rolle spielen, wobei das Individuum im Mittelpunkt steht und individuellen Zielen folgt.
Woher stammen die Informationen in dieser Arbeit?
Die Informationen stammen aus verschiedenen Quellen, darunter Bücher, Artikel, Verfassungsschutzberichte und Studien zum Thema Rechtsextremismus und Jugendkulturen.
- Quote paper
- Stephan Kamps (Author), 1998, Neue rechte Subkultur?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99389