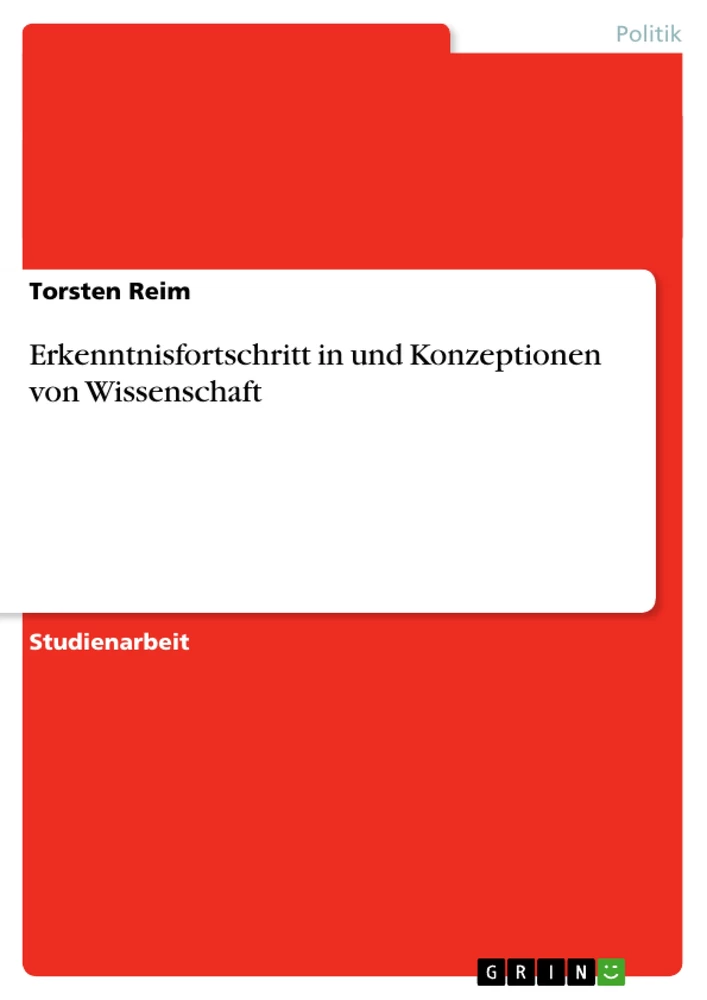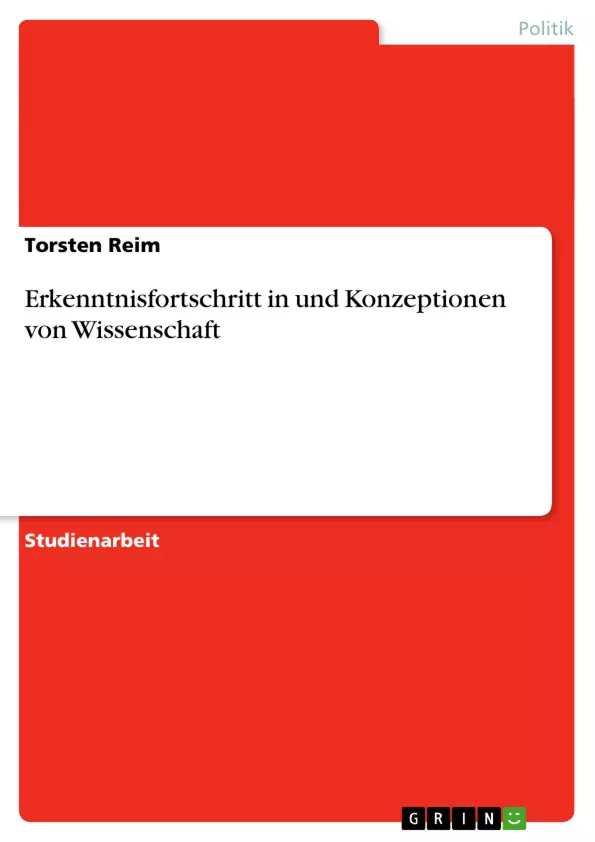Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Positivistisches Wisenschaftsverständnis
2.1 Der Terminus ,,Positivismus"
2.2 Die positivistische Auffassung einer Erklärung
2.2.1 Deduktiv-nomologische Erklärung
2.2.2 Induktiv-statistische Erklärung
2.3 Positivistische Auffassung von Theorien
2.3.1 Charakterisierung wissenschaftlicher Gesetze
2.4 Prozeß der Realisierung von Wissenschaftlichkeit
2.4.1 Konfirmationisten
2.4.2 Falsifikationisten
2.5 Beobachtungssprache und theoretische Sprache
3. Realistisches Wissenschaftsverständnis
3.1 Erklärung aus realistischer Perspektive
3.2 Die realistische Auffassung von Theorien
3.2.1 Zur Funktion von Modellen und Analogien in Theorien
3.2.2 Theoriegenerierung und -überprüfung
4 Kontrastierung von Positivismus und Realismus hinsichtlich der Funktion von Modellen und Analogien in wissenschaftlichen Theorien
5 Gemeinsame Merkmale von Positivismus und Realismus
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Wissenschaftstheorie stellt sich nicht als einheitliche Theorie wissenschaftlichen Handelns dar, wie die verwendete grammatikalische Form des Singular vermuten lassen könnte, sondern zeigt, je nach zugrunde liegenden epistemologischen Standpunkten, divergente Zugangsweisen zur Erzielung von Wissenschaftlichkeit auf. Dabei liegen auch hier divergente Konzeptionen bzw. Charakterisierungen von ,,Wissenschaftlichkeit" zugrunde. Die divergenten wissenschaftstheoretischen Positionen lassen sich durch zwei als besonders relevant erachteten Grundsatzfragen differenzieren: Die Frage nach der Möglichkeit subjektunabhängiger Erkenntis oder anders formuliert, die Frage nach dem Verhältnis von Realität und Beobachtung. Die zweite Frage, die zur Herausarbeitung und Darstellung der wissenschaftstheoretischen Positionen herangezogen wird setzt bei der Methode zur Erzielung von Erkenntnis an, nach erfolgter Klärung der Frage, wann je nach wissenschaftstheoretischer Position, von »Erkenntnis« gesprochen werden darf1. In der hier vorliegenden Arbeit werden die wissenschaftstheoretischen Positionen Positivismus und Realismus expliziert. Für jede der wissenschaftstheoretischen Positionen werden die grundlegenden Annahmen charakterisiert, deren Begründungen dargelegt und die zentralen Differenzen der Positionen verdeutlicht.
2. Positivistisches Wissenschaftsverständnis
2.1 Der Terminus ,,Positivismus"
Die Verwendung des Begriffs ,,Positivismus" ist als uneinheitlich zu charakterisieren. Der Terminus ,,[...]gehört zu den schillerndsten und kontroversiellsten Begriffen in den Sozialwissenschaften überhaupt [...]"2. So erfasst Peter Halfpenny zwölf Bedeutungen des Terminus ,,Positivismus"3 Die Ambiguität des Terminus machen es diffizil, überhaupt von ,,dem" Positivismus im Sinne von nur einer Konnotation zu sprechen. Das Extrahieren von Aspekten, die allen Positivismus-Auffassungen gemein sind, das heisst, die verschiedenen Definitionen immanent sind und divergente Konnotationen übergreifend sind, bringt folgende Charakteristika zutage. Unter Positivismus wird eine wissenschaftliche Konzeption verstanden, die nur das der Erfahrung zugänglich gegebene, ,,Wirkliche"- das heisst beobachtbarer ,,Tatsachen" - zum Gegenstand von Wissenschaft macht, um eine Loslösung bzw. Vermeidung von Spekulation, Metaphysik und Dogma4 zu erzielen. Der Positivismus ist - grob skizziert - ein am mechanistisch-naturwissenschaftlichen Vorgehen orientiertes Gedankensystem, das ,,die Quelle aller Erkenntnis auf das Gegebene, d.h. auf die durch Beobachtung gewonnenen (wahrnehmbaren) `positiven' Tatsachen"5 beschränkt wissen will, wobei die Tatsachen als gegeben und nicht als - durch zum Beispiel `soziale Optiken' - gesehen gelten. Alles ausserhalb dieser Begrenzung liegende wird als ausserwissenschaftlich erklärt. Dies insbesondere dann, wenn eine Verifikation oder Falsifikation mit erfahrungswissenschaftlichen Möglichkeiten nicht machbar ist6. Damit kann ,,Wissenschaft" definiert werden ,,[...] als eine systematische Tätigkeit, deren Ziel ein System von Sätzen ist, das auf die Wirklichkeit gerichtet ist - im Gegensdatz zu Metaphysik und Spekulation"7. Wird als Ausgangspunkt der Betrachtung des Begriffs ,,Positivismus" die der philosophischen Position gewählt, dann bezeichnet der Positivismus ganz analog eine radikalisierte Form des klassischen Empirismus8, der ebenso durch eine antimetaphysische und epistemologisch phänomenalistische Grundanschauung kennzeichenbar ist. Denker wie D.Hume und d'Allembert können dieser Position zugerechnet werden, obschon diese den Terminus ,,Positivismus" selbst nicht verwendeten.
Die originäre Herkunft des Begriffs ,,Positivismus" liegt bei Saint-Simon und A.Comte9.
2.2 Die positivistische Auffassung einer Erklärung
Die Erklärung eines Ereignisses besteht laut Positivismus darin, zu zeigen, dass es sich bei diesem Ereignis um eine Regularität handelt. Im folgenden wird die positivistische Auffassung einer Erklärung in der Form von Carl Hempel präsentiert. Dessen Zugang zu einer wissenschaftlichen Erklärung kann in mehrereren Hinsichtien als exemplarisch betrachtet werden. Unter dem Terminus der ,,deduktiv-nomologischen Erklärung" fand Hempels Erklärungsschema Eingang in die wissenschaftstheoretische Diskussion10. Als ein weiteres wichtiges Modell einer wissenschaftlichen Erklärung gilt die ,,induktiv-statistische Erklärung"11.
2.2.1 Deduktiv-nomologische Erklärung
Nach Hempel und Oppenheim besteht eine wissenschaftliche Erklärung in der logisch korrekten Ableitung von Ereignissen und Sachverhalten. Dabei muß sich das Ereignis bzw. der Sachverhalt aus mindestens einem allgemeinen Gesetz und aus einem anderen Ereignis, das als Anwendungsbedingung des allgemeinen Gesetzes anzusehen ist, zusammensetzen.Dabei wird das zu erklärende Ereignis als Explanandum, die zur Erklärung dieses Ereignisses herangezogenen Gesetze und Randbedingungen12 als Explanans bezeichnet:
,,Here scientific explanation is presented as a form of logical argument. The conclusion of the argument is a statement describing the event which is to be explained - [...]. This statment is termed `the explanandum -statement'. The premisses of the argument are of two kinds: statements of general laws, and statements of antecedent conditions. These are termed `the explanans -statements' [Hervorhebungen im Original, d. Verf.]"13
Um von einer wissenschaftlichen Erklärung sprechen zu können ist es notwendig, Bedingungen zu spezifizieren, die eine wissenschaftliche Erklärung erfüllen muss, will diese als eine solche gelten. Erfüllt die Erklärung die Bedingungen, dann liegt eine wissenschaftliche Erklärung vor.
2.2.2 Induktiv-statistische Erklärung
Anstelle des allgemeinen Gesetzes im deduktiv-nomologischen Erklärungsmodell steht in diesem Modell eine Wahrscheinlichkeitsaussage: ,,[...] in the I-S model, where, instead of universal laws, we have only statistical probabilities"14. Dabei bezieht sich die Wahrscheinlichkeitsaussage auf alle zu erklärenden Ereignisse oder Sachverhalte auf die die Anfangs- oder Ausgangsbedingungen zutreffen. Deshalb kann im konkreten Fall nicht vorausgesagt werden, ob ein Ereignis eintritt oder nicht. Läge ein Gesetz zugrunde, wäre eine eindeutige Prognose möglich. Eine Erklärung eines konkreten Ereignisses unter Rekurierrung auf eine Wahrscheinlichkeitsaussage ist infogedessen eingeschränkt. In diesem Sinne handelt es sich bei der Erklärung der induktiv-statistischen Methode um eine eingeschränkte gegenüber einer vollständigen Erklärung der deduktiv-nomologischen Methode. Um diesen Sachverhalt in den Worten v. Wright's darzulegen:
,,Es [das induktiv-statistische Schema, T.R.] erklärt in erster Linie, warum Dinge, die sich ereignet haben, zu erwarten (bzw. nicht zu erwarten) waren, und nur in einem sekundären Sinn erklärt es, warum sich bestimmte Dinge ereignet haben, nämlich, `weil' sie in hohem Maße wahrscheinlich waren. Es scheint mir jedoch besser, wenn man nicht sagt, dass das induktiv-probabilistische Schema erklärt, was sich ereignet, sondern lediglich, dass es gewisse Erwartungen und Voraussagen rechtfertigt"15
Das induktiv-statistische Methode stützt sich bei ,,Erklärungen" immer nur auf bestimmte empirische Daten bzw. auf induktiv ermittelte statistische Regelmäßigkeiten, demzufolge Hempel die Beziehung zwischen Explanans und Explanandum als ,,induktive Stützung" und nicht als deduktive Ableitung - wie im deduktiv-nomologischen Modell bezeichnet: ,,Zwischen Explanans und Explanandum besteht also nur eine Bestätigungsrelation, aber keine Ableitungsrelation"16 In anderem Wortlaut: ,,[...]; and the relationsship between premisses [das Explanans, T.R.] and conclusion [Explanandum, T.R.] is one of inductive probability, instead of deductive necessity"17. Das induktiv-statistische Modell ermöglicht die Prognose bzw. Erklärung des Eintretens bzw. Nicht-Eintretens eines bestimmten Ereignisses mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit; es können keine `deterministischen' Folgerungen in bezug auf das Explanandum getroffen werden, sondern nur solche, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit behaftet sind (deshalb: ,,induktive Stützung")18.
2.3 Positivistische Auffassung von Theorien
Innerhalb des Positivismus werden Theorien als aus generellen-uniniversellen Aussagen bzw. Aussagensystemen bestehend betrachtet, deren Wahrheit oder Inkorrektheit durch systematische Beobachtung und Experiemente beurteilt werden kann. Das Ergebnis dieser Beobachtungen und Experiemente kann entweder mit absoluter Sicherheit, oder aber mit einem höheren Grad an Sicherheit als anderes gelten. Eingeschlossen sind die Theorien, die unter Bezugnahme auf Beobachtung und Experimente beurteilt bzw. überprüft werden. Die generellen Aussagen wissenschaftlicher Theorien werden hierbei als ,,Gesetze" bezeichnet.
2.3.1 Charakterisierung wissenschaftlicher Gesetze
Auch hier existieren keine einheitlichen Kriterien innerhalb des positivistischen Wissenschaftsverständnisses zur Beschreibung dessen, wann von einer Aussage als einem wissenschaftlichen Gesetz gesprochen werden kann. Innerhalb des Positivismus werden weitesgehend folgende vier Kriterien zur Beurteilung ob es sich um eine wissenschaftliches Gesetz handelt oder nicht, akzeptiert.
1) Aussagen, die Gesetze ausdrücken müssen die syntaktische Form universeller Bedingung erfüllen. Formal und für einfache Fälle bedeutet dies die Form: Für alle x gilt, wenn x die Eigenschaft P hat, dann hat x die Eigeschaft Q. Beispielsweise gilt als wissenschaftliches Gesetz die Aussage, dass sich alle Planeten in elliptischen Bahnen bewegen. x=alle Planeten; P=bewegen; Q=elliptische Bahnen. Die syntaktisch korrektere Formulierung lautet: Alle Planeten bewegen sich in elliptischen Bahnen.
2) Solche Aussagen dürfen in ihrer Anwendungsbezug nicht auf ein räumliches Gebiet oder eine bestimmte Zeit oder Zeitspanne begrenzt sein. Sie müssen zeitlich und räumlich infinite Gültigkeit haben bzw. dürfen in ihrer Aussage, um als wissenschaftliches Gesetz zu gelten, keine Restriktion in zeitlicher und räumlicher Hinsicht enthalten. ,,Alle Menschen, die sich jetzt in diesem Raum aufhalten, sind sterblich" erfüllt offensichtlich das eben geschilderte Kriterium nicht.
3) Die Termini, die in wisseschaftlichen Gesetzen Verwendung finden, dürfen nicht partikulare und singuläre Sachverhalte bezeichnen.
4) Wissenschaftliche Gesetze drücken weder eine logische, noch emprische oder kausale Notwendigkeit, sondern ,,nur" eine Beziehung zwischen Gegebenheiten aus, deren Verifikation oder Falsifikation nur durch empirische Mittel erreicht werden kann. Zusammenhänge können a priori nicht erschlossen werden.
2.4 Prozess der Realisierung von Wissenschaftlichkeit
Im folgenden wird der Modus dargelegt, der laut Positivismus zur Erzielung von Wissenschaftlichkeit bzw. zur Erzielung von wissenschaftlichen Theorien führt. Dabei ist die Beziehung von Theorie und Beobachtung von höchster Relevanz, da innerhalb des Positivismus einzig Beobachtung eine objektive Grundlage der wissenschaftlichen Theoriebildung liefert.
Ein Merkmal wissenschaftlicher Theorien bzw. wissenschaftlicher Gesetze, das ,,moderne" Positivisten betonen, darf an dieser nicht unerwähnt bleiben. Eine zwangsläufig immer bestehende Limitation der Quantität der Beobachtungen zur Überprüfung bzw. Verifikation steht einer unlimitierten Quantität von Anwendungen gegenüber. Wissenschaftliche Sätze, insbesondere Gesetzte, sind empirisch nicht verifizierbar, da diese als unbeschränkte Allsätze formuliert eine unbeschränkte Quantität von Anwendungen involvieren, während für ihre Überprüfung bzw. Verifikation nur endlich viele Beobachtungen potenziell sind19. Theorien, Hypothesen und Gesetze können nicht verifiziert werden, sie können nur falsifiziert werden. Dies beruht auf der Annahme, dass sich wissenschaftliche Sätze - zum Beispiel in Form von Gesetzten - mit raum-zeitlich unbegrenztem Geltungsanspruch nicht verifizieren lassen20. Das heisst, einfach ausgedrückt, das eine abschließende, endgültige irreversible Verifikation eines wissenschaftlichen Gesetzes nicht möglich ist: ,,[...] no conclusive verification of scinetific theories is possible, [...]."21. Hiernach stellt sich die Frage, wie mittels empirischen Beobachtungsmaterials dennoch die Evaluierung von Theorien unter Berücksichtigung der soeben geschilderten Einschränkung, möglich ist. Hier lassen sich zwei Zugehensweisen unterscheiden: Die ,,Konfirmationisten" einerseits und die ,,Falsifikationisten" andererseits.
2.4.1 Konfirmationisten
Diese behandeln das logische Problem der Induktion indem von einer absoluten Bestätigung einer Theorie durch empirische Beobachtung zu einer graduellen Bestätigung gegangen wird. Die Binarität von Falsifikation oder Verifikation ohne Zwischenstufen wird aufgegeben zugunsten einer Vorstellung einer graduellen Zunahme oder Abnahme der Bestätigung einer Theorie. Damit wird der Anspruch einer absoluten Bestätigung aufgegeben. Je höher beispielsweise die Zahl an Beispielen ist, die mit den von einer Theorie deduzierten Voraussagen übereinstimmen, desto stärker bestätigt kann die Theorie gelten. Unterschiedliche Theorien können nach dem Grad der empirischen Bestätigung verglichen werden.
2.4.2 Falsifikationisten
Die sogenannten Falsifikationisten sehen in dem Ansatz der Konfirmationisten einen nutzlosen bzw. sinnlosen Ansatz. Es gibt keine Logik der Bestätigung sondern nur Falsifikation. Demzufolge sollten Beobachtungen einzig eingesetzt werden um zu zeigen, dass mutmassliche Theorien inkorrekt sind. Stellt sich eine aus einer Theorie deduzierte Voraussage als inkorrekt heraus, dann folgt daraus, dass die Theorie selbst inkorrekt ist. Die einzige Art deduktiver Relation, die zwischen Theorie und Beobachtung hergestellt werden kann ist der Art, nach der die Inkorrektheit einer Theorie der Inkorrektheit der Voraussagen folgt. Demzufolge kann eine wissenschaftliche Theorie nie bestätigt, sondern ,,nur" falsifiziert werden22. Das bedeutet, dass es innerhalb des Falsifikationismus des Positivismus, wie für den sogenannten Kritischen Rationalismus, keinen Abschluß der Erkenntnisbemühung gibt: ,,Es gibt danach keine fertige, da verifizierte Theorie. Theorien und Hypothesen gelten nur als vorläufig bewährt, solange sie nicht widerlegt sind, solange sie Falsifikationsversuchen widerstanden haben"23
2.5 Beobachtungssprache und theoretische Sprache
Das Auftreten theoretischer Termini in wissenschaftlichen Theorien generiert ein Problem innerhalb des Positivismus, das aus der grundlegenden Unterscheidung der wissenschaftlichen von anderen intellektuellen Aktivitäten24 resultiert. Der Positivismus lässt die Bezeichnung ,,wissenschaftlich" für Aussagen genau dann zu, wenn deren Wahrheit bzw. Falschheit durch Mittel der empirischen Beobachtung revidiert und evaluiert werden kann. Aussagen, denen theoretische Termini immanent sind und die auf Entitäten bezug nehmen, die nicht beobachtet werden können, erfüllen dieses positivistische Kriterium von Wissenschaftlichkeit offensichtlich nicht. Theoretische Aussagen gelten nach positivistischer Auffassung nur dann als wissenschaftlich, wenn ,,[...] they are construed in a way that does not involve ontological commitments to unobservable entities"25. Die Auffassung, nach der theoretische Termini auf tatsächlich exisitierende, aber unbeobachtbare Gegebenheiten bezug nehmen, wird demzufolge von Positivisten abgelehnt.
Die Auseinandersetzung der Positivisten mit dem Problem der theoretischen Termini findet ihren Ausdruck in der Konstruktion einer Dichotomy zwischen der theoretischen Sprache und der Beobachtungssprache26, sowie der Formulierung der ,,Korrespondenzprinzipien"27. Der Positivismus betrachtet die Beobachtungssprache als epistemologisch und ontologisch privilegiert, das heisst, dass die Wahrheit oder Falschheit von Aussagen, denen ausschliesslich Beobachtungsbegriffe immanent sind entweder mit absoluter Sicherheit oder aber mit einem größeren Grad an Sicherheit gewusst werden können, als Aussagen, die nicht- beobachtbare, das heisst theoretische Termini beinhalten. Epistemologisch privilegiert bedeutet darüberhinaus, dass Beobachtungsaussagen, das heisst Aussagen, die sich ausschliesslich aus ,,empirischen Begriffen" zusammensetzen, verifiziert oder falsifiziert werden können ohne Bezug auf die Wahr- oder Falschheit von theoretischen Aussagen. `Ontologisch privilegiert' bedeutet, dass Termini, die der Beobachtungssprache zuzurechnen sind, einzig ,,geeignet" sind einen echten Bezug zu Elementen bzw. Gegebenheit der physikalischen Welt herzustellen, da nur von solchen Elementen behauptet werden kann, dass diese tatsächlich existieren. Es sind diese Elemente, die die wissenschaftlichen Theorien nach positivistischer Auffassung zu erklären und zu prognostizieren versuchen.
3. Realistisches Wissenschaftsverständnis
In der realistischen Erkenntnistheorie (Realismus) wird davon ausgegangen, dass eine subjektunabhängige Wahrheit bzw. Wirklichkeitserkenntnis möglich ist. Hierbei ist zunächst zwischen einem naiven Realismus und einem kritischen Realismus zu differenzieren. Innerhalb des naiven Realismus sind die wahrnehmbaren Dinge unmittelbar gegebene, vom Erkennenden unabhängig bestehende Wirklichkeit (naiver Realismus); dagegen erkennt der kritische Realismus Bewusstseinsinhalte an, durch die die Wirklichkeit wahrgenommen wird.
3.1 Erklärung aus realistischer Perspektive
Realisten versuchen einen alternativen Zugang zu einer wissenschaftlichen Erklärung zu ermöglichen, der auf einer nicht-humeschen Ansicht der kausalen Relationen beruht28. Adäquate kausale Erklärungen benötigen sowohl die Entdeckung der regulären Relationen zwischen Phänomenen, als auch die Mechnismen, die diese verbinden. Um ein partikulares Phänomen zu erklären, darf nicht nur ein Bezug zu den Ereignissen hergestellt werdem, die den Impetus zur Veränderung liefern; es muß auch eine Beschreibung des Prozesses selbst erfolgen. Um dies zu bewerkstelligen, ist Kenntnis der zugrundeliegenden , vorhandenen Mechanismen und Strukturen notwendig, als auch Kenntnis darüber, wie diese das Phänomen generieren oder produzieren, das erklärt werden soll. Die Beschreibung der Mechanismen und Strukturen nimmt hierbei mitunter die Form einer Charakterisierung der ,,Natur" oder der inneren Konstitution der untersuchten Einheiten an. Um Kenntnis über die Mechanismen zu erhalten, ist die Konstitution, die ,,Zusammensetzung" der betrachteten Entität notwendig29. Diese realistische Ansicht einer Erklärung kann in der Behauptung zusammengefasst werden, dass Antworten auf Warum-Fragen - das heisst die Suche nach Kausalerklärungen - Antworten auf Wie- und Was-Fragen erfordern. Die Frage, warum etwas geschieht, warum sich etwas ereignet, erfordert das Aufzeigen dessen, wie ein Ereignis oder eine Veränderung einen neuen Zustand herbeiführt, indem der Modus beschrieben wird, nach dem die gegebenen Strukturen und Mechanismen auf die initiale Veränderung reagieren. Bedingung der Möglichkeit so zu verfahren, ist die Kenntnis des »Was«, des »Wesens« der involvierten Entitäten30.
3.2 Die realistische Auffassung von Theorien
Das vorrangige Ziel wissenschaftlicher Theorien besteht in der Ermöglichung der Verfügbarmachung kausaler Erklärungen beobachtbarer Phänomene und der Relationen, die zwischen diesen existieren31.Die Aufgabe von Theorien besteht in der Beschreibung dieser Strukturen und Mechanismen. Demzufolge ist das zentrale Merkmal einer wissenschaftlichen Theorie die Beschreibung dieser Sachverhalte und die Art und Weise, wie diese durch ihre Operationsweise die zahlreichen Phänomene hervorbringen, die erklärt werden sollen.
3.2.1 Zur Funktion von Modellen und Analogien in Theorien
Um eine vertiefende Darlegung der32 realistischen Auffassung von Theorien zu ermöglichen, wird im folgenden die Funktion von Modellen und Analogien innerhalb dieser Theorien betrachtet. Aus der Sicht des Realismus ist es wichtig zwischen einem Modell, der Quelle des Modells und dem Objekt33 des Modells zu unterscheiden. Ein Modell ist ein Versuch der Repräsentation der Natur bzw. eines Ausschnitts der Natur34, der selbst das Objekt des Modells liefert; es wird analog zur Quelle in Beziehung gesetzt, die ein bereits verstandenes Phänomen ist. Modelle werden aus einer Quelle gebildet und beziehen sich auf ein Objekt. Mit anderen Worten und vereinfacht formuliert: Die ,,Quelle" liefert das Material der Modellbildung. Per Analogieschluß wird von dem generierten Modell auf das Objekt geschlossen.
Es handelt sich um Modelle, die ,,[...] einen Gegenstandsbereich oder Auschnitte davon in einer affinen Form analog replizieren"35. Inhaltlich analog, aber amerikanischer Provenienz: ,,[...], a model is an attempted representation of the nature of that which is the subject of the model; it is analogically related to ist source, [...]36.
In dieser Zugehensweise zu Modellen sind die Konzepte der Analogie und der Repräsentation wichtig. Die Behauptung, es existiere eine Analogie zwischen zwei Gegebenheiten bedeutet die Behauptung der Existenz von Ähnlichkeiten und Unterschiedlichkeiten bezüglich ihrer inkongruenten Merkmale: ,,Der Analogieschluß basiert auf der partiellen Übereinstimmung von Objekten in irgendwelchen Eigenschaften oder Relationen"37. Das heisst, das Modelle auf einer Ähnlichkeitsbeziehung mit dem zu modellierenden Gegenstand basieren. Das Verhältnis ist vergleichbar mit Metaphern, die ebenso einen partiellen Bezug zum thematisierten Gegenstand haben.
Der Analogie bzw. - besser formuliert - dem Analogieschluss liegt implizit die Annahme zugrunde, dass Phänomene nicht zufällig in gewissen Merkmalen einander ähnlich sind, sonder deshlab, da ihnen eine bestimmte Struktur zugrundeliegt.
Das Konzept der Repräsentation stellt sich als problematischer heraus. Innerhalb des Realismus werden Modelle als Versuche zur Beschreibung von Strukturen und Mechanismen betrachtet, bei denen ein Zugang mittels Beobachtung nicht möglich ist. Die Beschreibung oder Repräsentation, die ein Modell typischerweise liefert involviert zahlreiche verschiedene Formen der Abstraktion und Idealisierung der tatsächlichen Merkmale seines Subjektes. Es wird versucht, mit den bekannten Relationen eines Modells via Analogieschluß noch unbekannte Merkmalsrelationen oder Elementrelationen des betrachteten Gegenstandsbereichs zu beschreiben. Ob eine solche Beschreibung oder Repräsentation gegenstandsadäquat ist bleibt offen.
3.2.2 Theoriegenerierung und -überprüfung
Um beobachtbare Phänomene und die Regularitäten zwischen ihnen zu erklären, muss der Wissenschaftler versuchen, relevante Strukturen und Mechanismen zu entdecken. Da es typischerweise nicht möglich ist diese der Beobachtung zugänglich zu machen, muss zunächst ein Modell dieser Strukturen und Mechanismen konstruiert werden38. Das Modell ist von solcher ,,Beschaffenheit", dass es die Strukturen und Mechanismen korrekt repräsentiert um eine kausale Erklärung des Phänomens zu ermöglichen. Das konstruierte Modell wird im folgenden in Form einer hypothetischen Beschreibung an tatsächlich existierenden Entitäten und deren Relationen getestet. Um so verfahren zu können, werden weitere Konsequenzen aus dem Modell gefolgert, die einem empirischen Test zugänglich gemacht werden können. Mit anderen Worten: Werden neben den positiven Analogien auch die neutralen Analogien auf den Gegenstandsbereich übertragen, resultieren daraus möglicherweise Indizien auf weitere Attribute bzw. ,,[...] neue Beschreibungs- und Erklärungsmöglichkeiten des Gegenstands"39.Verlaufen die anschliessenden Tests, das heisst die empirische Überprüfung hinsichtlich deren Kompatibilität mit dem Gegenstand erfolgreich, so können die Strukturen und Mechanismen als existent angenommen werden und stellen ein adäquate Erklärung des originalen Phänomens dar.
Letzlich kann der Prozess der Modellgenerierung wiederholt werden um bereits endeckte Strukturen und Mechanismen zu erklären40.
4 Kontrastierung von Positivismus und Realismus hinsichtlich der Funktion von Modellen und Analogien in wissenschaftlichen Theorien
Die Divergenz zwischen Positivismus und Realismus hinsichtlich der Frage nach der Konstituierung einer adäquaten wissenschaftlichen Theorie resultiert aus differenten Konzeptionen der Modelle und der Analogien. Die positivistische Auffassung, nach der die Generierung von Theorien aus Aussagen entweder empirischer oder theoretischer Gesetze erfolgt, besteht keine Funktion für Modelle, die, nach realistischer Auffassung, Beschreibungen tatsächlich existierender Strukturen und Mechanismen sind. Es ist demzufolge irreführend, wenn gesagt wird, dass Positivisten derartigen Modellen eine nur heuristische Funktion zusprechen, weil aus deren Sicht eine Funktion dieser Art, das heisst einer Art aus Sicht des Realismus, überhaupt nicht vorstellbar ist.
5 Gemeinsame Merkmale von Positivismus und Realismus
Positivismus und Realismus teilen eine Konzeption von Wissenschaft als objektive, rationale Untersuchung bzw. Forschung, deren Ziel wahre Erklärungen und Prognostizierbarkeit einer externen Realität sind. Dabei ist zu beachten, dass das Konzept der ,,Objektivität" zweierlei Aspekte beinhaltet: Erstens die Idee, dass wissenschaftliche Theorien objektiv bemessbar bzw. beurteilbar sind durch Bezugnahme auf empirisches Beweissmaterial .
Als zweite Vorstellung von ,,Objektivität" ist die Idee zu nennen, nach der ,,Objekte" als existent anzunehmen sind, die unabhängig von Glauben, Denken und Theorien sind. Dies bedeutet die Ablehung der Vorstellung, nach der Theorien die Sicht der Realität bestimmen. Wissenschaft ist beschreibende und nicht konstruierende Tätigkeit dessen, was existent ist. Bei Betrachtung des Konzepts der Rationalität teilen Positivismus und Realismus die Vorstellung, dass es generelle Standards von Wissenschaftlichkeit gibt, dass es Kriterien gibt, die messbar machen, ob eine Erklärung eine adäquate, das heisst wissenschatliche Erklärung ist. Beiden Konzeptionen von Wissenschaftlichkeit ist auch die Vortsellung gemeinsam, dass es einen Standard zur Erzielung wissenschaftlicher Theorien gibt und wie eine empirische Überprüfung eingesetzt werden soll um eine Theorie zu verifizieren oder zu falsifizieren. Trotz des Bestehens einer Uneinigkeit darüber, wie diese Standards je nach wissenschaftstheoretischer Position auszusehen haben, wird die Vorstellung geteilt, dass diese Standards existieren und dass diese eingesetzt werden können um die wissenschaftliche Praxis zu bewerten.
Literaturverzeichnis
Balzer, W.: Die Wissenschaft und ihre Methoden, Freiburg / München 1997;
Dreier, V.: Empirische Politikforschung, München / Wien 1997;
Eberhard, K.: Einführung in die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, 2.Aufl., Stuttgart / Berlin / Köln 1987;
Føllesdal, D./ Walløe, L. / Elster, J.: Rationale Argumentation, Berlin / New York 1988;
Friedrichs, J.: Methoden empirischer Sozialforschung, 14.Aufl., Opladen 1980;
Groom, A.J.R. / Light, M. (Hrsg.): Contemporary International Relations, London / New York 1994;
Keat, R. / Urry, J.: Social theory as science, London 1975;
Konegen, N. / Sondergeld, K.: Wissenschaftstheorie für Sozialwissenschaftler, Opladen 1985;
Kromka, F.: Sozialwissenschaftliche Methodologie, Paderborn 1984;
Musgrave, A.: Alltagswissen, Wissenschaft und Skeptizismus, Tübingen 1993;
Rogge, K.-E. (Hrsg.): Methodenatlas, Berlin / Heidelberg / New York 1995.
Wenturis, N. / Van hove, W. / Dreier, V.: Methodologie der Sozialwissenschaften, Tübingen 1992;
[...]
1 Die Operation der Differenzierung anhand einer Orientierung an zwei Grundsatzfragen kann durchaus kritisch im Sinne von unzulänglich oder unzureichend hinsichtlich der Themenkomplexität gesehen werden. Die Idee und den Mut, dies dennoch zu versuchen, findet sich in Rogge, K.-E. (Hrsg.): Methodenatlas. Für Sozialwissenschaftler, Berlin / Heidelberg / New York 1995, S.34. Eine Begründung für ein derartiges Vorgehen findet sich nicht.
2 Endruweit, G./Trommsdorf, G. (Hg.): Wörterbuch der Soziologie, Stuttgart 1989, S.498.
3 Vgl. Halfpenny, P.: Positivism and Sociology, London u.a. 1982.
4 Die Vermeidung von Spekulation, Metaphysik und Dogma zeigt sich in der zweiten logischen Adäquatheitsbedingung der deduktiv-nomologischen Erklärung. Die Bestätigung oder Widerlegung des Explanans muss durch Erfahrungen erfolgen. Das Explanans muss empirischen Gehalt haben, ,,d.h. es muss jedenfalls im Prinzip durch Erfahrungen bestätigt oder oder widerlegt werden können. Diese Forderung nach empirischen Gehalt ist natürlich dafür bestimmt, Pseudoerklärungen durch Berufung auf metaphysische Instanzen wie Gottes Willen, Platons Ideen, die immanente Logik des historischen Prozesses, die Bestimmung der germanischen Völker usw. als Erklärungsprinzipien auszuschliessen", in: Patzig, G.: Erklären und Verstehen. Bemerkungen zum Verhältnis von Natur- und Geisteswissenschaften, in: Neue Rundschau, Jg.84, 1973, S.398; vgl. auch Wenturis, N. / Van hove, W. / Dreier, V.: Methodologie der Sozialwissenschaften, Tübingen 1992, S.375.
5 Klaus, G. / Buhr, M. (Hrsg.): Philosoiphisches Wörterbuch, Bd.1 und 2, 12.Aufl., Leipzig 1976, S.954.
6 Vgl. Hillmann, K.-H.: Wörterbuch der Soziologie, 4.Aufl., Stuttgart 1994, S.681.
7 Konegen, N. / Sondergeld, K.: Wissenschaftstheorie für Sozialwissenschaftler, Opladen 1985, S.22; vgl. auch Alemann, U.v. / Forndran, E.: Methodik der Politikwissenschaft. Eine Einführung in Arbeitstechnik und Forschungspraxis, Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz 1974, S.39.
8 Siehe zum ,,Klassischen Empirismus": Wenturis u.a., a.a.O., S.55ff.
9 Endruweit/Trommsdorf, a.a.O., S.498.
10 Vgl. zur systematischen Ausarbeitung der deduktiv-nomologischen Erklärung von Hempel und Oppenheim: Hempel, C.G. / Oppenheim, P.: Studies in the Logic of Explanation, in: Hempel, C.G.: Aspects of Scientific Explanation, London 1965.
11 Vgl. dazu Hempel, C.G.: Aspekte wissenschaftlicher Erklärung, Berlin / New York 1977, S.59ff. Zusätzlich wird hier das ,,deduktiv-statistische Erklärungsmodell" dargelegt, das in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt wird.
12 Der Ausdruck ,,Randbedingung" ist missverständlich, da er Nebensächlichkeit vortäuscht. Dabei sind es die Randbedingungen - auch Antecedensbedingungen genannt - die ,,die jeweils gegebenen individuellen, einmaligen, von Fall zu Fall wechselnden Sachverhalte" betreffen und damit die Konkretheit eines Ereignisses konstituieren. Zitat aus: Seiffert, H.: Einführung in die Wissenschaftstheorie, Bd.1, 6.Aufl., München 1973, S.150.
13 Keat, R. / Urry, J.: Social theory as science, London 1975, S.10.
14 Keat / Urry, a.a.O., S.13.
15 Wright, Georg H. v.: Erklären und Verstehen, Frankfurt am Main 1974, S.26.
16 Wenturis u.a., a.a.O., S.374.
17 Keat / Urry, a.a.O., S.13.
18 Eine Unterscheidung - auf die hier nicht vertieft eingegangen wird - ist zwischen der statistischen und der induktiven Wahrscheinlichkeit zu treffen. Das verewendete Gesetz enthält eine statistische Wahrscheinlichkeit; die induktive Wahrscheinlichkeit gibt den Grad der Sicherheit oder Betsätigung des Explanandums relativ zu den Aussagen des Explanans an. Siehe: Friedrichs, J.: Methoden empirischer Sozialforschung, 14.Aufl., Opladen 1990, S.67; Wenturis u.a., a.a.O., S.373 und S.379.
19 Vgl. Wenturis, N. / Van hove, W. / Dreier, V, a.a.O., S.104.
20 Auch im Bereich der Konfirmationisten wird nicht von Verifikation gesprochen, sonder ,,nur" von ,,Bestätigung" oder auch Unterstützung einer Theorie durch empirische Beobachtung. Siehe zur sorgfältigen Verwendung der Termini ,,verification", ,,falsification" und ,,confirmation" Keat, R. / Urry, J.: Social theory as science, London 1975, S.15.
21 Keat, R. / Urry, J.: a.a.O., S.15.
22 Mit dieser falsifikationistischen Position wird oft eine generellere Perspektive der Theoriegenerierung und -überprüfung assoziert, die als hypothetisch-deduktive Methode bezeichnet wird und insbesondere im Werk Karl Popper's zum Ausdruck kommt. Siehe hierzu: Keat / Urry, a.a.O., S.16; Konegen / Sondergeld, a.a.O., S.83f; eine detaillierte Darlegung zum Kriterium der Falsifizierbarkeit findet sich in: Wenturis u.a., a.a.O., S.104ff.
23 Konegen / Sondergeld, a.a.O., S.83.
24 Beispielsweise sind zu diesen intellektuellen Aktivitäten Metaphysik, Theologie oder Ethik zuzurechnen.
25 Keat / Urry, a.a.O., S.18.
26 Theoretische Sprache beinhaltet theoretische, nicht-empirische Termini; Beobachtungssprache beinhaltet ein Begriffskontingent der Empirie.
27 Auch ,,Zuordnugsregeln", ,,Brückenprinzipien" oder ,,Zuordnungsprinzipien"; vgl.: Keat / Urry, a.a.O., S.20f; Føllesdal, D. / Walløe, L. / Elster, J.: Rationale Argumentation, Berlin / New York 1988, S.91-93.
28 Die Humesche Sicht kausaler Zusammenhänge liefert die Grundlage der positivistischen Analyse der wissenschaftlichen Erklärung. Aufgrund der Intention des Realismus, ,,Erklärung" auf der Grundlage einer nicht-humeschen Sichtweise von Kausalität, desavouiert der Realismus den positivistischen Zugang zu einer Erklärung .
29 Bisher unwiderrufene Gesetze, die Zusammenhänge zwischen Temperatur, Volumen und Druck von Gasen herstellen, sind bekannt. Die Erklärung des Temperaturanstiegs eines Gases setzt nun beispielsweise nach realistischer Auffassung Kenntnis der ,,Konstitution", der Zusammensetzung des Gases voraus.
30 Vgl. zu diesem Kapitel: Keat / Urry, a.a.O., 27-32.
31 Erklärungen müssen, wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt wirde, auf zugrundeliegende Strukturen und Mechanismen des kausalen Prozesses bezug nehmen.
32 Umfassend zu Modellen: Rogge (Hrsg.): Theorie und Modell, in: ders., a.a.O., S.236ff; Wenturis u.a.: Modellbildung im Bereich der Wissenschaft, in: dies., a.a.O., S.361ff; Balzer, W.: Modelle, in: ders.: Die Wissenschaft und ihre Methoden, Freiburg / München 1997, S.89ff.
33 Das amerikanische ,,subject", das Keat / Urry verwenden muss mit Objekt übersetzt werden, da es sich um einen Gegenstandsbereich handelt.
34 Inhaltlich analog, in anderem Wortlaut: ,,`Modell' wird hier ähnlich wie `Struktur' im Sinne von `Bild oder Konstrukt eines Systems' verstanden: Modelle sind `begriffliche Bilder', Konstrukte oder Repräsentanten realer Systeme", Balzer, W.: Die Wissenschaft und ihre Methoden, Freiburg / München 1997, S.89f.
35 Rogge (Hrsg.), a.a.O., S.236.
36 Keat / Urry, a.a.O., S.33.
37 Rogge (Hrsg.), a.a.O., S.237.
38 Die Theoriegenerierung durch das induktive Verfahren bzw. die induktive Vorgehensweise des Positivismus wird von seiten des Realismus abgelehnt, da Induktion - aus partikularen Beobachtungen Generalisierungen zu bilden - nicht das Postulat nicht-beobachtbarer Entitäten erfüllen kann. Der Prozeß der und zur Generalisierung ist kein Prozeß, der sich von beobachtbaren zu unbeobachtbaren Strukturen und Mechanismen vollzieht.
39 Rogge (Hrsg.), a.a.O., S.239.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine vergleichende Analyse des Positivismus und Realismus in der Wissenschaftstheorie, mit einem besonderen Fokus auf ihre unterschiedlichen Verständnisse und Anwendungen von Modellen und Analogien in wissenschaftlichen Theorien.
Was sind die Hauptmerkmale des positivistischen Wissenschaftsverständnisses laut diesem Text?
Der Positivismus, wie in diesem Text dargestellt, betont die Bedeutung empirischer Beobachtung als Grundlage für wissenschaftliche Erkenntnis. Er lehnt Spekulation und Metaphysik ab und konzentriert sich auf beobachtbare Tatsachen. Er umfasst Modelle wie die deduktiv-nomologische und induktiv-statistische Erklärung, sieht Theorien als universelle Aussagen, die durch Beobachtung und Experimente überprüft werden können, und unterscheidet zwischen Beobachtungs- und theoretischer Sprache.
Was ist die deduktiv-nomologische Erklärung im positivistischen Kontext?
Die deduktiv-nomologische Erklärung ist ein Erklärungsmodell, das davon ausgeht, dass eine wissenschaftliche Erklärung in der logisch korrekten Ableitung von Ereignissen und Sachverhalten besteht, basierend auf allgemeinen Gesetzen und Anwendungsbedingungen (Randbedingungen).
Was ist die induktiv-statistische Erklärung im positivistischen Kontext?
Die induktiv-statistische Erklärung verwendet Wahrscheinlichkeitsaussagen anstelle von allgemeinen Gesetzen. Sie erklärt, warum Ereignisse zu erwarten waren, basierend auf empirischen Daten und statistischen Regelmäßigkeiten, und bietet eine eingeschränktere Erklärung im Vergleich zur deduktiv-nomologischen Methode.
Wie charakterisiert der Text wissenschaftliche Gesetze im Positivismus?
Wissenschaftliche Gesetze müssen universelle Bedingungen erfüllen, in ihrer Anwendung nicht auf einen bestimmten Raum oder Zeit begrenzt sein, dürfen keine partikularen Sachverhalte bezeichnen und drücken eine empirisch überprüfbare Beziehung zwischen Gegebenheiten aus.
Was sind Konfirmationisten und Falsifikationisten im Bezug auf den Positivismus?
Konfirmationisten gehen von einer graduellen Bestätigung einer Theorie durch empirische Beobachtung aus, während Falsifikationisten glauben, dass Beobachtungen nur dazu dienen sollten, Theorien zu widerlegen. Demnach kann eine wissenschaftliche Theorie nie bestätigt, sondern nur falsifiziert werden.
Was sind Beobachtungssprache und theoretische Sprache im Kontext des Positivismus?
Der Positivismus unterscheidet zwischen Beobachtungssprache (empirische Begriffe) und theoretischer Sprache (nicht-beobachtbare Entitäten). Die Beobachtungssprache wird als epistemologisch und ontologisch privilegiert angesehen, d.h., sie wird als sicherer und wirklichkeitsnäher betrachtet.
Was sind die Hauptmerkmale des realistischen Wissenschaftsverständnisses laut diesem Text?
Der Realismus geht davon aus, dass eine subjektunabhängige Wahrheit möglich ist, und konzentriert sich auf kausale Erklärungen, die die zugrundeliegenden Mechanismen und Strukturen von Phänomenen aufdecken. Er betont die Funktion von Modellen und Analogien bei der Darstellung unbeobachtbarer Entitäten und deren Relationen.
Wie unterscheidet sich die realistische Erklärung von der positivistischen Erklärung?
Realisten suchen nach kausalen Erklärungen, die sowohl die regulären Relationen zwischen Phänomenen als auch die Mechanismen, die diese verbinden, aufzeigen. Sie benötigen Kenntnisse über die zugrundeliegenden Mechanismen, Strukturen und die "Natur" der untersuchten Einheiten.
Welche Rolle spielen Modelle und Analogien im realistischen Wissenschaftsverständnis?
Modelle sind Versuche, die Natur oder einen Ausschnitt der Natur analog zu einer bereits verstandenen Quelle zu repräsentieren. Analogien basieren auf Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen Objekten und implizieren, dass Phänomene aufgrund einer zugrundeliegenden Struktur ähnlich sind.
Wie werden Theorien im Realismus generiert und überprüft?
Wissenschaftler konstruieren Modelle von Strukturen und Mechanismen, die nicht beobachtet werden können, und testen diese Modelle in Form von hypothetischen Beschreibungen. Konsequenzen aus dem Modell werden abgeleitet und empirischen Tests unterzogen. Wenn die Tests erfolgreich verlaufen, können die Strukturen und Mechanismen als existent angenommen werden.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen Positivismus und Realismus in Bezug auf Modelle und Analogien?
Der Positivismus sieht keine notwendige Funktion für Modelle als Beschreibungen tatsächlich existierender Strukturen und Mechanismen, wie sie im Realismus verstanden werden. Der Realismus hingegen betont die Rolle von Modellen bei der Darstellung unbeobachtbarer Entitäten und der Ermöglichung kausaler Erklärungen.
Welche Gemeinsamkeiten haben Positivismus und Realismus?
Positivismus und Realismus teilen die Konzeption von Wissenschaft als objektive, rationale Forschung, deren Ziel wahre Erklärungen und Prognostizierbarkeit einer externen Realität sind. Beide betonen die Bedeutung empirischer Beweise und genereller Standards von Wissenschaftlichkeit.
- Arbeit zitieren
- Torsten Reim (Autor:in), 1998, Erkenntnisfortschritt in und Konzeptionen von Wissenschaft, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99373