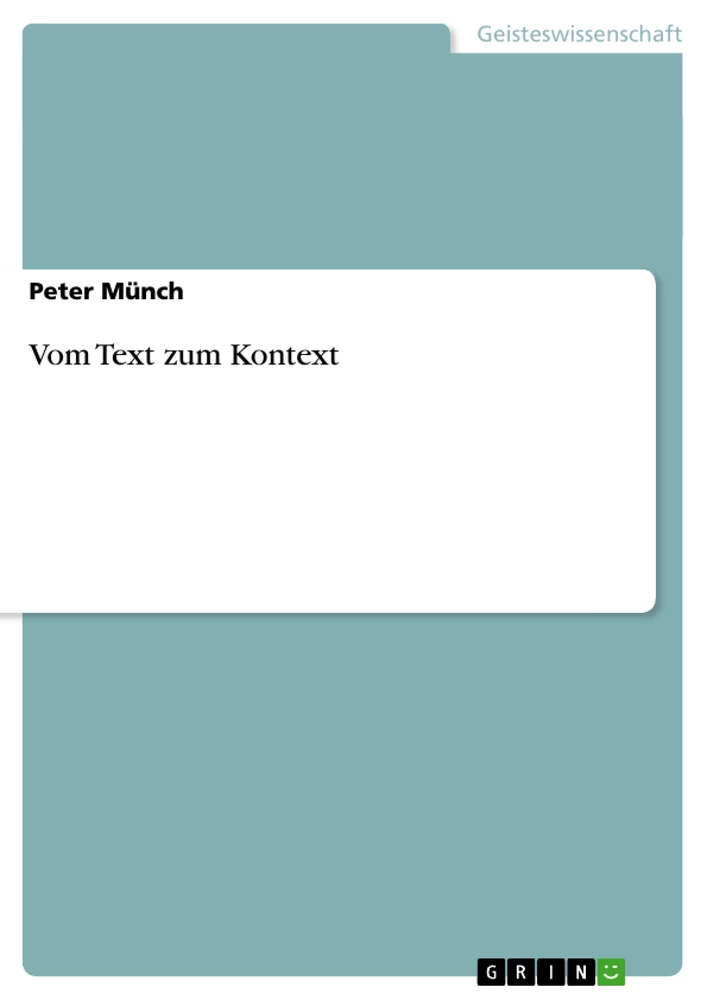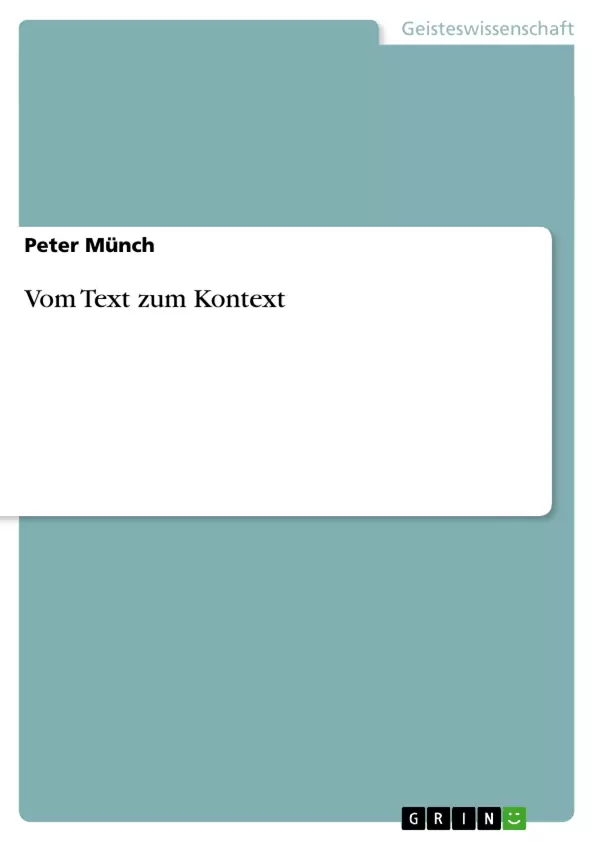Vom textuellen zum Kontextuellen Verständnis der Welt - Was heißt es wenn wir in Netzen kommunizieren anstatt in Linien? 26.7.2000
Waren es die Texte und die lineare Abfolge der Bücher und Texte, die uns seit der Erfindung des Buchdrucks in der westlichen Welt geprägt und begleitet haben, so scheinen sich diese Formen der Darstellung von Wirklichkeit allmählich zu überholen und wir können immer schwerer, die sich ent- wickelnden Strukturen der Wirklichkeit im Sinne linearer Texte und deren Aufgliederung fassen. Wir kommen einfach an die Grenzen und bemerken dabei dass Begriffe wie „Cyberspace“, „Virtualität“, Medienpräsenz, „Kontextualität“ „Globales Gehirn“ usw. Diese Begriffe wirken oft wie eine bedrohli- che Kampfansage, die das uns vertraute Gebäude der Welt- und Wirklichkeitsstrukturen auszuhebeln droht. Und wir haben es mit einer Veränderung der Gewichtung der Textuellen Wirklichkeiten zu tun, die sich mit Sicherheit, früher oder später, nachhaltig auf die Buchreligionen auswirken werden. Was heißt es zum Beispiel, wenn wir im Protestantismus nicht mehr von Textuellen Vorgaben sprechen, also von dem auszugehen haben was die Schrift uns sagt, sondern nach dem Kontext fragen in dem wir uns heute bewegen?
Das alles deutet an, dass sich eine nachhaltige Bewegung vollzieht, deren Auswirkungen wir kaum zu hoch und zu radikal einschätzen können. Viele der Diskussionen, die im Umfeld laufen, müssen miss- verständlich und negativ enden, wenn man nicht mit in Rechnung stellt, dass wir uns in einem grund- sätzlichen Umbruch befinden, der dazu führt, dass wir die Welt in der wir leben neu buchstabieren und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die Neubuchstabierung der Wirklichkeit ist durchaus nicht unge- fährlich, aber sie ist, wenn auch riskant, dennoch nicht aufzuhalten und nicht rückgängig zu machen. Die These, die hier vertreten werden soll, ist die, dass wir uns auf eine kontextuelle sich um uns le- gende Wirklichkeit zu bewegen, die sich interagierend auf uns einlässt und die nicht mehr, wie in den Konzepten der Aufklärung, eine Art Ideal darstellt, dem wir nun nachzueifern haben. Die neue Utopie, wenn man es in diesem Terminus ausdrücken will, ist nicht eine Neuauflage dessen was wir schon kennen und was wir schon wissen, sondern es handelt sich um eine völlig neue Realisierung des Wirk- lichen, die sich am ehesten mit den Begriffen des „interaktiven Kontextes“ umschreiben lässt.
Wir werden im Lauf dieser Auseinandersetzung noch darauf zu sprechen kommen, was es heißt, wenn wir von interaktiven Kontexten und Kontextualisierungen sprechen. Wir werden uns auf eine Reise begeben, auf eine lineare Auseinandersetzung, die dem Thema gar nicht gerecht werden kann, schon deshalb nicht, weil die Struktur nicht dem entspricht was der Gegenstand aussagt. Hier wird aber auch ein Dilemma deutlich, mit dem wir, in der Zeit des Übergangs, leben müssen. Vielleicht kann ich für meinen Teil darauf verweisen, dass ein beachtlicher Teil meiner Schriften, sich in der einen oder ande- ren Weise mit dem Thema auseinandersetzt und dass man diese Texte wie einen Hypertext zu verste- hen hat, der eher wie eine Art Steinbruch zu verstehen ist und nicht wie eine lineare Auseinanderset- zung. Aber wie auch immer, wir kommen nicht umhin, die Veränderungen zur Kenntnis zu nehmen und sie zu bearbeiten.
Wir werden im Zuge dieses Papiers immer wieder auf die „Online-Texte“ des Medien- und Sozialwis- senschaftlers Frank Hartmann und auf die Online-Texte von Vilém Flusser. Beide Autoren finden sich, wie die Bezeichnung der Texte schon anzeigt, mit ihren Texten im Internet, auf verschiedenen Seiten und es lohnt sich allemal anhand einer Suchmaschine nach diesen Namen zu suchen und sich die Texte einmal komplett anzusehen. Ich muss gestehen, nicht mehr genau zu wissen, von welcher Homepage ich diese Texte geladen habe und kann daher nur auf diese Weise auf die Suchmaschinen weiterverweisen. Es finden sich aber einige Einträge unter diesen Namen. Wenn im folgenden diese Texte zitiert werden und wenn sie nicht weiter nach ihren Quellen zugeordnet werden, dann auf dem hier genannten Hintergrund. Von Vilém Flusser gibt es immer noch eine reichhaltige Literatur, die im Bollmann-Verlag erschienen ist. Wir werden später noch auf die beiden Autoren näher eingehen, soweit uns hierzu Informationen vorliegen.
Wir werden manche Umwege machen müssen um dem Gedankengut gerecht zu werden und um auf die Spur dessen zu kommen was denn anders werden wird bzw. was bereits anders ist, vielleicht auch ohne unsere Kenntnisnahme und ohne das wir es bemerkt hätten. Diese Um-Wege, die durchaus nicht negativ sind, die nicht verlorene Zeit darstellen, sondern Klärungsprozesse darstellen, die mitunter notwendig sind um zu verstehen was da geschieht. Wir werden auch merken, dass wir schon sprach- lich ins schleudern kommen werden, weil es gar nicht so einfach ist, etwas in Sprache zu fassen was im Grunde, in der vorliegenden Form noch gar nicht vorhanden war, zumindest nicht im kulturellen Bewusstsein der westlichen Welt. Und wir müssen sehen, dass die Schwierigkeit, zu realisieren was da vor sich geht auch damit zusammenhängt, weil eine dreitausendjährige Geschichte einem Ende entge- gengeht. Die gesamte Kultur der Schrift, der textuellen Realisierung der Welt und der Buch- Religionen stehen zur Disposition. Dabei ist es im Grunde nicht richtig zu sagen, das diese Form der Wirklichkeitsrealisierung zur Disposition steht. Denn sie steht nicht in einer Weise zur Disposition wie man eine handhabbare Sache zur Disposition stellen kann. Wir haben es nicht mit einer willentlichen Entscheidung von Menschen oder Gruppen zu tun, sondern mit Entwicklungen, die auf Strukturdyna- miken zurückzuführen sind, die niemand in der Hand hat.
Wir wollen daher folgende Wege wagen um uns dem Thema zu nähern:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Die textuelle Struktur
2. Die Technosphäre und der textuelle Bruch
3. Vil é m Flusser oder vom Text zum Kontext
4. Der Abschied vom Textuellen in der Religion
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Die textuelle Struktur
Wir müssen, wenn wir die Veränderungen, mit denen wir es zu tun haben verstehen wollen, zwei we- sentliche Fragen beantworten ohne deren Beantwortung ein Verständnis wir kaum weiterkommen werden. Wir müssen klären was denn die textuelle Struktur ist, woher sie kommt und inwieweit sie uns geprägt haben. Diesen Fragen wollen wir hier nachgehen und uns auf eine Spurensuche machen. Nicht dass ich die Antworten schon hätte, dieser Text ist eher, auch für mich als Autor, eine Sache der Klärung und der Suche nach Sprache und Beschreibungen dessen was da vor sich geht. Sofern wir einen Beginn setzen wollen, und mehr als eine Setzung kann es nicht sein, beginnen wir vor ca. 3500 Jahren mit der Erfindung der Schrift. Wir können heute sagen, dass die Erfindung der Schrift in etwa einer Revolution gleichkommt, weil die Schrift das Denken und die Wahrnehmung der Welt voll- kommen verändert hat. Bis zur Erfindung der Schrift lebten die Menschen in einer Welt des Erzählens und des unmittelbar gesprochenen Wortes.
Man sprach miteinander und hatte keine Möglichkeit Sprache zu konservieren und über Generation hinweg fortzuschreiben. Aber nicht nur die Fortschreibung der Sprache war nicht möglich. Sofern wir uns vergegenwärtigen in welcher Form Texte verfasst sind, ergibt bereits in der Form der Texte selbst eine gewisse Verlaufsstruktur. Texte sind linear! Man kann einen Text nicht kreuz und quer lesen, weil man dann unverständlichen Buchstabensalat bekäme. Der Leser ist ebenso wie der Verfasser von Texten darauf angewiesen, Texte linear und im Sinne einer kausalen Logik zu verstehen. Stellen wir uns nur einen Text vor, in dem die Buchstaben beliebig gesetzt werden können, dann hätten wir Mühe die Zeichenfolge eines Textes zu verstehen. Aber damit nicht genug. Allein schon die Tatsache, dass Menschen in der Lage waren linear zu verstehen, linear zu realisieren, ist eine Denkwürdigkeit! Um einen Text zu erstellen muss der Verfasser in der Lage sein, die Welt auf einer Linie bzw. an einer Linie entlang, zu ordnen.
Diese Fähigkeit, Wirklichkeit wie auf einer Schnur aufzureihen und sie als lineare Abfolge zu verste- hen, die eben nur so und nicht anders möglich ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Wer Wirklichkeit in Texten abbildet muss verstanden haben oder davon ausgehen, dass die Wirklichkeit eine linearen Ord- nung gehorcht. Man muss sich das vorstellen, die Kultur vor ca. 4000 Jahren kannte noch keine Na- turgesetze, sie kannte keine Schrift und die Ereignisse kamen nicht auf die Mensche zu, weil es eine kausale Notwendigkeit gab, dass auf A eben B folgt, sondern man glaubte vielmehr, dass hinter jedem Einzelereignis ein Gott stehen müsse. So etwas wie Kausalität war den Menschen vollkommen unbe- kannt und man hatte genügend damit zu tun, dass man die Götter gewogen stimmte, damit die Ereig- nisse entsprechend günstig ausfielen und sich nicht gegen die Familie, gegen den Clan oder gegen das eigene Volk richteten.
Die Fähigkeit einen Text zu erstellen, in dem Buchstabenfolgen, in der Linie gelesen, einen nachvollziehbaren, festen Sinn ergeben, war den Menschen vollkommen fremd. Die Erfindung der Schrift kam daher eine medialen Revolution gleich. Vilém Flusser schreibt dazu:
„ Vor etwa dreitausendfünfhundert Jahren (also kürzlich) wurde ein wichtiger Schritt geleistet: das Alphabet wurde erfunden. Das ist ein Code, weicher die Phoneme der gesprochenen Sprachen in visuelle Zeichen umkodiert und erlaubt, diese Zeichen in harte Gegenstände zu graben. Somit konnten die Vorteile der oralen Kultur mit jenen der materiellen Kultur verbunden werden, und ein weit funk- tionelleres kulturelles Gedächtnis wurde möglich. Es konnten "Monumente" hergestellt werden (Tex- te), welche orale Informationen in Hardware speichern, von dort bequem abberufen werden können, und welche erlauben, kopiert zu werden. Das war eine außerordentlich fruchtbare Erfindung, denn sie gestattete ein relativ verlässliches und diszipliniertes Speichern erworbener Informationen. Ge- schichte im eigentlichen Sinn wurde möglich. Und das hatte eine radikale Veränderung des Denkens und Handelns zur Folge. Die Linearität des alphabetischen Codes schlug auf das Denken zurück, es wurde selbst linear (fortschrittlich), und geschichtsbewusstes Handeln (also letzterdings Technik) wurde möglich. Die Erfindung des Alphabets ist eine auf dem Weg zur Menschwerdung entscheidende Phase. “
(Vil é m Flusser, „ Gedächtnisse “ Online-Text)
Der Bruch war riesig und die Folgen sind bis heute zu spüren. Mehr noch, die Folgen sind nicht nur bis heute zu spüren, sondern sie laufen immer noch, sie sind in ihrer Wirkung immer noch nicht ab- sehbar. Die neuere Medienrevolution ist im Grunde, sofern man sie als kulturelle Revolution versteht, nur auf einem solchen Hintergrund denkbar. Ohne die Fähigkeit die Wirklichkeit als lineare Abfolge zu verstehen, die nicht nur einer Linie folgend zu verstehen ist, sondern auf dieser Linie, auch einer nicht über den Haufen zu werfenden Gesetzmäßigkeit dient, kann man die Revolution der Medien, die wir gegenwärtig erleben, gerade als Auflösung dieser Struktur, gar nicht verstehen.
Nun blieb es nicht dabei, dass man Texte benutzte um Wirklichkeiten abzuspeichern und verfügbar zu machen, sondern die Fähigkeit Texte zu erstellen legte auch nahe davon auszugehen, dass alle wesent- liche Wirklichkeit be-schreib-bar sein müsse. Eine nicht zu be-schreibende Wirklichkeit ist entweder diffus, irrelevant oder gar reiner Unsinn. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass die gro- ßen Buchreligionen, bzw. die eine große Buchreligion, das Judentum, in dieser Zeit entstanden ist. die Fähigkeit textuell zu denken und wahrzunehmen, prägte eine ganze Kultur. Der Buddhismus, der sich parallel in Asien entwickelte, entwickelte zwar keine reine Buchreligion, aber auch hier wurde die Lehre des Buddha in schriftlicher Form fixiert und auch hier folgt das Denken einer linearen Logik, die sich in der weiteren Entwicklung, anders umgesetzt und weiter entwickelt hat als die hebräische und die griechische Kultur. Aber im Buddhismus ist eine Logik enthalten, eine lineare Logik, die uns als Europäer, zumindest bis zu einem gewissen Teil, nachvollziehbar ist.
Das Medium, mit dessen Hilfe wir die Welt wahrnehmen und verarbeiten, prägt auch das was wir wahrnehmen und wie wir es wahrnehmen. D.h. wenn wir die Welt im Sinne codierter Zeichen verste- hen, wenn wir es gelernt haben, anhand linearer Texte Wirklichkeit in plausible Zusammenhänge ge- bracht haben, dann haben wir nicht ein Instrument geschaffen, dass aus einem sich vorher entwickeln- den Bewusstsein heraus gekommen ist, sondern auch umgekehrt. Das Medium der linearen Schriftco- dierung hat auch dazu beigetragen, dass wir Wirklichkeiten entsprechend dieses Instruments zuordnen und wahrnehmen. D.h. alles was nicht in diese Ordnung passt wird entweder nicht wahrgenommen oder nicht ernstgenommen! Die Instrumente der Verarbeitung prägen das Bewusstsein dessen der ver- arbeitet.
Neben den bisher besprochenen Aspekten der Linearität der Schrift ist noch die Codierung interessant wie sie von Vilém Flusser angesprochen worden ist. Wir werden uns dem Philosophen später noch zuwenden, greifen aber an dieser Stelle vor, weil es sich um eine These handelt, die in dieser Weise nicht nur von Flusser vertreten worden ist, sondern verschiedenen anderen Autoren in ähnlicher Wie- se. Wir gehen davon aus, dass die Wirklichkeit sich codieren und in dieser Codierung darstellen bzw. verstehen lässt. Die Codierung von Wirklichkeit in Zeichen, genauer gesagt in phonetische Zeichen, also Buchstaben im Alphabet, hat eine enorme, nicht zu unterschätzende Abstrahierung bewirkt, die wir heute, da wir in ungeheueren Abstraktionen leben, gar nicht mehr bemerken. Diese Abstrahierun- gen der Wirklichkeit kann man sich in etwa wie folgt vorstellen: Wenn wir das Wort Baum hören, dann haben wir eine „Vorstellung“ von einem Baum ohne das ein konkreter Baum gemeint ist und ohne das wir einen Baum sehen müssen. Allein schon die Codierung des Baumes löst eine Idee oder eine Vorstellung, ein Bild von einem Baum aus. Wir können über eine Kuh, über Kühe oder den Kuh- bestand der ganzen westlichen Welt reden ohne das wir eine Kuh zu Gesicht bekämen. Wir sind in der Lage soweit zu abstrahieren, dass wir über alles mögliche reden können ohne das wir auch nur die Spur dessen was verhandelt wird sehen.
Diese Abstrahierung und Linearisierung der Wirklichkeit ist sicher nicht ausschließlich auf die Erfin- dung der Buchstaben zurückzuführen, sie hat mehrere Ursachen und die Buchstaben bzw. das Code- system des Alphabets ist nur eine von mehreren Ausdrücken eines gewaltigen Umbruchs der sich vor ca. 3000 Jahren ereignet hat und der in aller Regel unter dem Begriff der Achsenrevolution subsum- miert wird.
Wir fassen also zusammen, um den Text nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, dass die Erfindung der Schrift es möglich gemacht hat:
- Wirklichkeit linear und kausal zu erfassen
- Wirklichkeit in Zeichen zu fassen und zu abstrahieren. Wir unterscheiden längst nicht mehr genau zwischen Zeichen und den Dingen selbst
- Erinnerungen gespeichert werden konnten.
- Informationen wurden nicht mehr in erster Linie über die gesprochene Sprache weitergegeben, sondern in Form von codierten Zeichen.
Nicht alle diese Elemente sind schlagartig sichtbar geworden in dem Moment in dem die Schrift er- funden worden ist. Die meisten Veränderungen ergaben sich im Laufe der Zeit und manche können wir erst jetzt, nach ca. 3000 Jahren in der notwendigen Schärfe erkennen. Nichts desto trotz, ist es so, dass die Strukturen bereits angelegt waren und wir heute lediglich über das Ausmaß der Wirkungen befinden. Die textuelle Struktur ist immer noch, zumindest in vielen Köpfen, vorherrschend. Wir leben aber in einer Zeit, und dazu muss man diesen Hintergrund, zumindest in Form einer Skizze, mit bedenken und wissen, in der sich diese textuelle Struktur der Wirklichkeitswahrnehmung auflöst und verändert. Die Veränderungen der grundlegenden Wirklichkeitserfahrung ist dabei so tiefgreifend, dass man vielleicht überhaupt nur das Ausmaß annähernd erfassen kann, wenn man weit genug zurück geht in die Vergangenheit um zu fragen woher denn die textuelle Struktur kommt. Aber noch bevor wir nach dem Woher fragen, müssen wir fragen nach dem Das. Wir müssen sehen das wir in einer textuellen, also einer Textorientierten Wirklichkeit leben und bewegen.
Wenn wir uns nun dem Bruch mit dieser Textuellen Struktur zuwenden, dann haben wir im Prinzip viele Möglichkeiten das zu tun. Es gibt eine ganze Reihe von plausiblen Zugangsmöglichkeiten zum Thema, nur müssen wir uns für eine entscheiden. Das ich mich für eben die thematische Eingrenzung entscheide, die ich eben vorgebe, hat zum einen mit meiner persönlichen Interessenlage zu tun, aber auch ganz stark mit dem Einfluss von Technologie auf unser Leben, auf unser Wirklichkeitsverständnis und auf das Medium das uns dadurch zuwächst. Durch die Technik, die uns in einer Fülle von Geräten und technischen Details umgibt, kommen wir in einer Vermittlung von Wirklichkeit, in der sich die Frage ob denn dass was in den Medien dargestellt wird, wirklich ist oder nicht, ad absurdum führt. Wir werden daher, um diesen Vorgang deutlicher zu machen, von der Technoscience bzw. der Techniksphäre sprechen in der wir uns bewegen. Daher der folgende Punkt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Die Technosphäre und der textuelle Bruch
Die Erfindung der Schrift ist ein Medium, dass dazu geführt hat, dass wir Wirklichkeit eben durch die Brille dieses Mediums wahrgenommen haben. Dabei, so haben wir angedeutet, ist nicht genau auszu- machen ob das Medium hervorgebracht wurde weil eine entsprechende Bewusstseinslage vorgelegen hat, die eine solche Entwicklung begünstigt hat oder ob das Medium, als es erst einmal da war, dass Bewusstsein entsprechend seiner eigenen Struktur geprägt hat. Eine solche Entscheidung, ob die Hen- ne oder das Ei zuerst war, ist auch grundsätzlich nicht möglich, denn beide Aspekte, das Bewusstsein der Menschen, die ein solches Medium hervorgebracht haben oder die Prägung diesen Bewusstsein aufgrund des Vorhandenseins eines solchen Mediums bedingen sich wechselseitig und verstärken sich wechselseitig. Wir haben es mit einem koevolutiven System zu tun, bei dessen Betrachtung es keinen großen Sinn macht, danach zu fragen ob denn das Eine oder das Andere zuerst da war.
Koevolutive Systeme sind komplexe Gebilde, die aus einem Zusammenspiel mehrerer Teilnehmer bestehen, bei denen aber nicht klar ist welcher Teilnehmer wo anfängt bzw. aufhört. Wir können das koevolutive System von Schrift und Bewusstsein in etwa so vorstellen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: In einem solchen System hat es keinen Sinn danach zu fragen wer zuerst oder danach auf der Bühne erschienen ist
In einem koevolutiven System geht es nicht in erster Linie darum, genau zu trennen, wo der eine Teil- nehmer anfängt und wo er aufhört, es geht vielmehr darum, das beide Elemente zu einem System zu- sammenwachsen, dass miteinander eine andere Form von Wirklichkeit darstellt als sie bis dahin üblich war. Wir können eben nicht trennen zwischen den technischen Hilfsmitteln und dem Bewusstsein der Menschen, die ein solches Hilfsmittel benutzen. Wir haben es, wenn wir die Entstehung der Schrift und das sich verändernde Bewusstsein betrachten mit einem koevolutiven System zu tun. Beide Sys- teme sind so miteinander verbunden und vernetzt, dass wir gerade nicht trennen können zwischen Ei und Henne. Das System der Schrift hat das Bewusstsein geprägt und das Bewusstsein hat das System der Schrift hervorgebracht. In diesem Wechselspiel müssen wir die Zusammenhänge verstehen. Sofern uns das gelingt, werden wir entsprechend weniger Schwierigkeiten haben, dass Zusammenspiel von Technologie und Bewusstsein in der Gegenwart zu verstehen.
Die Textkultur hat ein uns allen bekanntes Bewusstsein, eine uns allen bekannte Realisierung der Welt hervorgebracht und ermöglicht. Diese Realisierung der Welt ist durchaus eine spannende und eine nützliche Sache. Schließlich waren wir in der Vergangenheit mit dem textuellen Bewusstsein sehr erfolgreich und wir sind es zum Teil immer noch. Aber vieles an diesem Bild stimmt eben inzwischen nicht mehr. Das Dilemma in dem wir uns befinden lässt sich anhand der Gentechnik darstellen. Wir werden an diesem Beispiel das grundsätzliche Dilemma aufzeigen, danach noch einmal auf grundsätz- liche Überlegungen zu sprechen kommen und danach an weiteren Beispielen diese Vorgänge vertie- fen.
In der Gentechnik betrachten wir, wenn man es genau nimmt, die biologische Information als Textsys- tem. Wir gehen davon aus, dass die biologischen Organismen alle aus vier Buchstaben zusammenge- setzt sind. Diese vier Buchstaben (Adenin, Guanin, Cytosin und Tymin) ergibt in einer bestimmten Codierung, also einer Reihenfolge die uns schließlich sichtbar wird und als biologische Organismen wahrnehmen. Aus dieser Codierung dieser vier Basensäuren lassen sich sämtliche Lebensformen er- klären und herleiten, mit denen wir es hier auf der Erde zu tun haben. Diese Einsicht ist faszinierend löst aber ganz erhebliche Missverständnisse aus, weil man daraus schlussfolgern kann, dass sich Or- ganismen wie lineare Texte verhalten. Wenn wir diese Codierung lesen wie man einen linear angeord- neten Text liest, dann müsste sich daraus eine entsprechende Wirklichkeit ergeben. Eben die lineare Ordnung von Organismen. Aus einem solchen Missverständnis rühren dann Vorstellungen wie die, dass es für alle menschlichen Eigenschaften und Fähigkeiten ein Gen gebe, dass man an und abschalten kann. Wir fragen dann nach einem Gen, dass die Intelligenz beeinflusst, nach einem Gen, dass unser Sozialverhalten steuert und dergleichen mehr. Wir kennen diese immer wieder formulierten Erwartungen, was man denn da finden müsse, wenn man nur lange genug sucht.
Demgegenüber verweisen Molekularbiologen immer wieder auf die sehr viel höhere Komplexität der genetischen Information, die in aller Regel dieser linearen Textstruktur wiederspricht. Wir haben es, was die Gene betrifft nicht mit einer linearen Textstruktur zu tun, sondern eher, wenn man den Ver- gleich mit dem Text aufrechterhalten will, mit einer Hypertextstruktur, also mit einem Text, der nicht linear zu lesen ist, sondern kreuz und quer. Die genetische Struktur der Organismen sind also gerade nicht im Sinne eines linearen, fortlaufenden Textes zu verstehen, sie entziehen sich gerade der linearen Deutung, so sehr wir auch nach einer solchen suchen mögen. Und wenn man die Meldungen über die Entdeckung aller möglichen Gene liest und hört, dann drängt sich schon der Eindruck auf, dass wir noch nicht verstanden haben, dass die genetische Struktur nicht-linear ist und damit auch einfachen kausalen Deutungen nicht zugänglich ist. D.h. wenn wir für jede Eigenschaft des Menschen ein ent- sprechendes Gen suchen, dann werden wir ganz sicher enttäuscht werden, weil es das, abgesehen von einigen Ausnahmen, nicht geben wird.
Wir können die Gene nicht lesen wie einen linearen, fortlaufenden Text, auch wenn wir die geneti- schen Strukturen als verstehen textuelle Informationen verstehen können. Interessant ist in dieser Hin- sicht sehr wohl die Tatsache, dass sich die genetischen Informationen als Code, als eine Art Vier- Buchstaben-Code lesen lassen. Je nachdem, wie die vier Buchstaben (A,C,T,G) aufeinander folgen,, so könnte man meinen, ergibt sich ein entsprechender Sinn des zu lesenden Textes. Dementsprechend waren die ersten Versuche mit den genetischen Codes umzugehen bzw. sie zu interpretieren. Aber wir haben inzwischen ein anderes Bild von dem genetischen Text entwickelt. Und dieses Verständnis wirkt eher wie ein mehrfach verschachtelter Hypertext, in dem sich durchaus A auf Z beziehen kann und Z auf H usw. wenn wir uns das graphisch vorstellen ergibt sich folgendes Bild. In einem linearen Text kommt der Sinn zustande, indem man vorn anfängt zu lesen und dann so nach und nach den Text immer besser versteht:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diesen Text liest man linear, auch wenn wir hier nur die Buchstaben in der Reihenfolge des Alphabets aufgelistet haben. Stände dort ein sinnvoller Text, dann würde man nur hinter den Sinn dieses Textes kommen, wenn man vorn mit dem lesen beginnt und hinten endet. Das ist in einem Hypertext anders:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In einem Hypertext kann die Bedeutung der Zeichen nicht eindeutig zugeordnet werden. Hier spielen Wechselwirkungen eine gewisse Rolle, und der Anfang eines Satzes ist nicht genau auszumachen bzw. es kann sein, dass ein Satz mehrfach endet, mehrere Abzweigungen und hat und mehrere Sinn- gehalte aufweist. Diese verschiedenen Sinngehalte des Hypertextes macht es ungewohnt und schwie- rig mit solchen Texten umzugehen, sofern man ein lineare Struktur erwartet. Die genetische Anord- nung der Basensäuren (C,T,G und A) ist einer Hypertextstruktur vergleichbar. Hier sind mehrere Sinngehalte möglich und die einzelnen „Buchstaben“ beziehen sich nicht nur auf den Folgebuchsta- ben, sondern auch auf jeden beliebigen anderen Buchstaben in einem solchen Hypertextgebilde. Im Internet gibt es inzwischen einige Websites, die im Sinne eines Hypertextes aufgebaut sind. Auf sol- chen Websites gibt es viele verschiedene Texte, die von unterschiedlicher Länge sind, aber nicht un- tereinander stehen und auch nicht linear zu lesen sind. Es ist natürlich immer eine Frage der Erwar- tung, wie wir mit solchen Textstrukturen zurechtkommen, aber sie entsprechen ganz gewiss nicht un- serer Gewohnheit einen Text linear, von oben nach unten zu lesen.
In einem Hypertext oder in einer Hypertextähnlichen Struktur stehen im Prinzip alle Elemente mit allen anderen Elementen in direkter oder indirekter Verbindung. Es ist dabei auch nicht so, dass die Verbindungen statisch sind wie bei einem einmal verfassten linearen Text, sondern es kann durchaus sein, dass wir es mit dynamischen Texten zu tun haben, deren Beziehungen und Verbindungen wechseln und dadurch ihre Bedeutung verändern.
Im Falle der Gene kann man sagen, es gibt nicht ein Gen für eine Funktion, sondern wir haben es mit einer genetischen Vernetzung, einer genetischen Hypertextstruktur zu tun, in der nicht allein einzelne Gene wirken, sondern die Struktur der Vernetzung gibt in diesem Fall den Ausschlag für das was bewirkt wird. In der Neuroinformatik spricht man von Informationsarchitekturen, die in ihrer jeweiligen Anaordnung bereits eine bestimmte Wirkung haben. Das ist aber eine völlig andere Form der Funktion als wir es bei linearen Textstrukturen vor uns haben. Während in einer linearen textuellen Struktur immer nur A auf B einwirken kann und die Schlussfolgerungen entsprechend linear sein müssen, ist der Weg bei der Hypertextstruktur ein anderer. Hier wirkt die Anordnung der Information mindestens soviel wie der konkrete Informationsgehalt der einzelnen Elemente.
Was hat das mit der Technosphäre zu tun, könnte man fragen. Nachdem wir ein Stück weit die Frage beantwortet haben, was denn an der textuellen Struktur der Informationsarchitekturen anders ist als bei linearen Texten, wenden wir uns nun den Auswirkungen in der technischen Welt zu, die damit ver- bunden sind. Denn hier muss die gesamte Diskussion um die Technik neu gelesen und verstanden werden. Die allmähliche Bewusstwerdung der Technosphäre ist ein nicht zu unterschätzender Akt. Vielleicht ist keine Generation vor uns derart hart und direkt damit konfrontiert worden, dass wir nicht nur ausgestattet sind mit Technologien, dass wir nicht nur Werkzeuge geschaffen haben, die uns hel- fen unseren Lebensalltag zu bewältigen, sondern dass wir es mit einer Technosphäre zu tun haben. Die Technosphäre ist die Umgebung in der wir uns bewegen, sie ist die Umwelt, an der wir uns orientieren und sie ist die Luft die wir atmen. Die Welt in der wir uns bewegen, ist Technologie allgegenwärtig und allpräsent.
Wir haben, selbst wenn wir es wollten, keine reelle Chance, uns der Technologie zu entziehen. Die Technologie ist zu einer Art zweiten Haut geworden. Vielleicht noch nicht eine unmittelbare, bioähn- liche Haut, aber eine kulturelle, eine soziale Haut. Was uns hier interessiert ist aber weniger die Tech- nosphäre an sich, wir haben an anderer Stelle diese Technosphäre besprochen und beschrieben, son- dern die Struktur dieser Sphäre des Technischen. Wir wollen uns hier an den Erkenntnissen der Chaos- theorie und der komplexen Systeme orientieren, denn beide Forschungsrichtungen, soweit sie nicht identisch sind, erscheinen sehr interessant und geben uns einen Einblick in die Veränderungen unseres Denkens und Erwartens. Die These, die hier vertreten werden soll ist folgende: Je komplexer die Technosphäre um uns her wird, um so weniger ist sie berechenbar bzw. vorhersehbar. Die technologi- sche Umwelt, die Technosphäre verhält sich längst wie ein ökologisches Biotop, in dem nur ein Bruchteil aller Beziehungen und Vernetzungen bekannt sind. Wir können in einem Biotop nur davon ausgehen, dass es eine unendlich hohe Anzahl von Vernetzungen, Beziehungen und Verflechtungen gibt, aber es ist uns so gut wie unmöglich alles das was dort vor sich geht zu beschreiben.
Ähnlich wie bei der genetischen Information, die wir auch nicht textuell deuten können, sondern nur als komplexe Hypertextstruktur, so befinden wir uns in der Technosphäre in einem ähnlichen Zusammenhang. Wir haben es bei diesen komplex vernetzten Strukturen der Wirklichkeit nicht mehr mit linearen Zusammenhängen zu tun, sondern mit einem Hypertextsystem, in dem nicht mehr so sehr die nachvollziehbare, lineare Struktur zählt, sondern die Vernetzung und die kommunikative Struktur der technologischen Systeme! Anders gesagt: Wenn die bisher geltende Technologie darauf abgezielt hat, sich in einer Art linearen Kausalbewegung zu halten, so ist die neue Technologie nicht mehr im Sinne von kausaler Linearität zu beschreiben sondern im Sinne von Nichtlinearität und Komplexität. Das ist eine sehr komprimierte Zusammenfassung, die einer erklärenden Ausführung bedarf. Dazu aber noch eine Bemerkung vorweg: Nicht allein die Technologie als solche ist bemerkenswert, nicht die einzelne Technik ist interessant, sondern die Struktur der Technosphäre ist es.
Wir werden, um diese sehr dicht gepackten Aussagen etwas zu entfalten folgende Thesen darstellen, die uns helfen sollen, den Paradigmenwechsel, in dem wir leben, zu verstehen und zu fassen. Die erste These lautet:
Die einzelnen Technologien verändern ihre Strukturen und werden nicht mehr textuell verstanden sondern kontextuell.
Die zweite These lautet:
Die Technologie ergibt als Ganzes eine andere Struktur, die sich nicht mehr textuell verstehen lässt!
Diese beiden Thesen können vielleicht helfen den paradigmatischen Umbruch zu verstehen und zu fassen, in dem wir uns bewegen. Und wir können nur sehen, dass wir diesen Umbruch, so gut es uns eben gelingt, zulassen und mitbearbeiten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die einzelnen Technologien verändern ihre Strukturen und werden nicht mehr textuell verstanden sondern kontextuell.
Wenn wir die These aufstellen, dass die Technologien nicht mehr textuell, sondern kontextuell zu verstehen sind, dann müssen wir klären was denn in diesem Zusammenhang die textuelle Struktur und Kontur der bisher geltenden Technologie ausmacht. Es kann durchaus sein, dass wir dabei sehr grob und unzureichend vorgehen. Diesem Risiko müssen wir uns aussetzen, damit überhaupt, zumindest in Ansätzen, etwas erkennbar wird von dem was gemeint ist. Vielleicht fällt es uns nach diesem Versuch einer Darstellung etwas leichter von dem zu reden was gemeint, ist aber wir bedürfen der unbeholfe- nen Versuche einer Klärung, in der Hoffnung, dass sich durch diese Versuche, etwas klärt, und sei es auch nur ganz langsam und allmählich.
Wir haben weiter oben beschrieben, dass sich die westliche Kultur in einem sehr weitgehenden Sinne als textuelle Kultur versteht. Und wir haben ebenfalls beschrieben, dass diese textuelle Grundstruktur sich sehr nachhaltig auf unser gesamtes Verständnis der Wirklichkeit ausgewirkt hat. Die Technologie ist, wenn man so will, ein Indikator dieser Struktur. Dazu müssen wir uns weiterhin vergegenwärtigen, dass die Technologie, die bis heute ein wichtige Funktion inne hat, eine mechanische Struktur auf- weist. An dieser Grundstruktur des Mechanischen hat sich seit dem Neolithikum nichts geändert.
Während eines Kurzurlaubs in der Lüneburger Heide vor einigen Jahren, hatten wir das Glück in ei- nem kleinen Heimatmuseum die einzigen Gäste zu sein und von einer Künstlerin, die diese Aufgabe ehrenamtlich übernommen hatte, geführt zu werden. In der dortigen Gegend gab es sehr viele Funde aus der Steinzeit, unter anderem auch einfache Werkzeuge, vermutlich die erste Werkzeuge der Men- schen überhaupt. Diese Funde waren sehr interessant und man hatte sogar die Möglichkeit einfache Werkzeuge zu probieren und nachzuvollziehen, wie die Menschen seinerzeit mit den Werkzeugen gearbeitet haben.
Die Führerin, die sich Zeit nahm nur uns als einzige Familie durch die Ausstellung zu führen, bemerk- te zu den Funden aus dem Neolithikum, dass sich an Werkzeugen und am Grundverständnis der Tech- nik nichts wesentliches geändert hat. Lediglich die Mechanik ist verfeinert worden, wir wissen inzwi- schen mehr über die Hintergründe der einzelnen Funktionen, aber die grundsätzliche Funktionsweise einer mechanischen Technologie hat sich nicht geändert. Erst mit dem Aufkommen der digitalen Technologien, die eben nicht mehr auf der Basis des Mechanischen funktionieren, ist etwas Neues in Erscheinung getreten. Der Computerexperte und Visionär Ray Kurzweil definiert das Wesen der Technik wie folgt:
„ Da Technik die Fortsetzung der Evolution mit anderen Mitteln ist, wächst das Tempo ihrer Entwicklung ebenfalls exponentiell. Das Wort » Technik- « stammt aus dem Griechischen techne meint » Handwerk « oder » Kunst « . Im Begriff der Technologie steckt zudem das griechische logia für » das Studium von. Nach einer Deutung wäre Technologie so das Studium des Handwerks. Handwerk meint die Herstellung von Hilfsmitteln zum Erreichen praktischer Zwecke. Die hier angeführte Definition basiert auf dem Begriff » Hilfsmittel « statt auf » Material « , weil Technologie auch den Umgang mit nichtmateriellen Hilfsmitteln wie Information abdeckt.
Technologie wird oft definiert als die Herstellung von Werk, zeugen, mit denen der Mensch die Kon trolleüber die Umwelt gewinnt. Diese Definition ist allerdings unzulänglich. Der Mensch ist nicht das einzige Wesen, das Werkzeuge herstellt oder benutzt. Orang-Utans auf Sumatra brechen Ä ste ab und bringen sie so in Form, daßsie mit ihnen Termitenbauten aufbrechen können. Krähen fertigen Werk zeuge aus Zweigen und Blättern an. Blattschneideameisen stellen aus zerkauten trockenen Blättern Kleister her. Und Krokodile nutzen Wurzeln, um ihre Beute festzuklemmen.
Typisch menschlich bei der Herstellung von Werkzeugen' dagegen der Einsatz von Wissen - von auf gezeichnetem Wissen. Die Wissensbasis ist gewissermaßen der genetische Code der technischen Entwicklung. Mit dein -technischen schritt wurden auch die Mittel zur Aufzeichnung' dieser Wissensbasis weiterentwickelt: von der mündlichen Ü berlieferung aus uralter' Zeitüber die Konstruktionszeichnungen der Handwerker des 19. Jahrhunderts bis hin zu den computergestützten Datenbanken der neun ziger Jahre unseres Jahrhunderts.
Eine Technologie impliziert zudem, daßsie ihre materiellen Bestandteile transzendiert, Erst wenn verschiedene Bauteile in richtiger Weise zusammengefügt werden, entsteht die vollkommene Neuheit der Erfindung. Als Alexander Graham Bell 1875 zufällig zwei bewegliche Trommeln mit Solenoiden (Magnetspulen) zu einem Telefon zusammengefügte, transzendierte das Ergebnis dessen Bestandteile:
Erstmals wurde es möglich, eine menschliche Stimme wie durch Zauberkraftüber große Entfernungen zuübertragen.
Wenn wir Dinge willkürlich zusammenfügen, entsteht meistens nur ein Zufallsprodukt. Aber werden Materialien - und in- der modernen , Technik Information - in genau der richtigen Weise zusammen- gefügt, geschieht eine Transzendenz. Das zusammengesetzte Objekt ist weitaus mehr als die Summe seiner Einzelteile.
Dieses Phänomen der Transzendenz taucht auch in der Kunst auf, die als Sonderform der menschli- chen Technik gelten kann. Wenn man eine Violine oder ein Klavier auf die richtige Art manipuliert, entlockt man ihnen auf wundersame Weise in harmonischer Folge Töne: Musik. Musik ist mehr als eine Folge akustischer Signale. Sie löst im Zuhörer eine kognitive, emotional und vielleicht auch spiri- tuelle Reaktion aus - eine andere Art der Transzendenz. Alle Formen der Kunst teilen dieses eine Ziel: Sie stellen eine Kommunikation vom Künstler zu seinem Publikum her. Im Zentrum stehen nicht nüchterne Fakten, sondern köstliche Früchte aus dem Garten der Erscheinungen: Gefühle, Gedanken, Erfahrungen und Sehnsüchte. Die griechische Bedeutung von techne logia schließt die Kunst als zent- rale Erscheinungsform der Technik mit ein.
Eine weitere Form menschlicher Technik ist die Sprache. Eine der ursprünglichsten Anwendungen von Technik ist Kommunikation, zu der Sprache die Grundlage liefert. Kommunikation ist eineüberle- benswichtige Fähigkeit. Sie versetze Sippen und Stämme, in die Lage, gemeinsame Strategien, zur Ü berwindung von Hindernissen und Widrigkeiten zu entwickeln. Auch Tiere kommunizieren. Affen unterschiedlicher Entwicklungsstufen verständigen sich mit einer Vielzahl von Gebärden und Lauten. Bienen lotsen Mitglieder ihres Staates mit Schwänzeltänzen zu Nektarquellen. Weibchen einer malaii- schen Baumfroschart zeigen mit einer Art Stepptanz Paarungsbereitschaft an. Krabben bedrohen mit einem bestimmten Winken der Scheren ihre Rivalen und locken durch ein Winken in verändertem Rhythmus Weibchen an. " Allerdings scheint sich diese Art der Verständigung nur durch Veränderung von Erbanlagen weiterzuentwickeln. Diesen Arten fehlt die Möglichkeit, die Mittel ihrer Kommunika- tion zu dokumentieren: Sie werden von Generation zu Generation meist 'unverändert weitergereicht. Dagegen entwickelt sich die menschliche Sprache wie alle Formen der Technik weiter.
Mit den höher entwickelten Formen von Sprache entstanden dank der Technik gleichzeitig auch immer ' bessere Mittel, mit denen Sprache aufgezeichnet und weiterverbreitet werden kann.
Der Homo sapiens ist einzigartig im Gebrauch und der Weiterentwicklung aller möglichen Formen von Technik: seien es die Künste, die Sprache oder die Maschinen. Und immer stellt. Das Gesetz von Zeit und Chaos ihre Weiterentwicklung die Fortsetzung der Evolution anderen Mitteln dar.
Von den sechziger bis in die neunziger Jahre machen Menschenaffen immer wieder Furore, weil ihnen Sprachvermögen auf mindestens kindlichem Niveau nachgesagt wurde. Die Schimpansen Lana und Kanzi drückten in bestimmten Reihenfolgen verschiedene Knöpfe mit Sprachsymbolen. Dagegen hießes von den Gorillas Washoc und Koko, sie benutzten die amerikanische Taubstummensprache. Skepti- sche Sprachwissenschaftler wenden allerdings ein, daßdiese Affen auch vielfach unstrukturierte Sätze hervorbrächten: » Nimm essen, Nimm essen, trink iss mich Nimm, Gummi ich Gummi kitzle mich, Nimm spielen, du ich Banane ich Banane du. « Selbst bei einer großzügigeren Bewertung dieser Expe- rimente' sind solche Fähigkeiten im Tierreich immer nur die Ausnahme. Die Menschenaffen haben die von ihnen erlernte Sprache als Spaniens -nicht selbst entwickelt, sie erwerben sie nicht spontan und setzen sie auch nur in sehr beschränktem ein." Bestenfalls haben sie am Rande Anteil an einer rein menschlichen Errungenschaft: der Kommunikation durch die auf sich selbst verweisende, auf Symbo- len beruhende und sich weiterentwickelnde - Sprache.
(Ray Kurzweil, „ Homo S@piens - Leben im 21. Jahrhundert - Was bleibt vom Menschen? “ Köln 1999, S. 36 ff)
Uns interessiert hier vor allem der Zusammenhang zwischen der Technik, so wie im Sinne linearer und kausaler Mechanik und der neueren Technologie, die von ihren Ansätzen her etwas Neues mit- bringt. Die „alte“ Technologie war als isoliertes Werkzeug zu verstehen. Eine Maschine die auf reiner Mechanik beruht, hat sich nicht darum gekümmert ob sie in dieser oder in jener Umwelt lief. Die Ma- schine hat sich nicht um ihre Umwelt gekümmert, sie hat an und für sich funktioniert, ohne jede Be- zugnahme auf eine mögliche Umwelt. Die mechanischen Gesetze sind auch genau so zu verstehen, eben als Gesetze, die immer und überall Gültigkeit haben und denen es vollkommen egal ist wo sie sich befinden. Kurzum, die Maschinen alten Musters arbeiteten allein für sich selbst und an und für sich. Mechanisch arbeitende Maschinen arbeiten seriell, d.h. sie arbeiten Stück für Stück die Arbeit ab, die sie eben vorfinden.
Die mechanisch arbeitenden Maschinen arbeiteten seriell und kümmerten sich nicht um ihre Umwelt. Damit entsprachen sie in etwa dem Paradigma der textuellen Struktur. Die textuelle Struktur geht, wie wir schon gesehen haben, davon aus, dass die Wirklichkeit wie eine Perlenkette ist, an der entlang man die Elemente Stück für Stück, Perle für Perle aufreihen kann. Das hat sich deutlich geändert und trägt zu einem veränderten Paradigma bei bzw. ist Ausdruck eines veränderten Paradigmas. Die Gene- ration der intelligenten Maschinen, die derzeit entwickelt werden, nehmen Bezug auf ihre Umwelt und realisieren die dorten Veränderungen, sie werden in sehr viel höherem Masse interaktiv als wir das bisher kennen. Und selbst wenn die Realität hinter den Erwartungen hinterherhinkt, ist doch der An- spruch schon ein Zeugnis einer wesentlichen Veränderung, die als Anspruch schon wichtig und von Bedeutung ist.
Diese Ausführungen bringen uns zum weiterführenden Punkt, der im folgenden behandelt werden soll:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Technologie ergibt als Ganzes eine andere Struktur, die sich nicht mehr textuell verstehen lässt!
Während der Bamberger Hegeltage vor einigen Jahren, sprach die Schweizer Philosophin Jean Hersch zum Thema Technik. Ihre Ausführungen waren insofern interessant als die Philosophin nicht eine Philosophie der Technik oder eine Technikphilosophie vorstellte, genau das, so sagte sie, sei gar nicht möglich. Ihre Aussage ging eher dahin die Technik als eine Umwelt zu erklären, als ein Biotop, in dem wir uns bewegen und in dem wir leben. Technik ist nicht irgendeine Größe außerhalb des Menschseins, sondern sie habe längst eine anthropologische Komponente angenommen. Technik ist das Medium, der Äther in dem wir uns bewegen. Wenn aber Technik nicht mehr nur ein Element unter vielen anderen ist, dann hat das Konsequenzen, über die wir uns im klaren sein müssen, wenn wir über Technik reden. Wenn Technik nicht nur Artefakt sondern Umwelt, Äther oder Biotop ist, dann fordert uns das heraus, zumindest diesen Gedanken einmal zu denken und ihn auf seine Konsequenzen hin zu überprüfen.
Technik ist zur Umwelt des Menschen innerhalb der westlichen Kultur geworden und nicht mehr nur Artefakt. Eine der Konsequenzen die sich daraus ergibt ist das wir in technischen Systemen denken und das wir längst den Punkt überschritten haben, an dem wir die Maschinen, weil sie uns möglicher- weise bedrohen oder gefährlich werden könnten, abschalten können. In einem Beitrag des Bayrischen Rundfunks zum Thema Gentechnik im Frühsommer 2000, kam unter anderem eine Radiosendung mit dem Titel „ Der Mensch als Zwischenschritt der Evolution? “. In diesem Beitrag ging es darum, dass es durchaus denkbar erscheint, dass wir zum einen eine genetisch aufgepeppte Spezies entwickeln und dass wir zugleich eine Evolution der Maschinen erleben. Auf die Frage, ab wann es denn wohl nicht mehr möglich wäre, die Maschinen abzuschalten, z.B. in Form intelligenter Computersysteme, antwortete der interviewte Fachmann, dass wir das schon jetzt nicht mehr können. Würden wir die Maschinen abschalten, dann würde auf der Stelle unsere Kultur zusammenbrechen. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass wir die Maschinen kontrollieren, sondern wir haben längst die Kontrolle über das Ausmaß der Technik verloren.
Dieser Verlust der Kontrolle ist weder gut noch schlecht, er ist erst einmal Fakt und dieses Faktum müssen wir zur Kenntnis nehmen! Wir denken und wir leben in den Kategorien der Technologie und können uns außerhalb von Technologie gar nicht mehr leben und auch nicht mehr denken. Die Tech- nosphäre ist allgegenwärtig und es geht nicht mehr nur darum ob es eine Technosphäre gibt oder nicht, sondern es geht darum das sich diese Technosphäre verändert. Haben wir aber eine Technosphäre, dann leben wir in kontextuellen Technologien! Das aber heißt, dass Technik einen Kontext stellt und als ganzes nicht mehr linear und textuell zu verstehen ist. Wir können Technik nicht mehr im Sinne eines nacheinander aufzureihenden Vorgangs verstehen, sondern wir müssen Technik kontextuell verstehen. In dem Maße wie wir aber anfangen Technologie als Kontext zu verstehen, verändert sich auch die konkrete Technologie.
Diese Technosphäre lässt sich vielleicht am ehesten im Sinne eines koevolutiven Systems verstehen. Koevolutive Systeme umgeben uns überall, ohne das wir uns dessen immer bewusst wären. Wir haben weiter oben den Begriff des koevolutiven Systems bereits eingeführt und wollen hier nur kurz skizzie- ren, was es damit auf sich hat in bezug auf den konkreten Zusammenhang. Es macht, wenn man von der Technosphäre ausgeht, nur noch bedingt einen Sinn, zwischen der Natur des Menschen und der Technologie, die vom Menschen erfunden worden ist, zu unterscheiden. Wenn wir es mit einem koe- volutiven System zu tun haben, dann wird dieser Aspekt bzw. diese Tendenz sich noch steigern, wenn die Technologie interagierender wird, also noch mehr in die Lage versetzt wird, sich mit der jeweili- gen Umwelt auseinander zu setzen. Die Technosphäre verdichtet sich dadurch und die Technologie wird noch weiter Teil des Menschen.
Noch Paul Virilio hat in seinem Buch „ Die Eroberung des Körpers “ prophezeit, dass Mensch und Technologie eine Synthese eingehen werden, die den Menschen mehr und mehr zum Roboter machen werde. Das Symbol für diese Entwicklung sieht Virilio im Herzschrittmacher. Technologie dringe in den Körper des Menschen ein und verbleibe nicht mehr außerhalb des Menschen. Damit ist Virilio im Prinzip richtig, aber er verbleibt, obwohl er gerade das nicht will, an der Oberfläche des Geschehens. Dieser Verbleib an der Oberfläche drückt sich, wenn man die Gentechnik als symbolische Größe ver- steht, in der Optimierung der biologischen Vorgaben durch die Biotechnik aus. Die Technologie dringt nicht mehr in Form von plumpen Apparaten in den menschlichen Körper ein, sondern die Technologie verändert den Körper schon im Vorfeld. Diese subtile Veränderung bzw. Optimierung des Menschen durch die Technologie, zu der man in weiten Teilen auch die Medizin rechnen kann, drückt aus, dass wir in einem Prozess befindlich sind, der es nicht mehr möglich macht, Technologie linear zu verste- hen. Technik ist Kontext nicht mehr außerhalb des Menschen zu lesender Text.
Unsere Umwelt verändert sich, also verändern wir uns, indem wir uns aber verändern, verändert sich wiederum unsere Umwelt. Und den Begriff Umwelt allein auf Natur zu beziehen, was man immer auch mit dem Begriff verbinden mag, macht keinen Sinn, denn unsere Umwelt ist Technik! Technik entwickelt sich damit zum kontextuellen System, besser noch, zu einem verdichteten kontextuellen System.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Vilém Flusser oder vom Text zum Kontext
Der Philosoph Vilém Flusser ist eine der interessantesten Erscheinungen, wenn es um die neuen Me- dien geht, um die Veränderung des Lebens und der Lebensstrukturen. Manches ist heute nicht mehr ganz so aufregend und fremd wie zu der Zeit als Flusser seine Schriften veröffentlicht hat. Aber auf vielen im Netz verstreuten Homepages stößt man auf Flusser, wenn man sich mit dem hier zu erör- ternden Thema beschäftigt und entsprechende Begriffe in die Suchmaschinen eingibt. Vilém Flusser ist allgegenwärtig und wer ihn liest, taucht in ein eigenes Gedankenuniversum ein, in dem man sich erst einmal orientieren muss. Wer allerdings die erst einmal aufkommende Fremdheit des Denkens von Flusser aushält und etwas tiefer eindringt in seine Gedankenwelt, der findet geradezu Erstaunli- ches vor. Wir können hier, was Flusser betrifft, nur an der Oberfläche kratzen und diesen Ausführun- gen liegen auch nur Texte zugrunde, die ich auf verschiedenen Homepages im Internet gefunden habe. Wer diese Texte sucht, der kann sich beim Heise-Verlag einwählen und bei der Onlinezeitschrift „Te- lepolis“ nach Flussertexten suchen. Von dort aus bekommt man entsprechende Links zu anderen Tex- ten. Oder man lässt gleich in einer beliebigen Suchmaschine nach dem Namen Flusser suchen. Die Adresse der Onlinezeitschrift „Telepolis“, lautet: www.heise.de/tp/deutsch .
Wenden wir uns nun der inhaltlichen Seite der Flusser-Texte zu und gehen dabei anhand einer guten Zusammenfassung vor, die von Claudia Klinger veröffentlicht wurde. Die Autorin hat im Netz eine eigene Onlinezeitschrift platziert (http://www.home.snafu.klinger/flusslinks.htm). Hier findet man ebenfalls Hinweise bzw. Links auf Flusserseiten. Claudia Klinger schreibt nach dem Tode Vilém Flusser einen Nachruf und führt noch einmal in seine Gedanken ein:
„ "Vil é m ist tot!" Betrübt schaute der Typ am Tresen in sein leeres Weinglas, offenbar erwartete er keine Antwort und wollte seiner Bemerkung auch nichts hinzufügen. Es war im Mai 1991 und ich
wunderte mich, daßder Tod von Vil é m Flusser, der gerade bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war, solche Betroffenheit auslöste - auch bei Leuten, denen ich gar nicht zugetraut hätte, zu den philosophisch Interessierten zu gehören. Doch während ich das schreibe, wird auch mir wieder traurig zumute, denn Vil é m Flusser war einzigartig in seiner Art zu denken, vorzutragen, zu lehren und zu schreiben.
Gerade lese ich seine "Vorlesungen zur Kommunikologie" und bin aufs Neue fasziniert von seiner Präsenz und seiner - auch bei den komplexesten Darstellungen - immer verständlichen Sprache. Nie hatte er es nötig, seine Texte und Reden mit mehr verwirrenden als belehrenden Verweisen auf diesen und jenen Autor zu spicken, wie es so viele tun, die einfach vorführen müssen, was sie alles wissen und damit gleichzeitig bei den Zuhörenden das Gefühl eigener Bildungsmängel erzeugen. Flusser konzent- rierte sich allein auf den Gang seiner Gedanken. Er konnte sich das erlauben, denn seine Gedanken sind spannend und neu. Es macht Spaß, ihn zu lesen! Bevor ich auf die Inhalte eingehe, ist die Form seiner Rede erwähnenswert: er beschreibt die Dinge konsequent phänomenologisch, das heißt unvor- eingenommen betrachtend, ohne vielerlei intellektuelle Vorentscheidungenüber die zu beschreibende Sache. Ein Beispiel:
Fernsehen
Vom Standpunkt des Empfängers sieht es so aus: Zwischen den Möbeln des Wohnraums steht eine Kiste. Sie hat ein fensterähnliches Glas und verschiedene Knöpfe. Werden diese zweckm äß ig behan- delt, entströmen dem Glas kinoähnliche Bilder und einem nicht auf Anhieb sichtbaren Lautsprecher kinoähnliche Töne. Die Bedienung ist einfach, aber die Gründe, warum die Kiste funktioniert, sind undurchsichtig. Man nennt derartige Systeme strukturell komplex und funktionell einfach. Ihr Gegen- teil sind strukturell einfache und funktionell komplexe Systeme, deren Aufbau durchsichtig ist, die jedoch in ihrer Bedienung Schwierigkeiten bereiten. Ein Beispiel hierfür ist das Schachspiel. Was Systeme vom Typ "Fernsehkiste" kennzeichnet, ist, daßder mit ihnen Spielende selbst zum Spielball des Spiels wird: er scheint das Spiel zu meistern, ohne es zu durchschauen, und das Spiel verschluckt ihn.
Diese Art "Schreibe" hat etwas Verblüffendes und deshalb auch dann noch Amüsantes, wenn es sich um todernste Probleme handelt, wie etwa den anstehenden Untergang des Menschen, des speziell Humanen am Menschen. Womit ich bei Flussers Themen bin, die sich rund um den Begriff "Krise" anordnen, einer Krise, angesichts der er sich immer auf ermutigende Weise geweigert hat, Pessimist zu sein. Er sieht die Menschen in der Situation, sich darüber aufgeklärt zu haben, ein Nichts im Nichts zu sein: Die moderne Wissenschaft hat gezeigt, daßdas Objekt nicht etwas Solides ist, sondern eine Ausbuchtung einander kreuzender Beziehungsfelder. Die moderne Psychologie und Existenzanalyse legen nahe, daßwir keinen 'harten Kern' haben bzw. kein solcher Kern sind (alles, was einmal den Menschen ausmachte: Freiheit, Verantwortung, Geist, Seele - wurde zu Ende analysiert und nichts bliebübrig außer den zufällig gegebenen sozialen und genetischen Bedingungen, die ja auch nichts Festes sind). „
(Claudia Klinger, „ Die Krise des Codes “ )
Flusser sieht das, was wir im Alltagsverständnis immer noch als festes, handgreifliches Objekt nennen, als das was es in den Naturwissenschaften ist: Ein Knotenpunkt, eine Verdichtung von Beziehungen, die sich ins Sichtbare, ins Greifbare hinein fortsetzen und dort manifest werden. D.h. in der Konse- quenz, dass alles Leben sich in Beziehungen vollzieht. Nicht die Kiste, in dem Beispiel der Fernseher ist es, auch nicht der fernsehende Mensch, sondern das was das Energien dazu veranlasst Materie hervorzubringen und den Mensch, sich in Beziehung zu setzen zu diesem Gerät, dass geradezu darauf angelegt ist, sich mitzuteilen. Die Konsequenzen aus einem solchen Denken sind immens und deuten auf das, was Claudia Klinger schlicht die Bodenlosigkeit nennt.
„ Dies macht einen Sturz ins Bodenlose unvermeidlich. Wer nicht mehr an die Dinge glauben kann, glaubt auch nicht mehr an das Heil, an ein Ziel der Geschichte und an die technische Herstellbarkeit des Glücks. Die Krise ist so umfassend, daßder herrschende Code menschlicher Kommunikation, das lineare Alphabet, mit in den Abgrund gerissen wird. Die Texte verlieren ihre Funktion, uns mit ihrer Hilfe ein Bild von der Welt zu machen, denn ein wissenschaftlicher Textüber die Welt ist nicht mehr verständlich, man kann sich dazu nichts mehr vorstellen. Weil dies so ist und weil die Wissenschaft dennoch unsere "herrschende Lehre" bleibt, werden Texte allgemein bedeutungslos: man kann ihnen nicht mehr glauben, man konsumiert sie nur noch wie eine beliebige Freizeitbeschäftigung (es frage sich doch jeder mal, wann ein Buch zuletzt zu einer sofortigen Ä nderung in der Lebenspraxis geführt hat? Ich meine keine Computerbücher!). „
(Claudia Klinger, „ Die Krise des Codes “ )
Diese Aussagen, so dicht und gedrängt sie sind. Deuten das an was wir im ersten Teil besprochen haben. Der lineare Code, an dem entlang wir uns Welt und Wirklichkeit erschlossen haben, hat seine Funktion eingebüsst. Mehr noch: der lineare Code kann das, was wir inzwischen wissen, nicht mehr vermitteln. D.h. lineare Texte sind nur noch bedingt in der Lage uns ein verlässliches Wissen über die Welt zu vermitteln. Es erklärt sich daher fast von selbst, warum, gerade im Internet oder auf internen Netzwerken soviel mit Hypertextsystemen gearbeitet und experimentiert wird. Nicht das die Hypertexte uns vertraut wären, dass wir mit diesen nichtlinearen Textsystemen zurechtkämen, aber sie vermitteln uns ein Bild von der Wirklichkeit, so wie sie uns von den Naturwissenschaften dargestellt wird, dass vielleicht noch am ehesten erklärt oder andeutet was gemeint ist.
In der Konsequenz heißt das, dass Wirklichkeiten sich aus kommunikativen Prozessen ergeben. Wirk- lichkeiten sind das Ergebnis eines Prozesses, an dem viele Wirklichkeiten beteiligt sind und die nicht mehr im Sinne eines linearen Verstehens zu bewältigen sind. Als Beispiel oder auch als Ausdruck dieses Vorgangs möchte ich hier die sogenannten IT-Berufe anführen. IT steht für Information und Technologie, also alle Berufe die mit Informationstechnologien im weitesten Sinne zu tun haben, fal- len unter die Rubrik der IT-Berufe. In dieser Branche ist der Wandel vermutlich am deutlichsten zu spüren. Wir stellen im folgenden lediglich ein skizzenhafte Schematik von Beispielen auf, die viel- leicht zeigen kann was gemeint ist.
Am 27.8.2000 kam in der Sendung „ hitec “, die im Sender 3-Sat jeweils Sonntags von 16-16:30 Uhr ausgestrahlt wird ein Beitrag zum Thema IT-Berufe und die Grenzen des dualen Ausbildungssystems. Es wurde das ZDF zitiert, das in letzter Zeit drei neue Berufe kreiert hat, die unmittelbar mit Medien- technologien zu tun hatte. Bemerkenswert war, dass zum einen das ZDF eigenen Ausbildungswege entwickelt hat und das es bei allen drei Berufen darum ging, so wurde es mehrfach betont, dass die Auszubildenden sogenannten Allrounder werden sollten. D.h. es geht darum, ein gewisses Grundla- genwissen zu erwerben zugleich sollten sie aber auch sehr früh in der Praxis arbeiten. Dadurch dass sie nicht eine Branche ausreichend bzw. richtig linear von A bis Z lernen, sollten sie in die Lage ver- setzt werden, ihr Wissen möglichst schnell zu verändern, die Praxis den jeweils wechselnden Anforde- rungen anzupassen und im Grunde in der Lage zu sein innerlich zu springen. D.h. diese Menschen sollten in die Lage versetzt werden, von allem ein wenig zu wissen und dieses Wissen, in der Praxis jeweils neu zu ordnen und neu zu kombinieren. Während noch die klassischen Berufe, wie die des Informatikers, eine lineare Ausbildung haben und ein lineares Vorgehen implizieren, sollen diese Me- dientechniker in der Lage sein zu springen. Sie sollen kreuz und quer einsetzbar sein. Es bringt nichts mehr in einem Fach ein ausreichendes Wissen zu sammeln, weil dieses Wissen morgen schon wieder alt ist und damit unbrauchbar wird. Es geht vielmehr darum, dass was man weiß immer wieder neu zu kombinieren und zu ergänzen. Dazu muss man nicht alles wissen, sondern pragmatisch mit dem eige- nen Wissen umgehen können.
Wer heute in den Feinheiten einer Informationstechnologie fit ist, der muss ständig am Ball bleiben um dieses Wissen auch auf dem neuesten Stand zu halten.. Das ist aber nicht mehr sinnvoll und nicht mehr machbar. Eine junge Firma für Webdesign sucht händeringend Mitarbeiter und stellt die Men- schen nicht nach ihren beruflichen, sondern nach persönlichen Qualifikationen ein. Wer sich bewirbt braucht überhaupt keine Kenntnisse in bezug auf Computer zu haben oder etwas von Software zu ver- stehen, sondern es geht darum offen zu sein, teamfähig und bereit, sich Wissen zu erarbeiten und die- ses Wissen zu verändern neu zu kombinieren wenn es denn dran ist. Und bei der Geschwindigkeit mit der sich Technologien verändern, ist es im Grunde ein Dauerthema, dass das was man weiß, nur noch bedingt stimmt.
Hier werden also, mehr als in vielen anderen, eher klassischen Berufen, die Fähigkeit verlangt, in Vernetzungen zu denken und zu arbeiten. Nicht mehr, dass man in seinem jeweiligen Fach etwas kann ist entscheidend, sondern das man bereit ist, Neues zu lernen und sich einzuarbeiten, und sich gerade nicht allzu sehr zu spezialisieren.
Das alles drückt aus, dass sich etwas wesentliches verändert und diese Veränderungen sind, wie Flusser es nennt, eine Revolution der Codierung:
„ Flusser zentriert seine Beobachtungen in dieser gefährlichen Lage auf das Heraufkommen eines neuen Codes, des Codes der technischen Bilder, der das Alphabet ablöst. Er arbeitet den Unterschied zwischen technischen Bildern, die Bilder von Begriffen sind, im Vergleich zu traditionellen Bildern heraus, die noch eine Realität abbilden. Und er beleuchtet die verzweifelte Lage der menschlichen Kommunikationsstrukturen: Im Zuge des Umbruchs der Codes geraten die Methoden menschlicher Verständigung zu wirkungslosem Leerlauf (z.B. in der Politik) und bewusstlosem Programmiert- werden durch die Massenmedien, die sich der neuen Technobilder (Fotografie, Filme, Fernsehen) bedienen. Es droht ein voll automatisierter und autonomer totalitärer Techno-Staat. Dabei will Flus- ser auf keinen Fall allein "die Sender" für das Geschehen verantwortlich machen, nein: wir alle seien (noch!) nicht in der Lage, mit Technobildern und neuen Medien angemessen umzugehen, weil wir noch alphabetisch konditioniert sind und mit unserem geschichtlichen Bewusstsein hilflos in einer Welt herumrudern, die schon längst einen neuen Code schreibt. Den neuen Bewusstseinszustand, der den Technobildern angemessen ist, nennt Flusser "Technoimagination" und versucht, sich - und uns- vorzustellen, wie er aussehen könnte.
Besonders spannend für Internet-Interessierte macht Flussers Denken - von dem ich hier nur einen winzigen Appetithappen vorgestellt habe - seine Feststellung, daßes technisch leicht möglich wäre, die (Amphitheater-)Struktur "Großer Sender - Massenpublikum" in eine dialogische Struktur zu ver-ändern, bei der jeder Teilnehmer gleichzeitig Sender und Empfänger ist. Das WorldWideWeb hat er leider nicht mehr mitbekommen, es hätte sicher seinem Bemühen, in der Krise neue Wege aufzuzeigen, Auftrieb gegeben. Trotz seiner Weigerung, Pessimist zu sein, war er - angesichts dessen, was vor sich geht - mehr als besorgt und war sich vor allem klar, daßder anstehende "Bewusstseinssprung" kein Spaziergang wird:
"Die Aufgabe, vor welche uns unsere Krise stellt, ist außerordentlich schwierig. Sie bedeutet die Auf gabe aller Kategorien, für die wir programmiert sind, nicht nur der sogenannten "Werte", sondern vor allem jener Kategorien, durch welche bisher die Welt erkannt, gewertet und erlebt wurde. Es handelt sich um die Aufforderung, Halsüber Kopf in den Abgrund des Unbekannten zu springen. Die Alterna tive ist, zu funktionieren anstatt zu leben, das heißt, die menschliche Kommunikation als Sinngebung und als Methode des Ü berlebens im Anderen aufzugeben. Angesichts einer solchen Alternative er scheint das Wagnis, zu dem uns unsere Krise auffordert, weniger verzweifelt."
(Claudia Klinger „ Die Krise des Codes “ )
Flusser an vielen Stellen den Konstruktivismus vorweggenommen, meint aber in letzter Konsequenz noch etwas anderes als diesen. Flusser hat eine eigene Theorie des Codes entwickelt, die sich wie folgt aufbaut:
„ Ein erster Schritt besteht in der Feststellung, daßdie Welt mit der Verbreitung der digitalen Bilder nun selbst digitalisierbar, d.h. kalkulierbar geworden ist. Zur Kalkulation der Welt haben wir Appara- te, denen das Subjekt gewissermaßen angeschlossen ist. Der Mensch ist eine Verlängerung dieser Apparate (gem äß der These von Mc Luhan, nach der die Medien die Verlängerung menschlicher Funktionen darstellen). Zur Veranschaulichung der Entwicklung zu einer immer stärkeren Verschrän- kung von Mensch und Maschine möchte ich kurz Flussers strukturgeschichtliches Verlaufsmodell dar- stellen.
1. Stufe: Der Mensch befindet sich in einer vierdimensionalen Raumzeit, in der er sich noch nicht als Subjekt wahrnimmt, der Welt des nur konkreten Erlebens.
2. Stufe: Die Verwendung der Hand trennt Subjekt vom Objekt, der Mensch nimmt Gegenstände wahr, die Welt wird dreidimensional. Kultur entsteht, da der Mensch zwischen sich und der Umwelt unterscheiden kann. (z.B. geschnitzte Figuren)
3. Stufe: Die traditionellen zweidimensionalen Bilder entstehen, da der Mensch zwischen den einzelnen Elementen seiner Umwelt Zusammenhänge herstellen kann. Es entsteht ein imagi- niertes Universum (Höhlenmalerei).
4. Stufe: Mit dem linearen Text gibt es eine weitere Vermittlungszone, die auf Begreifen, Erzäh- len und Historizität beruht. Die Vorstellungen werden in Begriffe gefasst, die Fläche wird zur Zeile (Homer und die Bibel).
5. Stufe: Die technischen Bilder zerlegen den Text in komputierbare Punkte. Der lineare Text wir arbitären "orthographischen" Regeln unterworfen, die auch anders sein könnten. Damit fallen die Begriffe auseinander und wir haben es im folgenden mit Punktelementen, "nulldimensio- nalen Informationsbits" zu tun. Diese können zu scheinbaren Bildern oder Begriffen kompu- tiert oder "eingebildet" werden. “
(Oliver Fahle, „ Die technischen Bilder “ )
Das hat ungeheure Folgen für die Subjekte die Oliver Fahle so beschreibt:
„ Das Subjekt wird in dieser Welt mit den Apparaten geradezu verschmelzen, die Gesellschaft ist nur noch ein gigantischer (und unendlich parzellierter) Dialog, in der das "Ich" zu einem Knotenpunkt von dialogischen Fäden wird, in der bis zur Ununterscheidbarkeit von senden und empfangen, gesen- det und empfangen wird. Die Kreativität (und der Mensch tut nichts anderes mehr als kreativ zu sein) ist das Einbilden auf (dem) Grund vorhandener, in Apparaten gespeicherter Informationen. Vom Mc Luhanschen kosmischen Dorf geht es in Flussers kosmisches Gehirn, in dem durch "Tasten" beliebige (aber immer zum Dialog fähige) Informationen zusammengebracht werden. Aus den Subjekten werden Projekte alternativer Welten, der Mensch existiert nicht mehr außerhalb der Programme. Flusser geht also nicht mehr davon aus, daßdie Welt entziffert oder gelesen werden muß, sondern daßsie gewissermaßen von innen heraus entworfen wird (nicht Spiegelung sondern Projektion). Der Mensch löst sich von der Verhaftung und dem Glauben an die Gegenstände und partizipiert an einer ständigen kreativen Neuerschaffung der platonischen Ideenwelt, in die er zugleich bis zur Ununter- scheidbarkeit aufgeht. „
(Oliver Fahle, „ Die technischen Bilder “ )
In einem anderen Text wird die Herleitung von Flussers System so beschrieben:
1. Stufe : der Naturmensch lebte ebenso wie das Tier im 4-dimensionalen Raum (3 Raumdimen- sionen und eine Zeitdimension). Es ist dies die Stufe des konkreten Erlebens, aus dem noch kein Heraustreten möglich war.
2. Stufe : etwa zwischen 2 Mio. Jahren bis 40.000 v.Chr. standen die uns vorangehenden Men- schenarten durch ihre Hände als Subjekt den Objekten ihrer Umwelt gegenüber. Mittels des Fassens und des später auftretenden Behandelns konnte die Lebenswelt in Werkzeugen zum Stillstand gebracht werden (durch die Dauerhaftigkeit der erzeugten Gegenstände und ge- schnitzten Figuren) Der Mensch konnte die Natur verändern, sie planvoll manipulieren. So trat er vom 4-dimensionalen Raum in den 3-dimensionalen, das Volumen ein.
3. Stufe : Im nächsten Schritt trat er in die Fläche ein, er konnte so weit von der Natur zurücktre- ten, daßer sie in Bilder fassen konnte. Die ersten Höhlenmalereien wurden vor etwa 40.000 Jahren angefertigt. Es ist dies die Stufe der Anschauungen und des Imaginierens. Und da die Bilder 2-dimensional sind, verhalten sich die Vorstellungen in ihnen zirkulär, das heißt, die eine erhält von der anderen ihre Bedeutung. Ein solches Wechselverhältnis der Bedeutungen heißt magisch.
4. Stufe: Ü ber ein Aneinanderreihen von Piktogrammen ( Ä gypten) wurde dann etwa 1500 v.Chr. die erste Buchstabenschrift auf Tontafeln in Mesopotamien entwickelt. Mit dem Ü bergang in den 1-dimensionalen Raum entstand zusehends das lineare Denken. Die Bilder wurden er- klärt, indem sie in abakusartige Reihen von aufgefädelten Begriffen, den Zeilen, gebracht wurden. Orthografie, Grammatik, oder kurz die Logik unterwarfen den Sprachcode (Code = ein System aus Symbolen) klaren und distinkten Regeln und leiteten eine Entmythologisierung und Entmagisierung und dadurch lineares, geschichtliches Denken ein. Durch den erneuten Verlust einer Dimension in der Beschreibungsebene gelangte man zu einem höheren Abstrak- tionsgrad, einem weiterem Zurücktreten von der konkreten Welt. Damit waren wirksamere Handlungen als mit magischem Denken möglich. Es wurde zwar auch zu jener Zeit ein ma- thematischen Code der Zahlen entwickelt, doch wurde dieser, weil als zu leer empfunden, von der alphabetischen Sprache eindeutig dominiert.
5. Stufe : Durch den technischen Fortschritt wurden seit Ende des 19. Jahrhunderts (Fotogra- phie, Kinematographie) das Vertrauen in die Texte langsam erschüttert und der mathemati- sche Code trat deutlicher hervor. Vor allem die Erkenntnisse aus der Mikrophysik und Kyber- netik zerteilten die Welt in immer kleinere Teilchen. Ü brig blieb lediglich ein Schwarm von Quanten und Computerbits. Spätestens seit dem Aufkommen des digitalen Zeitalters befinden wir uns vorrangig im 0-dimensionalen Raum. Mittels technischer Apparate wird die Welt in die 0-dimensionalen Punktelemente, Pixel, 0-1-Informationen zerlegt und wieder zusammen- gesetzt. Flusser nennt dies Kalkulieren und Komputieren. Die mathematische Sprache begann somit, die Linearität der Alphabetschrift zu verdrängen. Damit ist nach Flusser dieäußerste Abstraktion erreicht: ``der Fortschritt ist, wenn man ihn dimensional sieht, damit erledigt ´´ . “
Die gesamte Wirklichkeit mutiert zum dialogischen Prozess, in dem das Subjekt eine mögliche Realisation unter anderen ist. mehr noch, das Subjekt verliert seine einzigartige Position, seine Exponiertheit in der Form wie wir sie kennen und glaubten. Welt wird zum Gespräch in dem wir Teilnehmer und Mitgestalter sind. Die textuellen Strukturen der Wirklichkeit brechen auf und wir geraten immer mehr in andere, kontextuelle Strukturen. D.h. wir sind Teile eines kommunikativen Vorgangs, nicht außerhalb und von außen in die Ereignisse hinein mitkommunizierend, sondern mitten drin im Prozess des Gesprächs. Diese ungeheuren Konsequenzen durchdringen unseren gesamten kulturellen Prozess und es ist kaum radikal genug anzusetzen, wenn man bedenkt was das heißt.
Wenn wir im folgenden versuchen wollen, diesen Vorgang auf die Religion umzubrechen, dann zum einen deshalb, weil es immer gut ist einen solchen Prozess anhand eines Beispiels durchzugehen, zum anderen weil die Religion auf der einen Seite sicher eine wichtige Rolle spielen wird bei diesen Um- brüchen und weil sie sich zugleich mit am schwersten tut, ist der Prozess anhand der Religion beson- ders interessant zu beschreiben. D.h. auf der einen Seite wird die Religion wichtig sein, wenn auch nicht in der Form wie wir es vielleicht erwarten würden, auf der anderen Seite hebelt der Vorgang vieles aus, was wir bislang unter Religion verstehen. Da diese Spannungen zum Teil schon sichtbar werden und weil sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch wichtiger werden, kann es von Bedeu- tung sein, gerade der Religion ein gewisses Augenmerk zu schenken. Denn hier werden noch Ausei- nandersetzungen laufen, die wir möglicherweise so nicht erwarten würden, wenn wir um diesen Um- bruch nicht wüssten.
Vielleicht wird aber auch noch einmal deutlicher, was der Bruch wirklich heißt
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5. Der Abschied vom Textuellen in der Religion
Wer die Entwicklungen in den letzten 100 Jahren verfolgt hat, der wird längst bemerkt haben, dass die Religion in einer Krise steckt. Krise nicht im Sinne eines völlig Abbruchs der Religion, sondern einer Veränderung des Religiösen im Erscheinungsbild und in der Art und Weise wie wir Religion verste- hen, wie wir mit ihr umgehen und in bezug auf die Funktion der Religion. Diese Krise hat sich in den letzten Jahrzehnten noch weiter zugespitzt und dementsprechend auf die Religion zurückgewirkt. Die- ser Bruch oder Umbruch der Religion kann unter anderem auch in diesem Zusammenhang dargestellt werden. Um das zu verdeutlichen wollen wir an einem, vielleicht wichtigen Aspekt, herausarbeiten, wie sich diese Krise ausdrückt und wodurch sie sich bemerkbar macht. Der Aspekt um den es hier gehen soll, ist das Menschenbild bzw. die Stellung des Menschen, so wie er im Christentum klassi- scherweise verstanden und gedeutet wird.
Die Krise hat ihren Ausgang in der Zeit des entstehenden Darwinschen Denkens. Bis zu Darwin gin- gen die Menschen davon aus, dass es eine Typologische Zuordnung von Rassen gebe. Diese rassische Typologie geht auf die griechische Philosophie zurück und wurde durch Darwin widerlegt. Heute wis- sen wir, dass die auf der Erde vorkommenden Lebensformen weitgehend den gleichen Genpool haben und dass es keine Rassen in dem Sinne gibt. Ob wir es mit einem Frosch, mit einer Hefe, einem Men- schen oder einem Fisch zu tun haben. Immer haben die Lebewesen Gene, die sich nicht wesentlich unterscheiden. Die herausragende Position des Menschen, so wie sie über Jahrhunderte hinweg ver- mittelt worden ist, verliert mit der Evolutionstheorie ihren Boden. Der Mensch ist, zumindest aus der genetischen Perspektive, nicht mehr die Krone der Schöpfung, sondern Teil eines Naturganzen, in dem er den anderen Lebensformen, zumindest genetisch, nichts weiter voraus hat. Das er Bewusstsein hat, ist ein enormes Phänomen, aber die exponierte Position des Menschen ist nicht mehr auf den alten Wegen begründbar.
Aber nichts desto trotz haben wir uns bisher immer von einem solchen konsequenten Schluss distanziert und haben weiter so getan als sei das was wir wissen, zu vernachlässigen. Genau das aber ist es, wie es scheint, nicht. Der Philosoph und Biologe Ernst Mayr hat in der Ausgabe 9/2000 von „Spektrum der Wissenschaft“ einen Aufsatz über die Wirkungen von Charles Darwin und seiner Theorie veröffentlicht. In Bezug auf das Menschenbild schreibt Mayr:
„ Darwin schuf ein neues Menschenbild - und ermöglichte damit einen neuerlichen Anthropozentris- mus. Von allen Thesen Darwins konnten seine Zeitgenossen sich am schwersten mit der Aussage ab- finden, dass die gemeinsame Abstammung aller Organismen auch für den Menschen gelten sollte. Für Theologen wie Philosophen stand der Mensch nicht nurüber allen anderen Geschöpfen, sondern auch abgesondert von ihnen. Ob Aristoteles, Descartes oder Kant - in dieser Frage stimmten diese großen Philosophenüberein, so unterschiedlich ihr Denken sonst war. Dann aber zeigten zwei der frühesten Vertreter des Darwinismus - der britische Zoologe Thomas Huxley (1825-1895) und der deutsche Zoologe Ernst Haeckel (1834-1919) - mit detaillierten anatomischen Vergleichen, dass der Mensch und die heutigen Affen eindeutig gemeinsame Vorfahren haben. Damit verlor der Mensch seine Ein- zigartigkeit.
Ironischerweise starb dadurch aber nicht die Anhropozentrik. Denn seiner „ niedrigen “ Herkunft er- wies der Mensch sich in weiteren Nachforschungen trotzdem als einzigartig. Nicht nur sucht seine Intelligenz ihresgleichen und nicht nur besitzt allein er echte Sprache mit Grammatik und Syntax. Darwin betonte gern, dass einzig die Menschen wirkliche ethische Systeme entwickelt haben. Und als einzige Wesen schufen die Menschen dank ihrer Intelligenz, der Sprache und der langen Fürsorge für ihre Kinder eine reiche Kultur - und machten sich damit zu den Herrn dieser Welt, im Guten wie im Bösen. “
(Ernst Mayr, „ Darwins Einfluss auf das moderne Weltbild “ in „ Sektrum der Wissenschaft 9/2000)
Bisher ist es zumindest nicht widerlegt, dass der Mensch und die Menschenaffen gemeinsame Vorfah- ren haben, es ist auch deutlich, dass es eine genetische Verwandtschaft mit allen anderen lebenden Organismen gibt und nun kommt noch eine weitere Kränkung hinzu, die dem Menschen seine Position als „Krone der Schöpfung“ streitig machen wird. Die Rede ist von der Entwicklung hin zu einem kon- textuellen Verständnis der Wirklichkeit. Es kann sogar sein, dass wir nicht nur eine weitere Kränkung erfahren, sondern noch mehr und vielleicht noch heftigere Schwierigkeiten bekommen werden als wir sie, in Bezug auf die Position des Menschen, bisher hatten. Denn wenn die gemeinsame Herleitung vom Affen, die genetische Ähnlichkeit mit anderen Lebewesen bisher schon kränkend war, so wird die Kränkung infolge der kontextuellen Umbrüche noch weiter gehen und vermutlich subtiler ansetzen.
Da die Religion, auch und insbesondere das Christentum, den Menschen aber auf ein Podest befördert hat, auf dem er, einsam stehend, auf das kommende Heil wartet, ist der Sturz um so vernichtender. D.h. es könnte sich für die Theologie als besonders problematisch herausstellen, wenn man feststellt, dass der Mensch eben nicht zu trennen ist von seinem Kontext. Eine kontextuelle Theologie ist näm- lich bisher nur in Ansätzen sichtbar geworden und das auch nur in Bezug auf kulturelle Kontexte. Um zu verstehen, was hinter diesen dicht gedrängten Sätzen steht müssen wir kurz ausholen um zu erklä- ren was hier gemeint.
Wir haben weiter oben erklärt, dass der Mensch, genauso wenig wie andere Lebensformen als isolier- tes, herausgehobenes Wesen betrachtet werden kann. Alles was wir wahrnehmen ist zutiefst kontextu- ell zu verstehen. In der Theologie ist aber der Mensch, ebenso wie in der Philosophie (siehe oben bei Ernst Mayr) als herausgehobenes und kontextloses Exemplar vorgestellt worden. Das hat in der Folge dazu geführt, dass man religiös den Menschen retten kann, ohne das man Rücksicht auf seinen Kon- text, auf seine Umgebung nehmen muss. In manchen Ausformungen, gerade protestantischer Theolo- gie, geht es allein darum, den Menschen zu retten ohne das man in irgendeiner Form Rücksicht neh- men müsste auf seinen Kontext. Allein das die Seele gerettet wird ist interessant, das diese Seele sich ihre eigene Umwelt zerstört, also die Schöpfung aufs Spiel setzt und mit den Dingen umgeht als wäre es reines Material, fällt dabei nicht weiter ins Gewicht. Dieser Umgang mit der Rettung des Menschen von seiner „Sünde“ nimmt mitunter abstruse Formen an. Denn Sünde ist, wenn man es genauer anfragt eine Beziehungsstörung. Nun wird aber, in der Vergebung oder im Kampf gegen diese Sünde so getan, als ob allein die Beziehung des Menschen zu Gott geheilt werden müsse.
Bestenfalls wird noch die Beziehung zum Nächsten in den Blick genommen, aber schon bei der Be- ziehung zu den Dingen, die um uns herum sind, und die man unter dem Begriff Schöpfung subsumie- ren kann, hört es in der Regel auf. Daraus erwächst dann eine ungeheure Aktivität des Einzelnen, der gegen die „Sünde“ ankämpft, zugleich kann man aber, ohne auch nur das geringste dabei zu empfin- den, mit der Welt, den Dingen, der Schöpfung umgehen als hätten wir noch einige hundert Welten im Schrank, die man nach bedarf rausholen kann, wenn man die eine zugrunde gerichtet hat. Dieser Weltverbrauch, diese Vernutzung von Welt hat sicher mit einer massiv gestörten Beziehung zu tun, aber hier interessiert sich für die Störung kein Mensch mehr. Eine solche Haltung kommt im Grunde einem Zynismus gleich, der aber in aller Regel, wenn man selbst in einem solchen theologischen Sys- tem lebt, als solcher nicht wahrgenommen wird.
Nun gab es immer wieder Versuche von Seiten einiger Theologen, diesem Mangel abzuhelfen und den Kontext, in dem sich der Mensch hier bewegt, wieder herzustellen, aber es ist, wenn man das einmal so spitz sagen will, bei den gutgemeinte Versuchen geblieben, die in der Breite kaum etwas bewegt haben. Gottesdienste, wie die, die der katholische Theologe Eugen Drewermann durchgeführt hat mit Tieren und anderen Mitgeschöpfen oder solchen, die der Theologe Matthew Fox angedacht hat, ein- mal einen Gottesdienst für die Mikroorganismen zu feiern oder einen Gottesdienst für die Leber, sind meist, viel belächelte Ausnahmen geblieben. Was nun auf die Theologie zukommt ist aber noch einen Schritt weiter gehend als das was wir bisher hatten. Denn nun geht es nicht mehr nur um Schöpfung oder kontextuelle Theologie, auch wenn wir die schon nicht wirklich umgesetzt haben. Was nun kommt ist eine massive Infragestellung der Position des Menschen in dem System theologischer Er- kenntnis. Mehr noch. Wir haben es nicht nur damit zu tun, dass theologischer Erkenntnis in Frage gestellt wird, sondern wir haben es damit zu tun, dass sich, an der Theologie vorbei, diese Position aufzuheben scheint.
Welche Rolle spielt denn der Mensch tatsächlich? Ist es die Rolle, die man ihm klassischerweise zukommen lässt oder ist es nicht eine Rolle, die uns eher unangenehm sein dürfte, weil wir uns, in der kontextuellen Realisierung der Welt, nicht mehr allzu sehr abheben vom Rest der Welt? Wenn das was wir weiter oben ausgeführt haben, auch nur zum Teil stimmt, wenn sich die Revolution unseres Wirklichkeitsbildes auch nur zum Teil in diese Richtung ändern sollte, dann haben wir in der Theologie ein beachtliches Problem und wir bekommen noch größere Probleme, die weit über die Schöpfungstheologie hinausgehen. Wenn das so ist, dann wird die Religion, zumindest das Christentum, das eine a- kontextuelle Theologie des Menschen konstruiert hat, große Schwierigkeiten bekommen, die noch über die Schwierigkeiten, die sie jetzt schon hat, hinausgehen werden.
Im Grunde lässt sich im Sinne der linearen, textuellen Theologie eine Heilsgeschichte erkennen aber es handelt sich dabei immer um eine Geschichte des Menschen und diese Geschichte beginnt, wenn man es historisch zurückverfolgt, erst da, wo Menschen angefangen haben, sich an der linearen Logik der Schrift zu orientieren. Anders gesagt: Der monotheistische Gott des jüdisch-christlichen Glaubens ist ein Gott linearer Schriftorientierung, der sich gemäß der Logik der schriftlichen Textur verhält. Und nicht nur das, die ganze Welt hat sich, diesem Ansatz zufolge in dieser Weise dargestellt. Der textuelle Gott hat eine textuelle Welt geschaffen, die sich nur textuell verstehen lässt. Und der Mensch, ist nach Gott, der Leser oder Interpret dieser textuellen Struktur. Aber als Leser hält er das Buch der Natur eben von sich, hat deren Buchstaben vor sich und liest, Buchstabe für Buchstabe, Satz für Satz den Vorgang, der ihm dort begegnet. Aber der Leser dieser textuellen Welt und des textuellen Gottes, ist nie selbst Teil dessen was er liest. Zwar wir er wegen seines moralischen, ethischen oder religiösen Fehlverhaltens zurechtgewiesen, aber er verbleibt immer in der Rolle des Lesers.
Das ändert sich nun! Hat dieses jüdisch christliche Textur das Denken und Wahrnehmen über Jahrtau- sende bestimmt, so beginnt und die Kontextuelle Realisierung ihren Siegeszug und es kann durchaus sein, dass die Religion, zumindest das Christentum in der gegenwärtigen Form, den Sprung nicht schafft und in der Haltung der Verweigerung verbleibt bzw. selbst nicht recht realisiert was da vor sich geht. Das was da vor sich geht ist aber gewaltig und stellt die exponierte Stellung des Menschen mas- siv in Frage. Nicht mehr der Mensch ist als allein herausgehobens Wesen wichtig, sondern der Mensch ist Teilhaber an einer kommunikativen Vernetzung, eines kontextuellen Gespräches aller Formen des Lebens, die ihn mindestens soviel gestalten und beeinflussen wie er sie. Unsere Welt- und Wirklich- keitswahrnehmung verändert sich, weg von den Wurzeln des jüdisch-christlichen Interpretierens der Welt hin zu einem kontextuellen Teilhaben an den Ereignissen in denen wir uns bewegen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Vom textuellen zum Kontextuellen Verständnis der Welt"?
Der Text untersucht den Übergang von einem textuellen Verständnis der Welt, geprägt durch die lineare Abfolge von Büchern und Texten seit der Erfindung des Buchdrucks, zu einem kontextuellen Verständnis, das durch die zunehmende Vernetzung und Interaktivität der digitalen Welt geprägt ist. Er thematisiert die Auswirkungen dieser Verschiebung auf verschiedene Bereiche, einschließlich Religion und Technologie.
Welche Rolle spielt die "Technosphäre" in diesem Übergang?
Die Technosphäre wird als die allgegenwärtige technologische Umgebung beschrieben, die unser Denken, unsere Wahrnehmung und unsere Wirklichkeitserfahrung prägt. Der Text argumentiert, dass die zunehmende Komplexität der Technosphäre zu einer Abkehr von linearen, textuellen Strukturen hin zu nicht-linearen, kontextuellen Zusammenhängen führt.
Wer sind Vilém Flusser und Frank Hartmann und warum werden sie im Text erwähnt?
Vilém Flusser war ein Philosoph und Medientheoretiker, dessen Online-Texte und Schriften sich intensiv mit den Auswirkungen neuer Medien auf die Gesellschaft auseinandersetzen. Frank Hartmann ist ein Medien- und Sozialwissenschaftler, dessen Online-Texte ebenfalls im Kontext der Auseinandersetzung mit den neuen Medien relevant sind. Beide Autoren werden als wichtige Bezugspunkte für das Verständnis des Übergangs vom Text zum Kontext genannt.
Welche Auswirkungen hat der Übergang vom Text zum Kontext auf die Religion?
Der Text argumentiert, dass die Religion, insbesondere das Christentum, Schwierigkeiten haben könnte, mit dem Übergang zu einem kontextuellen Verständnis der Welt umzugehen, da sie traditionell ein stark textuell geprägtes Menschenbild und eine lineare Heilsgeschichte vertritt. Die Infragestellung der exponierten Stellung des Menschen in der Welt durch die kontextuelle Realisierung könnte zu einer Krise des religiösen Verständnisses führen.
Was versteht der Text unter "koevolutiven Systemen"?
Koevolutive Systeme sind komplexe Gebilde, in denen verschiedene Teilnehmer interagieren und sich gegenseitig beeinflussen, wobei nicht klar ist, wo ein Teilnehmer anfängt und der andere aufhört. Der Text verwendet den Begriff, um die untrennbare Verbindung zwischen Schrift und Bewusstsein sowie zwischen Technologie und Mensch zu beschreiben.
Was bedeutet der Begriff "Hypertext" in diesem Zusammenhang?
Der Hypertext wird als ein nicht-linearer Text verstanden, in dem die Bedeutung der einzelnen Elemente nicht eindeutig zugeordnet werden kann, sondern durch Wechselwirkungen und Vernetzungen entsteht. Der Text vergleicht die genetische Struktur von Organismen mit einem Hypertext, um die Komplexität und Nicht-Linearität der biologischen Information zu verdeutlichen.
Was ist die Grundaussage bezüglich der genetischen Information und der linearen Textstruktur?
Der Text betont, dass die genetische Information nicht wie ein linearer Text gelesen werden kann. Trotz der Tatsache, dass sie sich als Code darstellen lässt, widerspricht ihre Komplexität und Vernetzung einer einfachen linearen Interpretation. Die Suche nach einem Gen für jede menschliche Eigenschaft wird als problematisch angesehen, da die genetische Struktur eher einem Hypertext ähnelt.
Welche These wird bezüglich der einzelnen Technologien und der Technosphäre aufgestellt?
Es werden zwei Thesen aufgestellt: Erstens, die einzelnen Technologien verändern ihre Strukturen und werden nicht mehr textuell, sondern kontextuell verstanden. Zweitens, die Technologie ergibt als Ganzes eine andere Struktur, die sich nicht mehr textuell verstehen lässt.
Wie beeinflusst die textuelle Struktur die Wahrnehmung von Wirklichkeit?
Die textuelle Struktur hat dazu geführt, dass die westliche Kultur die Welt im Sinne codierter Zeichen versteht, anhand linearer Texte Wirklichkeit in plausible Zusammenhänge gebracht hat. Diese Ordnung prägt das Bewusstsein, so dass alles, was nicht in diese Ordnung passt, entweder nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen wird.
Was ist das Fazit des Textes?
Der Text schlussfolgert, dass sich die Welt- und Wirklichkeitswahrnehmung verändert, weg von den Wurzeln des jüdisch-christlichen Interpretierens der Welt hin zu einem kontextuellen Teilhaben an den Ereignissen, in denen wir uns bewegen. Dies hat tiefgreifende Auswirkungen auf verschiedene Bereiche, einschließlich Technologie und Religion, und erfordert eine Bereitschaft, neue Denkweisen anzunehmen und tradierte Vorstellungen zu hinterfragen.
- Quote paper
- Peter Münch (Author), 2000, Vom Text zum Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99254