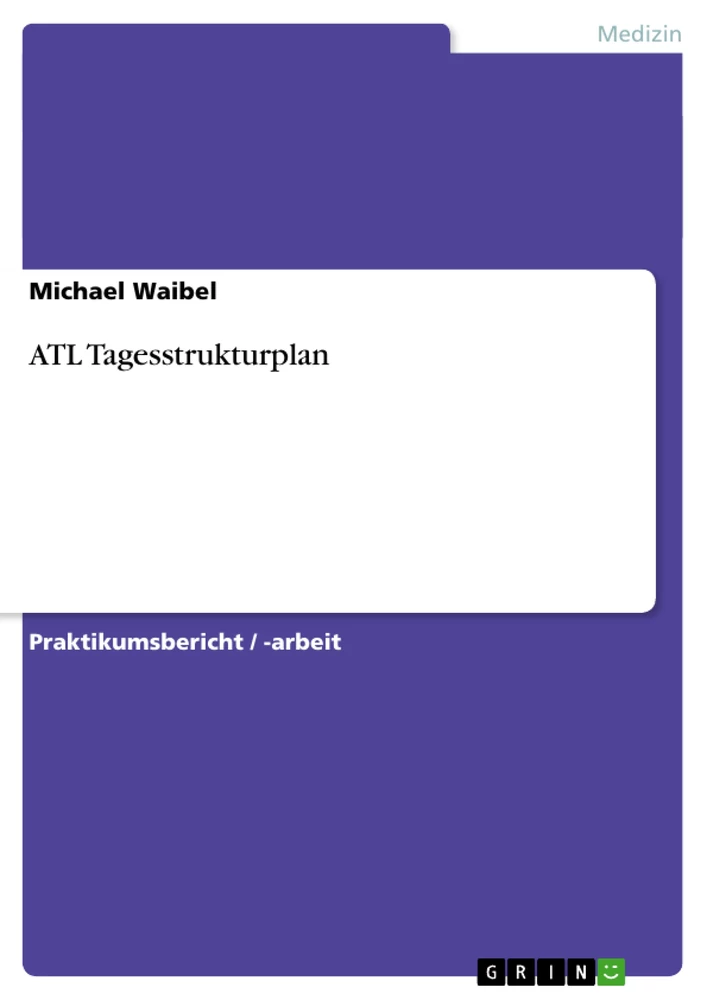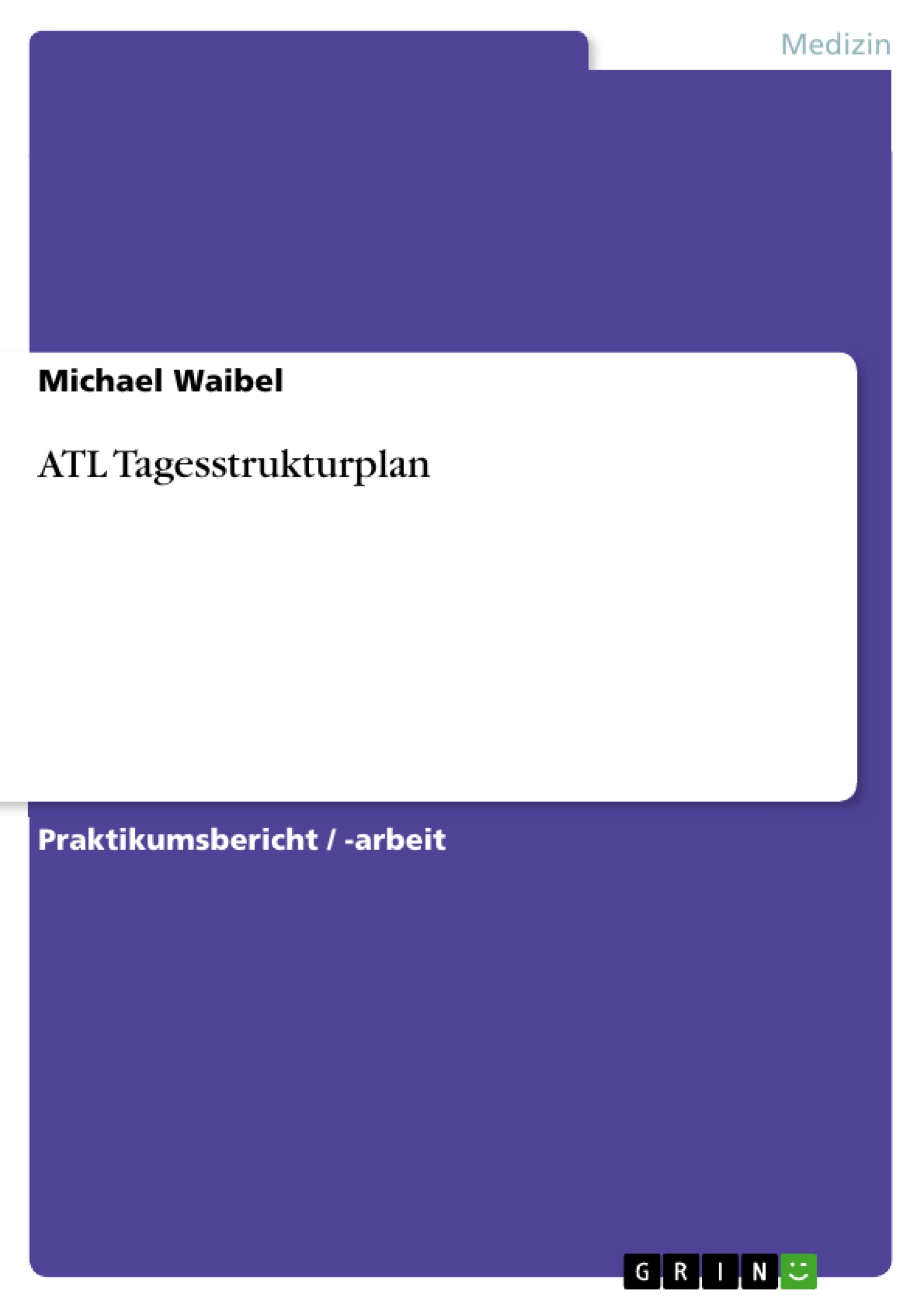In einer Welt, in der die Schatten der psychischen Erkrankung das Licht des Alltags verdunkeln, offenbart sich eine einfühlsame Suche nach Struktur und Sinn. Dieser Bericht beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich bei der Betreuung von Menschen mit kognitiven Einschränkungen ergeben, insbesondere im Kontext einer stationären Behandlung und der bevorstehenden Verlegung in eine betreute Einrichtung. Im Zentrum steht Patient Sch., dessen Rückzug und Orientierungslosigkeit eine individuelle Betreuung erfordern, um ihm Halt und Perspektive zu geben. Die Erstellung eines Tagesstrukturplans wird dabei zum Schlüssel, um dem Patienten eine Orientierungshilfe zu bieten und ihm die Möglichkeit zu geben, seinen Alltag aktiv mitzugestalten. Doch der Weg ist steinig: Unzuverlässigkeit, mangelnde Eigeninitiative und die Schwierigkeit, Termine einzuhalten, stellen das Betreuungsteam vor große Herausforderungen. Kann es gelingen, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und dem Patienten die notwendige Unterstützung zu geben, um seine Selbstständigkeit zu fördern und ihm den Übergang in ein neues Lebensumfeld zu erleichtern? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch die detaillierte Analyse der pflegerischen Maßnahmen, die von der Erhebung der psychiatrischen ATL´s bis hin zur Auswertung und Evaluation der soziotherapeutischen Einzelaktivität reichen. Es ist eine Geschichte von kleinen Schritten, von Rückschlägen und Erfolgen, die letztendlich die Bedeutung von individueller Betreuung, Empathie und der Schaffung einer stabilen Tagesstruktur für Menschen mit psychischen Erkrankungen unterstreicht. Einblicke in die Welt der Psychiatrie, Tagesstrukturierung, Pflegeplanung, Betreuung psychisch Kranker, ATL, Pflege Assessment, Einzelaktivitäten, Soziotherapie, Stationsalltag, Beziehungsaufbau, Kommunikation, kognitive Einschränkungen, Lebensqualität, Selbstständigkeit, Orientierungshilfe, Angehörigenarbeit, Teamarbeit, Herausforderungen in der Pflege, Reflexion in der Pflege, Dokumentation, Evaluation, Therapieplanung, Stationsziele, Patientenrechte, Pflegeethik, Alltagsgestaltung, persönliche Bedürfnisse, psychische Gesundheit, Resilienz, Krankheitsbewältigung, soziale Kompetenzen, Biografiearbeit, Erinnerungsarbeit, Validation, Milieutherapie, Krisenintervention, Deeskalation, Selbstpflege, Angehörigenberatung, Netzwerkarbeit, Nachsorge, Teilhabe, Inklusion, Empowerment, Genesungsorientierung, Recovery, Tagesablauf, Wochenplan, Freizeitgestaltung, soziale Interaktion, kognitives Training, emotionale Unterstützung, praktische Hilfen, Wohnen, Arbeit, soziale Kontakte, finanzielle Sicherheit, persönliche Ziele, Zukunftsperspektiven, Würde, Wertschätzung, Respekt, Akzeptanz, Verständnis, Geduld, Hoffnung, Zuversicht.
1.Einführung:
Anlass für den Bericht ist das lebenspraktische Training ,,Tagesstrukturplan", welchen ich mit Pat.Sch. am erstellt habe.
Patient Sch. befindet sich seit dem in stationärer Behandlung, nachdem er sich zuhause verstärkt zurückgezogen hat, nicht mehr aus dem Zimmer kam, und lautstark gesungen und geschrieen hat. Zudem ist seine Mutter schwer erkrankt, sie wird ihn nach diesem stationären Aufenthalt nicht mehr zuhause aufnehmen können. Pat.Sch. soll nach Memmingen in ein Einrichtung für psychisch erkrankte Menschen kommen. Ein Verlegungstermin ist noch nicht bekannt.
Pat. ist auf Station sehr zurückgezogen, hat keine Tagesstruktur, erscheint nur nach Aufforderung zu den Mahlzeiten. Da ich den Patienten in der Bezugspflege betreue und seit Aufnahme auch kenne, habe ich mit dem Patienten gemeinsam einen Tagesstrukturplan erarbeitet.
2.Pflegeerhebung anhand der psychiatrischen ATL´s
Atmung:
R1: Pat. ist Nichtraucher
P1: -
Regulation der Körpertemperatur:
R1: Pat. kann mitteilen, wenn er Fieber hat
P1: Pat. zieht sich nicht der Jahreszeit entsprechend an
Ernährung:
R1: Nimmt nach Aufforderung an den Mahlzeiten teil
P1: Essenszeiten werden vergessen
R2: Pat. hat früher für sich gekocht
P2: Pat. war lange nicht mehr einkaufen
Ausscheidung:
R1: Pat ist kontinent R2: Pat. trinkt viel
Ruhen und Schlafen:
R1: Pat. schläft ohne Medikamente
P1: Pat. zeitweise bei Nacht nicht orientiert
Sicherheit:
R1: Pat. kann seine Ängste äußern
P1: Pat. fühlt sich auf Station noch sehr unsicher
Körperpflege:
R1: Pat. wäscht sich nach Aufforderung selbst
P1: Pat. versorgt sich nicht eigenmotiviert
Mobilität:
R1: keine körperlichen Einschränkungen
P1: Pat. darf Station nicht alleine verlassen
Informieren und Orientierung:
R1: Kommunikation mit Pat. ist gewährleistet
P1: Pat. findet sich in neuer Umgebung schwer zurecht
Kommunikation:
R1: Kommunikation ist gewährleistet
P1: Pat. unkonzentriert, hört oft nicht zu
Stimmungen wahrnehmen und leben:
R1: Pat. kann seine Stimmungen zeigen und äußern
P1: Pat. nimmt wenig Rücksicht auf seine Umwelt
Verantwortungsfähigkeit:
R1: Pat. kann über kleinere Geldbeträge selbst verwalten
P1: Pat. mit der Übernahme von Verantwortung überfordert
Sinn finden:
R1: Pat. fühlt sich zuhause sehr wohl
P1: Pat. kann weitere Lebensplanung nicht überschauen
Sinnvolle Zeitgestaltung:
R1: Pat. hört gerne Radio, geht gerne spazieren
P1: Pat. lebt strukturlos, zieht sich viel ins Zimmer zurück
Arbeit:
R1: Pat. hat früher in einer Fabrik gearbeitet
P1: Pat. hat wenig Ausdauer, ist kognitiv sehr eingeschränkt
Persönlichen Besitz verwalten und finanzielle Sicherheit:
R1: Pat. hat Betreuung
R2: Pat. kann kleinere Geldbeträge selber verwalten
Wohnen:
R1: lebt im eigenen Zimmer im Haus der Mutter
P1: Pat. kann nicht mehr nach Hause zurück, Weiterversorgung ist eingeleitet
Sich als Mann/Frau/Kind/Jugendlicher fühlen und verhalten:
R1:Pat. verhält sich adäquat
P1: -
Rechte wahrnehmen und Pflichten erfüllen:
R1: Pat. hat gutes Verhältnis mit Betreuerin
R2: Pat. kann kleinere Aufgaben auf Station übernehmen
P1: Pat. kann komplexere Zusammenhänge nicht verstehen
Sterben:
R1: nicht suizidal
3. Pflegediagnose
Pat. Sch. ist seit langer Zeit krank, er hat große Defizite im kognitiven Bereich. Viele lebenspraktische Dinge, auch einfache Tätigkeiten, kann er nicht von alleine übernehmen. Seine sozialen Kontakte beschränken sich auf die Mutter und seine in Memmingen lebende Schwester. Da die Mutter schwer erkrankt ist, soll der Pat. nach Entlassung in eine andere Einrichtung verlegt werden.
Durch die Überfürsorge der Mutter hat der Pat. praktisch nie etwas alleine unternommen, bzw. seinen Tag versucht zu strukturieren. Auf Station fällt ihm die Teilnahme an den Therapien und Gruppen sehr schwer, er erscheint nicht von alleine, und kann die Gruppen nicht durchhalten.
Vorbereitung und Planung einer soziotherapeutischen Einzel-oder Gruppenaktivität:
1.Ziel:
1.1. Begründung für die Maßnahme lt. Stationsziel/Handbuch
1.2. Was soll den PatientInnen vermittelt werden
Dem Patienten soll anhand eines Tagesstrukturplanes eine Orientierungshilfe für den Stationsablauf gegeben werden. Der Tagesstrukturplan soll jede Woche um ein oder zwei Punkte erweitert werden. Eine Überforderung des Patienten soll vermieden werden. Der Patient soll den Plan als Hilfe verstehen, er soll auch Interesse an der Gestaltung seiner freien Zeit wecken.
1.3 . Die PatientInnen sollen:
1.3.1. kognitiv
Der Patient soll den Plan inhaltlich verstehen, er soll mit seinen eigenen Worten geschrieben sein. Die Ausführungen auf dem Plan sollen nicht zu komplex sein, damit der Patient sie auch versteht.
1.3.2. affektiv
Der Patient soll nicht überfordert werden.
1.3.3. sozial-kommunikativ
Der Patient soll seine eigenen Bedürfnisse äußern können. Er soll den Tagesstrukturplan mitgestalten
1.3.4. psychomotorisch
Die Erstellung des Planes soll nicht zu lange dauern, da der Patient schnell unruhig wird. Er soll die Möglichkeit erhalten, die Aktivität zu unterbrechen und zu einem anderen Zeitpunkt durchzuführen.
2.Zielgruppe
2.1. Wer soll angesprochen werden
Patient Sch.
2.2. Teilnahmekriterien
keine
2.3. Teilnahmeausschluss
keine
2.4. Gruppengröße
1 Patient, 1 Pflegekraft
3. Planung
3.1. Zeitpunkt
., mit Patient wird 16.00 Uhr vereinbart
3.2. Dauer
ca. eine halbe Stunde
3.3. Ort
Fernsehraum der Station
3.4. Personalbedarf
1 Pflegekraft
3.5. Material
Kugelschreiber und Papier
3.6. Finanzierung
-
3.7. Vorgehen/Methode
Es handelt sich um eine aktivierend-fördernde Einzelaktivität.
4.Programmablauf / Maßnahmen
fiktiver Ablauf
- Absprache im Team über Zeitpunkt, Ort der Aktivität
- Absprache im Team über Inhalt des Tagesstrukturplanes
- Information des Patienten über geplante Aktivität
- Vereinbarung von Zeitpunkt und Ort
- Patient am Mittag noch einmal daran erinnern
- Angenehme Atmosphäre schaffen
5. Mögliche Probleme & Alternativen
5.1. mögliche Probleme
a) Patienten geht es an diesem Tag nicht gut.
b) Patient kann die Aktivität nicht durchhalten
c) Patient erkennt den Sinn der Aktivität nicht
5.2. Alternativen
a) Aktivität verschieben, evtl. Spaziergang anbieten
b) Aktivität kurz und einfach durchführen, Pat. nicht zum durchhalten drängen
c) Pat. Sinn der Aktivität genau erklären, nachfragen lassen, evtl. mit eigenen Worten noch mal erzählen lassen.
6. Auswertung
Der Patient erschien nicht zu dem vereinbarten Termin, er hatte Besuch von seiner Schwester bekommen, und war mit ihr ins Cafe gegangen. Nach seiner Rückkehr vereinbarten wir einen neuen Termin für 18.00Uhr. Zu diesem Termin erschien der Patient ebenfalls nicht, er wollte sein Zimmer nicht verlassen, da er das "nicht dürfe". Er war aber damit einverstanden, dass ich bei ihm im Zimmer bleibe. Dem Patient wurde nochmals erklärt, um was es geht, dass der Plan anschließend im Zimmer aufgehängt wird, und dass er jederzeit nachfragen darf. Der Patient erzählte von zu Hause, was er da den ganzen Tag gemacht hat. So konnte er auch Punkte benennen, die mit in den Plan sollen. Dem Patienten wurde erklärt, dass der Plan jede Woche zusammen mit der Pflegeperson neu geschrieben und aktualisiert wird. Der Patient war die meiste Zeit fröhlich, fand die Idee eines Planes gut.
6.1. in der Gruppe
- Blitzlicht
- Feed-back
Der Patient wurde für seine Mitarbeit gelobt. Die Erstellung des Planes im Zimmer verlief störungsfrei und ohne Unterbrechung. Der Patient selber schien die Aufmerksamkeit zu genießen.
6.2. Reflexion mit Kolleginnen (Co-)
Im Team wird der Patient als unruhig, unzuverlässig und zurückgezogen empfunden. Die meisten Kollegen sind sich aber sicher, dass ein Tagesplan dem Patienten Struktur geben kann.
6.3. Bericht im Team
Der Tagesstrukturplan wurde im Team am darauffolgenden Tag vorgestellt, und besprochen. Es wurde ausgemacht, dass auch in meiner Abwesenheit der Plan regelmäßig einmal die Woche aktualisiert wird.
6.4. Dokumentation (analog1.3.)
Da der Patient zum großen Teil selbst mitgearbeitet hat, kann er kognitiv den Punkten auf dem Plan folgen.
Affektiv: Durch die Überschaubarkeit des Tagesplanes fand bei dem Patienten keine Überforderung statt.
Sozial-Kommunikativ: Der Pat. konnte, nach dem er überraschend Besuch bekommen hatte, mir nicht mitteilen, dass er den Termin verlegen möchte.
Psychomotorisch konnte der Pat. gut durchhalten.
7. Evaluation
Ein großes Ziel dieser Aktivität ist schon die Bereitschaft des Patienten, gemeinsam einen solchen Plan zu erarbeiten. Da ich mit dem Patienten seit10 Tagen in der Bezugspflege arbeite, war es mir in dieser Zeit möglich einen guten Kontakt und eine Beziehung zu ihm herzustellen.
Auch die Einhalten des Tagesplanes wird nur über den Aufbau einer Beziehung zum Patienten möglich sein.
8.Zusammenfassung/Resümee
Wichtig ist, dass der Tagesstrukturplan für den Patienten, ähnlich eines Stundenplanes, bindend ist, da er sonst für den Patienten schnell an Bedeutung verliert.
Das tägliche Besprechen des Planes ist sehr wichtig, ebenso die wöchentliche Aktualisierung. Sollte der Patient gut mit dem Plan zurechtkommen, so kann sicher an die Erstellung eines Wochenplanes gedacht werden.
Tagesstrukturplan
6.30 Uhr Wecken
7.00 Uhr Waschen und Anziehen
7.30 Uhr Frühstück im Speisesaal, anschl. Medikamente nehmen
8.00 Uhr Besprechung des Tagesplanes mit Bezugsperson im Zimmer
9.00 Uhr Visite im Fernsehraum
10.00 Uhr Ergotherapie im Speisesaal
11.30 Uhr Mittagessen
12.00 Uhr Medikamente einnehmen
12.30-13.30 Uhr Mittagspause
13.30 Uhr Überlegen einer Aktivität für den Nachmittag
14.00 Uhr Besprechen mit der Bezugsperson 1 Aktivität für den Nachmittag (wann + was?)
15.00 Uhr Nachmittagsaktivität
17.30 Uhr Abendessen
18.00 Uhr Medikamente einnehmen
19.00 Uhr Medikamente richten im Stationszimmer
20.00 Uhr Nachrichten schauen im Fernsehen
21.30 Uhr Nachtmedikamente einnehmen
21.45 Uhr Wecker stellen auf 6.30 Uhr!
22.00 Uhr Umziehen für die Nacht, Nachtruhe
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Anlass für diesen Bericht?
Der Bericht wurde aufgrund des lebenspraktischen Trainings "Tagesstrukturplan" erstellt, welches mit Patient Sch. durchgeführt wurde.
Seit wann befindet sich Patient Sch. in stationärer Behandlung?
Patient Sch. befindet sich seit dem Zeitpunkt der Erstellung des Tagesstrukturplans in stationärer Behandlung.
Warum ist Patient Sch. in stationärer Behandlung?
Patient Sch. zog sich zuhause verstärkt zurück, verließ sein Zimmer nicht mehr und war lautstark. Zudem ist seine Mutter schwer erkrankt und kann ihn nicht mehr zuhause aufnehmen.
Wohin soll Patient Sch. nach dem stationären Aufenthalt verlegt werden?
Patient Sch. soll nach Memmingen in eine Einrichtung für psychisch erkrankte Menschen verlegt werden.
Wie verhält sich Patient Sch. auf der Station?
Patient Sch. ist auf der Station sehr zurückgezogen, hat keine Tagesstruktur und erscheint nur nach Aufforderung zu den Mahlzeiten.
Was ist das Ziel des Tagesstrukturplans?
Das Ziel ist, dem Patienten eine Orientierungshilfe für den Stationsablauf zu geben und Interesse an der Gestaltung seiner freien Zeit zu wecken.
Wie soll der Tagesstrukturplan aufgebaut sein?
Der Tagesstrukturplan soll jede Woche um ein oder zwei Punkte erweitert werden, um eine Überforderung des Patienten zu vermeiden. Er soll in seinen eigenen Worten geschrieben sein und nicht zu komplexe Ausführungen enthalten.
Welche ATL-Bereiche werden in der Pflegeerhebung betrachtet?
Die Pflegeerhebung umfasst die psychiatrischen ATL's (Aktivitäten des täglichen Lebens) wie Atmung, Regulation der Körpertemperatur, Ernährung, Ausscheidung, Ruhen und Schlafen, Sicherheit, Körperpflege, Mobilität, Information und Orientierung, Kommunikation, Stimmungen wahrnehmen und leben, Verantwortungsfähigkeit, Sinn finden, Sinnvolle Zeitgestaltung, Arbeit, Persönlichen Besitz verwalten und finanzielle Sicherheit, Wohnen, Sich als Mann/Frau/Kind/Jugendlicher fühlen und verhalten, Rechte wahrnehmen und Pflichten erfüllen, und Sterben.
Welche Pflegediagnose wird für Patient Sch. gestellt?
Patient Sch. hat aufgrund seiner langen Krankheit große Defizite im kognitiven Bereich und kann viele lebenspraktische Dinge nicht von alleine übernehmen.
Welche Ziele werden bei der Planung einer soziotherapeutischen Einzelaktivität verfolgt?
Es sollen kognitive (Verständnis des Plans), affektive (Vermeidung von Überforderung), sozial-kommunikative (Äußerung eigener Bedürfnisse, Mitgestaltung) und psychomotorische (nicht zu lange Dauer, Möglichkeit zur Unterbrechung) Ziele erreicht werden.
Welche potenziellen Probleme könnten bei der Durchführung des Tagesstrukturplans auftreten?
Mögliche Probleme sind, dass es dem Patienten an diesem Tag nicht gut geht, er die Aktivität nicht durchhalten kann oder den Sinn der Aktivität nicht erkennt.
Wie wurde der Tagesstrukturplan letztendlich umgesetzt?
Der Patient hatte Besuch und konnte den vereinbarten Termin nicht wahrnehmen. Ein neuer Termin wurde vereinbart, aber der Patient wollte sein Zimmer nicht verlassen. Die Erstellung des Plans erfolgte dann im Zimmer des Patienten.
Was ist für die Zukunft des Tagesstrukturplans geplant?
Der Tagesstrukturplan soll regelmäßig besprochen und wöchentlich aktualisiert werden. Bei guter Akzeptanz kann an die Erstellung eines Wochenplanes gedacht werden.
- Quote paper
- Michael Waibel (Author), 2000, ATL Tagesstrukturplan, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99208