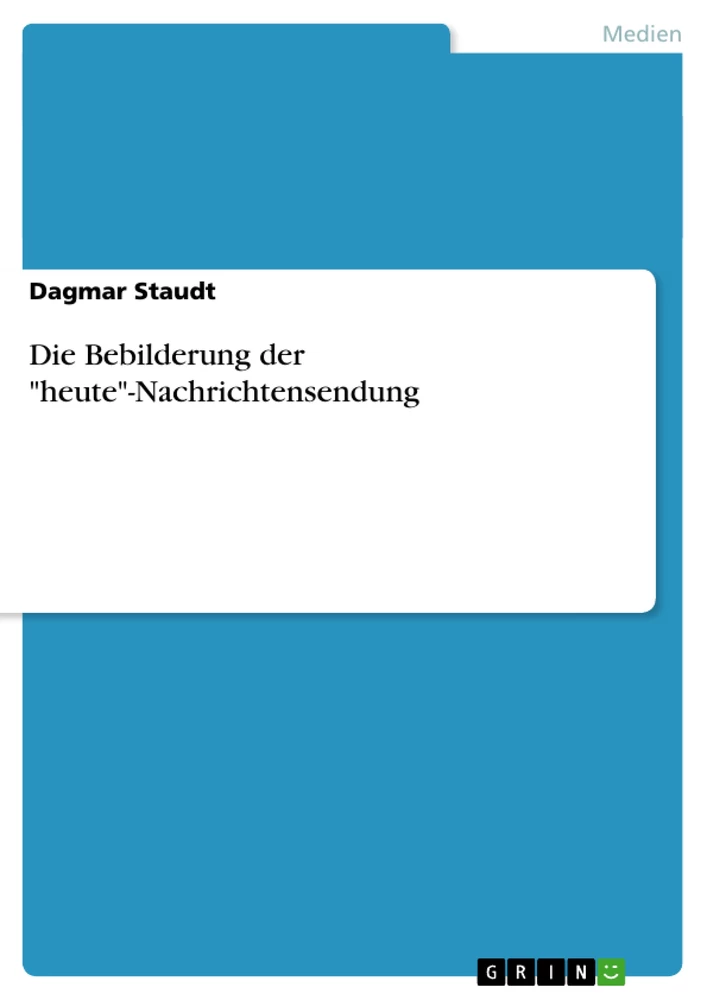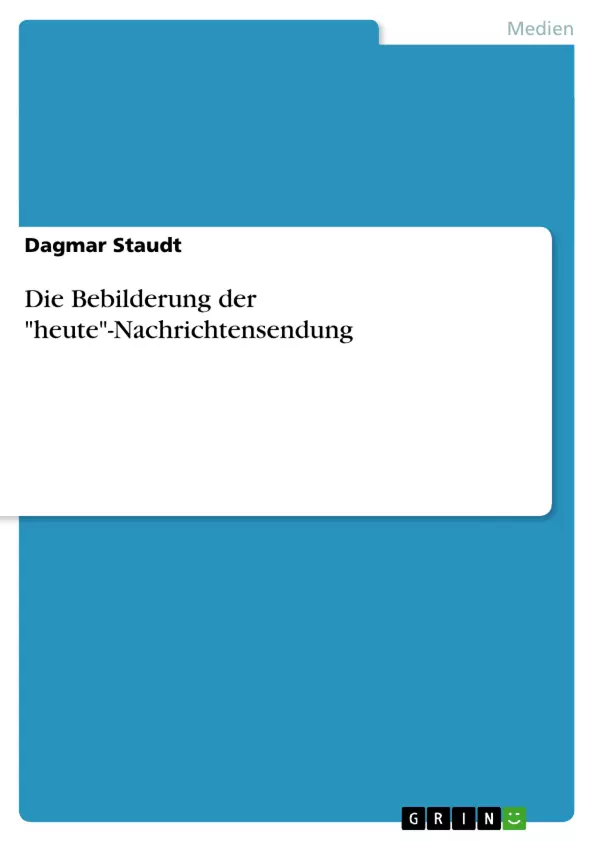Vorwort
Das Fernsehen ist einerseits in seiner Eigenschaft als Massenmedium, andererseits wegen seiner unterschiedlichen Ausdrucksformen (verbale Aussagen in Ton und Schrift, Stand- und bewegte Bilder) Gegenstand einer Reihe von Untersuchungen. Wie jedoch Nachrichten und insbesondere deren Bebilderung zustande kommen, darüber finden sich bisher wenige Aussagen. Jürgen Wilke und Roman Beuler gehen diesem Phänomen näher auf den Grund in ihrem Aufsatz "Produktion von Fernsehnachrichten - Eine Untersuchung der Bebilderung der "heute"-Nachrichtensendung des ZDF".
Zur Beachtung: Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen in diesem Aufsatz Standbilder, Grafiken und Logos, nicht bewegte Bilder in Form von Nachrichtenfilmen.
Struktur und Arbeitsweisen der "heute"-Redaktion
Bevor die Ablaufkonferenz die Anordnung der einzelnen Elemente der "heute"-Sendung festlegen und der Redaktionsleiter das fertige Produkt absegnen bzw. redigieren kann, sind eine Reihe von Instanzen in den Produktionsprozeß involviert:
Der Schlußredakteur
Der Schlußredakteur ist verantwortlich für das Gesamtbild der Sendung. Einerseits unterliegt ihm die inhaltliche Verantwortung. Er überprüft die Richtigkeit und Stimmigkeit der Inhalte und redigiert im Zweifelsfall. Andererseits koordiniert er den technischen Ablauf der Sendung und organisiert ihn im Falle von Schwierigkeiten um.
Der Redakteur im Studio
Die Nachrichten der "heute"-Sendung werden nicht wie in der ARD-"Tagesschau" von einem Sprecher verlesen, sondern vom Redakteur im Studio präsentiert. Dieser schreibt neben der Wortschicht einen Teil der Meldungen selbst.
Die Wortschicht
Die Wortschicht erstellt den Großteil der Wortbeiträge. Als Quelle dienen dabei primär die Meldungen der Nachrichtenagenturen. Redigiert werden diese Beiträge vom Wortschichtleiter und in zweiter und letzter Instanz vom Schlußredakteur.
Die Filmschicht
Die Mitarbeiter der Filmschicht erfüllen drei unterschiedliche Aufgaben. Sie produzieren Standbilder aus aktuellem oder Archivmaterial oder stellen Filmbeiträge mit unterlegtem Nachrichtentext her. Desweiteren verfassen sie O-Ton-Blätter für fertige Filmbeiträge mit Textanfang und -ende, Tonquelle etc.
Die Bildredaktion
In der Bildredaktion arbeiten neun Bildredakteure und acht Assistenten. Im Regelfall betreut ein Redakteur allein eine Sendung und übernimmt für die Bebilderung die Verantwortung. Im folgenden wird der genaue Arbeitsablauf der Bebilderung einer Sendung genauer beschrieben:
Der Arbeitsablauf in der Bildredaktion
Konferenzen
Die wichtigste Konferenz ist die Ablaufkonferenz für die jeweils vorzubereitende Sendung. Neben dem Ablauf wird dort die Nachrichtenpräsentation (wird eine Meldung nur im Wort gebracht oder zusätzlich bebildert?) und die genaue optische Umsetzung der Nachricht diskutiert und festgelegt. Je aufwendiger die vorzubereitende Sendung ist, um so größer ist die Zeitspanne zwischen Konferenz und Sendebeginn. Im Zweifelsfall wird eine zweite aktualisierende Konferenz abgehalten.
Einlesen
Da der verantwortliche Bildredakteur die Verantwortung für die Bebilderung übernimmt, ist ein Überblick seinerseits über die Gesamtnachrichtenlage unerläßlich. Dementsprechend beginnt seine Arbeitsschicht mit dem sogenannten "Einlesen". Diese Tätigkeit umfaßt neben dem reinen Lesen auch das Selektieren und Sortieren der Nachrichten. Die so vorselektierten Meldungen werden dann an die nachfolgenden Redakteure zum Einlesen weitergegeben. Der Bildredakteur übernimmt somit eine Schlüsselstellung bei der Nachrichtenselektion.
Recherche
Für seine Tätigkeit benötigt der Bildredakteur über die Agenturmeldungen hinausgehendes Wissen, um einen der Wortmeldung entsprechenden Bildhintergrund zu erstellen. Um sich diese zu verschaffen, muß der Bildredakteur Recherche betreiben. Dazu stehen ihm verschiedene Quellen zur Verfügung. Diese sind: Datenbanken (Agenturmeldungen, geographische und biographische Informationen), Atlanten, Lexika sowie Bibliothek und Pressearchiv des ZDF.
Bildliste
Entsprechend des in der Ablaufkonferenz festgelegten Ablaufes der Sendung erstellt der Bildredakteur eine Auflistung aller enthaltenen optischen Elemente. Somit lassen sich einzelne Bilder bestimmten Wortmeldungen zuordnen und die Senderegie erhält Informationen über den Zeitpunkt der Einspielung des Bildmaterials.
Bildauswahl
In diesem Arbeitsschritt findet der eigentliche Selektionsprozeß für die Bebilderung einer Sendung statt.
Die Vorauswahl wird meist durch einen Mitarbeiter des Bildarchivs oder einen Bildassistenten unter genauer Vorgabe von Form und Inhalt seitens des Bildredakteurs statt. Unter Umständen erfolgen mehrere Vorauswahlprozesse. Bei von der Paintbox angefertigten Bildern gibt der Bildredakteur ebenfalls genaue Anweisungen bezüglich Anordnung der Elemente und Farbgebung. Diese Tätigkeit wird aber auch teilweise von einem Grafiker übernommen, der zuvor den Sachverhalt geschildert bekommt.
Das letzte Wort in der Auswahl von Fotos und Standbildern hat aber immer der verantwortliche Bildredakteur.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von allgemeinen Regeln, die die Bildauswahl beeinflussen. Diese Regeln beziehen sich einerseits auf die Form, andererseits auf den Inhalt von Bildern.
Alle wesentlichen Elemente des Bildes, also alle Schriften, Orte, Logos, Personen etc., müssen für den Zuschauer erkennbar sein. Sie dürfen von dem davor plazierten Sprecher nicht verdeckt werden. Desweiteren muß dem Zuschauer eine angemessenen Zeit zur Wahrnehmung des Bildes zur Verfügung stehen. Die Menge visueller Informationen ist deswegen von der Länge der Meldung abhängig.
Bevorzugt werden emotionslose Bilder, da Personen nicht positiv oder negativ verzerrt dargestellt werden sollen. Eine Ausnahme kann hier die Darstellung von Sportlern sein, die je nach Sieg oder Niederlage mit fröhlichem oder traurigem Gesichtsausdruck gezeigt werden.
Personen sind in der Regel im Portrait zu sehen (Gesicht in Vorderansicht bis unterhalb des Halsansatzes).
Aufeinanderfolgende Bilder dürfen sich nicht ähneln. So wird beispielsweise vermieden, mehrere Nachrichten hintereinander mit Karten zu illustrieren. Desweiteren darf die Bebilderung nicht mehr Information enthalten als der Meldungstext und für visualisierte Personen und Orte gilt, daß sie auch durch den Sprecher erwähnt werden.
Shotliste
Die Shotliste enthält alle wesentlichen Regieanweisungen: Filmbeiträge und deren Quellen, Kameraeinstellungen sowie die Reihenfolge der Illustrationen und ihre Position. Sie wird von dem verantwortlichen Bildredakteur gemeinsam mit dem Mitarbeiter, der den Elektronischen Standbild-Speicher (ESS) bedient, entworfen. Sie stellt im folgenden die Arbeitsgrundlage insbesondere der Regie- und ESS- Mitarbeitern, sowie des Bildredakteurs dar.
Beschriftung
Neben der Bebilderung ist der Bildredakteur auch für die korrekte Beschriftung von Filmbeiträgen verantwortlich, sofern diese von der Redaktion und nicht schon vom Autor des jeweiligen Berichts erstellt wurde. Bei diesen Beschriftungen handelt es sich primär um Orts- oder Personennamen mit Funktionsbezeichnung. Sie werden mittels des Schriftgenerators in die laufende Sendung eingeblendet.
Kontrolle
Kurz vor Beginn der Sendung kontrolliert der Bildredakteur in Zusammenarbeit mit einem weiteren Redakteur und einem Assistenten die einzelnen Elemente des Elektronischen Standbild-Speichers (ESS) und des Schriftgenerators. Anhand der Shotliste werden alle Elemente auf richtigen Zusammenbau und Reihenfolge überprüft.
Während der laufenden Sendung ist der Bildredakteur anwesend, um auf Vorschaumonitoren zu beobachten, ob die der nächsten Meldung entsprechenden Elemente vorliegen und nimmt im Zweifelsfall kurzfristig Korrekturen vor.
Bildquellen
Die Bebilderung einer Sendung ist nicht natürlich nicht nur von dem Selektionsprozeß in der Bildredaktion abhängig. Vielmehr ist zu betrachten, woher das Rohmaterial eigentlich stammt. Folgende Quellen sind in diesem Beispiel zu unterscheiden: ZDF-spezifische und externe Quellen; darüber hinaus aktuelles und archiviertes Bildmaterial und zu guter letzt Quellen für Film-, Foto- oder grafisches Material.
Paintbox
Mit der Paintbox können einerseits eigenständig Bilder hergestellt werden, andererseits kann damit aber auch bereits bestehendes Bildmaterial bearbeitet werden. Mittels eines elektronischen Griffels kann ein Grafiker auf digitaler Basis vergrößern, verkleinern, farblich verändern etc. Die Paintbox dient hauptsächlich der Erstellung geographischer Karten, Logos und der Bearbeitung von Fotos und Standbildern.
Bilderdienste
Aktuelle Nachrichtenfotos bezieht die Redaktion von den Bilderdiensten der Agenturen dpa und AP- Darüber hinaus besteht aber auch Zugriff auf den Archivbestand der Agenturen. Sofern es sich bei der entsprechenden Thematik um kontinuierliche Berichterstattung handelt, besteht die Möglichkeit, die Bilder direkt in der Bildredaktion der "heute"-Sendung zu sammeln.
Bildarchiv
Das Bildarchiv ist die am häufigsten genutzte Bildquelle der "heute"-Sendung. Neben Fotos werden hier auch Logos archiviert. Gespeist wird es aus den Bilderdiensten der Agenturen, Pressestellen sowie Pressefotografen. Die Bildredaktion besitzt einen Teil des Archivs in sog. "Dauerleihe". Es handelt sich hierbei um Doubletten vielgenutzter Fotos (z.B. Portrait des Bundeskanzlers), um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen.
Nachrichtenfilme
Die "heute"-Redaktion nutzt die Möglichkeit aus Nachrichtenfilmen Standbilder zu produzieren. Diese Nachrichtenfilme werden aus zwei Quellen bezogen: eigenes Korrespondentenmaterial sowie über Nachrichtenaustausch der European Broadcasting Union (EBU). Diese bitet nicht nur Material der beteiligten Senmder, sondern auch Produkte von Reuters Television und World Television News (WTN).
Filmarchiv
Ebenso wie aus aktuellen Nachrichtenfilmen werden aus archivierten Filmen Standbilder produziert.
Pressearchiv und Bibliothek
Auch Pressearchiv und Bibliothek werden als Bildquelle genutzt. Ein Auffinden passender der Bilder gestaltet sich hier jedoch schwierig, da die Medien nicht nach den in Ihnen enthaltenen Bildern katalogisiert sind. Darüber hinaus sind die Veröffentlichungsrechte oftmals nicht bekannt und verlangen nach einer zeitaufwendigen Recherche.
Die Struktur des Bildangebots
Um die Struktur des Bildangebots der "heute"-Sendung darzustellen, wurde im Zeitraum zwischen 1992 und 1997 146 repräsentativ ausgewählte Sendungen genauer untersucht.
Insgesamt zeigte sich, daß das Ressort "Politik" mit 46% der gezeigten Bilder die Spitzenstellung übernimmt. Dabei entfielen 26% auf internationale und 20% auf nationale Themen. Der Sport nimmt 16% ein und ca. 20% der Bilder waren keinem spezifischen Thema zuzuordnen. Diese fanden primär Verwendung in Begrüßungs- oder Abschiedssequenzen, bzw. dienten der Untermalung von Überleitungen oder weitergehenden Programmhinweisen.
Im Beobachtungszeitraum war bezüglich der Bebilderung langfristig ein Rückgang der politischen Inhalte zu verzeichnen. Sport und Kriminalität hingegen erfreute sich wachsender Beliebtheit.
Allgemein läßt sich feststellen, daß die Verwendung bebilderter Nachrichten rückläufig ist. Wurden im Zeitraum zwischen 1992 und 1993 noch 523 Nachrichten bebildert, so waren es im zwischen 1996 und 1997 nur noch 428. Gleichzeitig ist die Anzahl von Filmnachrichten gestiegen, was für eine Dynamisierung der
Informationsvermittlung spricht.
In den verschiedenen Ressort sind verschiedene Schwerpunkte im Hinblick auf die Art der Bebilderung festzustellen. Portraits finden am häufigsten beim Sport, seltener hingegen bei Wirtschaftsthemen oder Unglücken Verwendung. Sie sind häufiger bei nationaler denn bei internationaler Politik zu finden. Durch ein Portrait wird die Nachricht personalisiert, das "Wer" tritt in den Vordergrund. Anders hingegen bei Unglücken, Kultur, Kriminalität, Wirtschaft und Buntes. Hier wird häufig mit Szenenbildern agiert, wodurch das "Was" der Nachricht illustriert wird. Das "Wo" wird mittels geographischer Karten insbesondere in Berichten mit der Thematik Politik und Unglücke dargestellt. Logos sind primär bei Wirtschafts- und Sportmeldungen anzutreffen. Deutlich zugenommen hat im Laufe der fünf betrachteten Jahre die Nutzung von Mischformen (z.B. Portrait des Parteivorsitzenden mit dem Logo seiner Partei). Die Verwendung geographischer Karten hingegen wird zunehmend seltener.
Im folgenden eine Auflistung der am häufigsten gezeigten Handlungsträgern im Betrachtungszeitraum (Tab. I). Dabei ist zu beachten, daß in der Stichprobenauswahl nur etwa jede 15. Sendung berücksichtigt wurde und die Zahlen deshalb mit dem entsprechenden Faktor multipliziert werden müßten, um annähernd korrekte absolute Zahlen zu erhalten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. I: Die am häufigsten gezeigten Handlungsträger
In Tab. I spiegeln sich die Nachrichtenschwerpunkte im Untersuchungszeitraum wider: International die Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, in Rußland und im Nahen Osten; innenpolitisch die Themen Asylbewerber, Einsätze der Bundeswehr, die wirtschaftliche Situation in Deutschland.
Desweiteren wurde untersucht, inwieweit negative Nachrichten über Konflikte und Schäden in den bebilderten Nachrichten zu finden sind. Als negativ wurden rund 20% der gesamten Nachrichten eingestuft. Lediglich in 25% dieser Fälle wurde die Bebilderung als negativ eingestuft, zu 75% hingegen der verbale Zusatz. Der Grund hierfür ist primär in der neutralen Bebilderung mittels geographischer Karten in Konfliktfällen zu sehen. Im Verlauf der fünf Jahre ließ sich allerdings eine Zunahme negativ bewertender Nachrichtenfilme ausmachen. Dies ist im Zusammenhang damit zu sehen, daß überhaupt ein Anstieg negativer Meldungen in der "heute"- Sendung festgestellt wurde. Waren 1992/93 noch 19% der Nachrichten negativ bewertet worden, so waren es 1996/97 schon 35%.
Quelle:
Jürgen Wilke (Hrsg.) "Nachrichtenproduktion im Mediensystem: von den Sport- und Bilderdiensten bis zum Internet" - Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag 1998
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes "Produktion von Fernsehnachrichten - Eine Untersuchung der Bebilderung der "heute"-Nachrichtensendung des ZDF"?
Der Text analysiert, wie Standbilder, Grafiken und Logos in der "heute"-Nachrichtensendung des ZDF produziert und eingesetzt werden. Es werden die Struktur und Arbeitsweisen der Redaktion, insbesondere der Bildredaktion, sowie die verschiedenen Bildquellen und Selektionsprozesse beleuchtet.
Welche Rolle spielt der Schlussredakteur bei der Produktion der "heute"-Sendung?
Der Schlussredakteur ist für das Gesamtbild der Sendung verantwortlich. Er überprüft die Richtigkeit und Stimmigkeit der Inhalte, redigiert diese und koordiniert den technischen Ablauf der Sendung.
Wie ist der Arbeitsablauf in der Bildredaktion der "heute"-Sendung?
Der Arbeitsablauf umfasst Konferenzen (vor allem die Ablaufkonferenz), das Einlesen der Nachrichten, die Recherche nach passendem Bildmaterial, die Erstellung einer Bildliste, die Bildauswahl, die Erstellung einer Shotliste und die Beschriftung der Filmbeiträge. Abschließend erfolgt eine Kontrolle aller Elemente.
Welche Quellen nutzt die Bildredaktion für die Bebilderung der "heute"-Sendung?
Die Bildredaktion greift auf verschiedene Quellen zurück, darunter ZDF-spezifische und externe Quellen, aktuelles und archiviertes Bildmaterial sowie Quellen für Film-, Foto- oder grafisches Material. Konkret werden die Paintbox, Bilderdienste (dpa, AP), das Bildarchiv, Nachrichtenfilme (eigenes Korrespondentenmaterial, EBU), das Filmarchiv, das Pressearchiv und die Bibliothek genutzt.
Welche Rolle spielt die Paintbox bei der Bebilderung der "heute"-Sendung?
Mit der Paintbox können Bilder eigenständig hergestellt oder bereits bestehendes Bildmaterial bearbeitet werden. Sie dient hauptsächlich der Erstellung geographischer Karten, Logos und der Bearbeitung von Fotos und Standbildern.
Wie hat sich die Struktur des Bildangebots der "heute"-Sendung zwischen 1992 und 1997 verändert?
Im Beobachtungszeitraum war langfristig ein Rückgang der politischen Inhalte in der Bebilderung zu verzeichnen. Sport und Kriminalität hingegen erfreuten sich wachsender Beliebtheit. Die Verwendung bebilderter Nachrichten insgesamt war rückläufig, während die Anzahl von Filmnachrichten stieg.
Welche Art von Bildern wird in der "heute"-Sendung bevorzugt für verschiedene Themenbereiche eingesetzt?
Portraits werden am häufigsten beim Sport eingesetzt, Szenenbilder bei Unglücken, Kultur, Kriminalität, Wirtschaft und Buntes. Geographische Karten werden insbesondere in Berichten mit der Thematik Politik und Unglücke dargestellt. Logos sind primär bei Wirtschafts- und Sportmeldungen anzutreffen.
Inwieweit sind negative Nachrichten in der "heute"-Sendung bebildert?
Rund 20% der gesamten Nachrichten wurden als negativ eingestuft. Lediglich in 25% dieser Fälle wurde die Bebilderung als negativ eingestuft, zu 75% hingegen der verbale Zusatz. Im Verlauf der fünf Jahre ließ sich allerdings eine Zunahme negativ bewertender Nachrichtenfilme ausmachen.
Wo kann man den vollständigen Text finden?
Der vollständige Text ist in dem Buch "Nachrichtenproduktion im Mediensystem: von den Sport- und Bilderdiensten bis zum Internet" von Jürgen Wilke (Hrsg.), Böhlau Verlag 1998 (ISBN 3-412-12397-8) enthalten.
- Arbeit zitieren
- Dagmar Staudt (Autor:in), 2000, Die Bebilderung der "heute"-Nachrichtensendung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99158