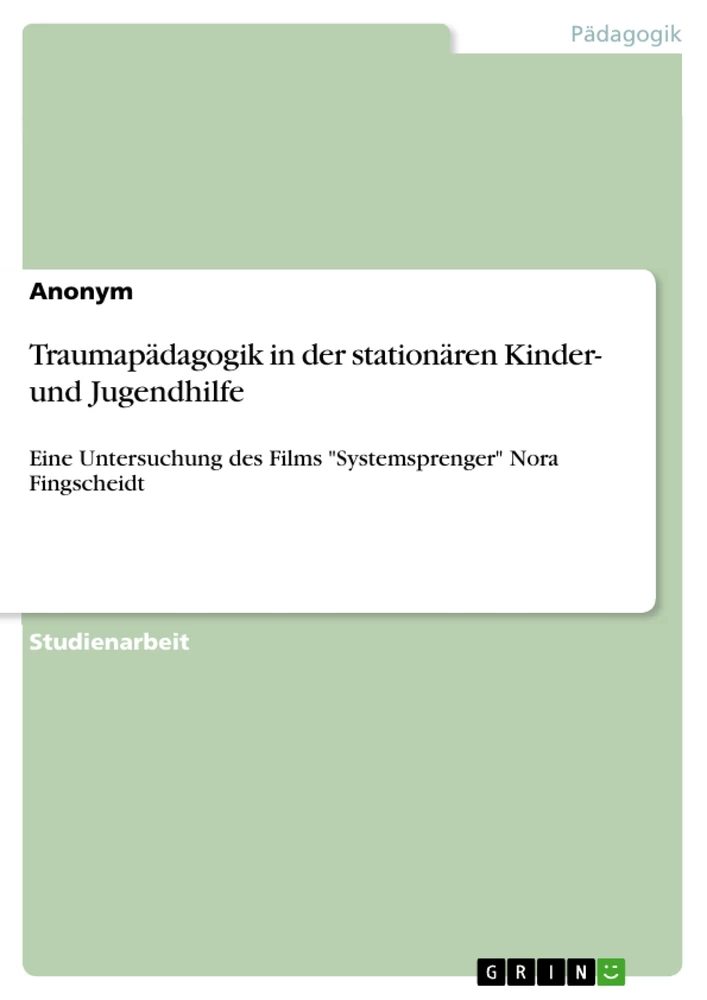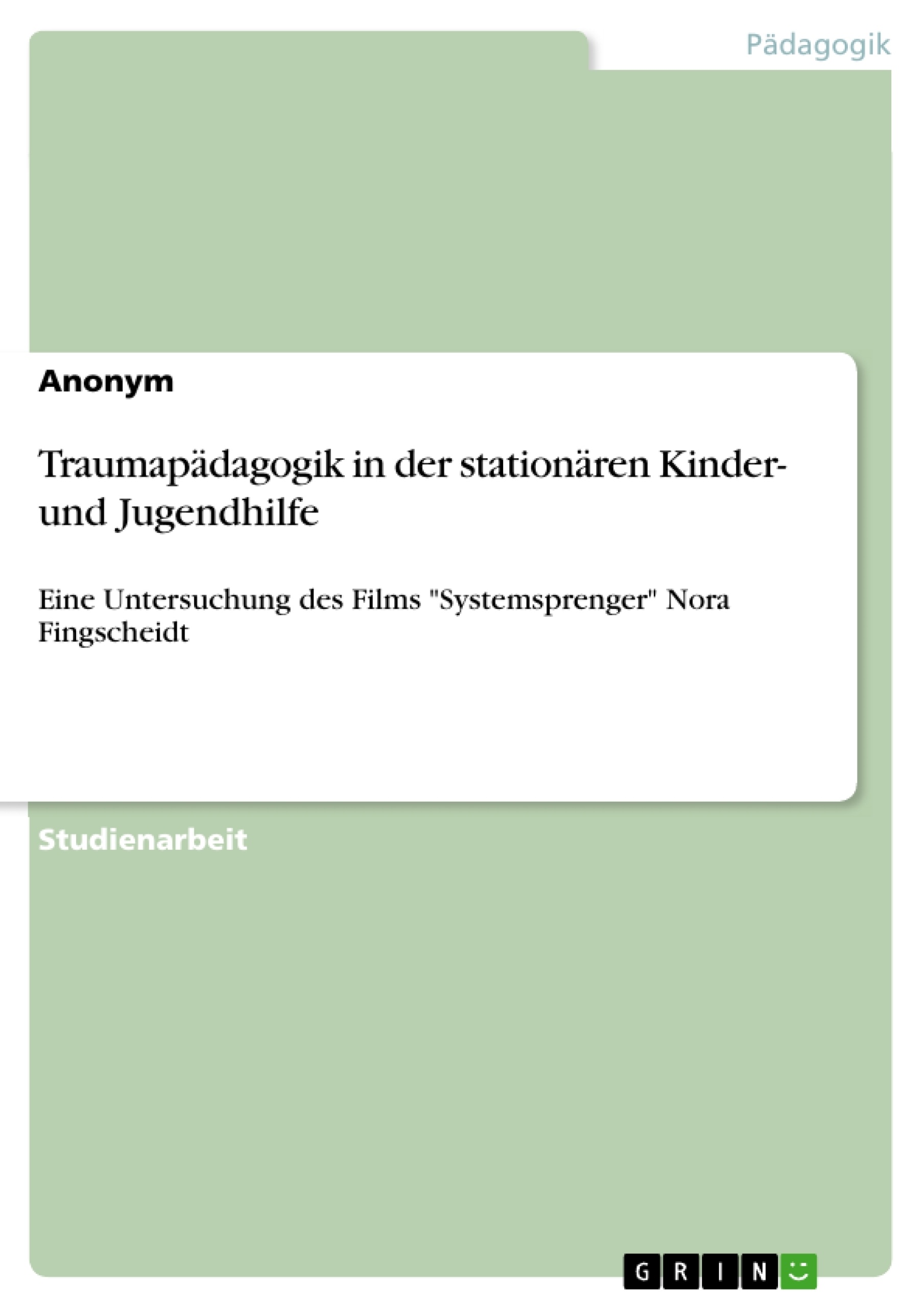Wurde in der Handlung des Films „Systemsprenger“ traumapädagogisch gearbeitet? Hätte es alternative Arbeitshypothesen im Feld der Traumapädagogik gegeben? In der Arbeit wird zunächst sowohl der Begriff der Traumapädagogik als auch der Begriff des Traumas definiert, um im darauffolgenden Teil zu prüfen, ob bei der Protagonistin des Filmes „Systemsprenger“ überhaupt eine Traumatisierung vorliegt. Damit ein allgemeines Bild über den Inhalt des Films entsteht, wird anschließend die Handlung kurz zusammengefasst, sodass im Anschluss auf die Anwendung der Traumapädagogik während des Films eingegangen werden kann. Letztlich wird überlegt beziehungsweise diskutiert, ob es alternative Handlungsmöglichkeiten gegeben hätte, und wenn ja, welche diese wären.
Im letzten Jahr erschien der Film „Systemsprenger“ in den deutschen Kinos und dieser sorgte neben einer breit gefächerten Diskussion in Fachkreisen, ebenso dafür, dass ein reger Austausch zwischen nicht pädagogisch ausgebildete Personen in verschiedensten Portalen stattfand. Darüber hinaus wird von Seiten des Fachpersonals mehrfach betont, dass der Film „Systemsprenger“ überaus realistisch dargestellt wird. Weiterführend ist das Feld der Traumapädagogik relativ neu und wird aufgrund dessen häufig nicht entsprechend der Möglichkeiten angewendet. Deshalb liegt ein großes Interesse die Handlung des Films „Systemsprenger“ in Verbindung mit dem neuen Fachdiskurs der Traumapädagogik zu setzen.
Gliederung
1. Einleitung
2. Theoretische Fundierung
2.1. Definition stationäre Jugendhilfe
2.2. Definition psychisches Trauma
2.3. Definition und Konzept der Traumapädagogik
3. Diskussion
3.1. Handlung des Films Systemsprenger
3.2. Traumatisierung der Protagonistin
3.3. Anwendung der Traumapädagogik im Film
3.4. Alternative Möglichkeiten der Traumapädagogik
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist Traumapädagogik?
Ein pädagogischer Ansatz zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, mit dem Ziel, ihnen Sicherheit und Selbstbemächtigung zu vermitteln.
Wird im Film "Systemsprenger" traumapädagogisch gearbeitet?
Die Arbeit prüft kritisch die Handlungen der Fachkräfte im Film und diskutiert, ob traumapädagogische Konzepte angewendet wurden oder welche Alternativen es gegeben hätte.
Liegt bei der Protagonistin Benni eine Traumatisierung vor?
Die Arbeit definiert zunächst den Traumabegriff und analysiert dann die Biografie und das Verhalten der Figur Benni auf Anzeichen einer Traumatisierung.
Warum gilt der Film in Fachkreisen als so realistisch?
Weil er die Grenzen des Hilfesystems, die Überforderung von Pädagogen und die schwierige Dynamik in der stationären Jugendhilfe ungeschönt darstellt.
Welche Rolle spielt die stationäre Jugendhilfe im Film?
Sie bildet den Rahmen der Handlung und zeigt den harten Alltag in Wohngruppen und die Herausforderungen bei der Betreuung von Kindern mit extremen Verhaltensauffälligkeiten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Traumapädagogik in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/986872