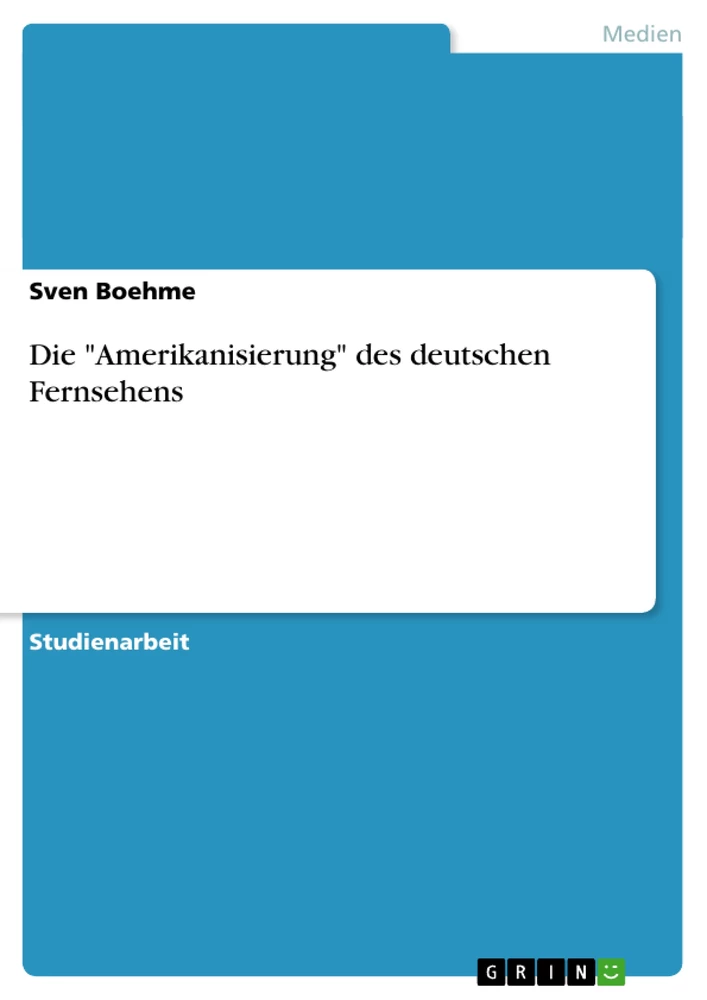Haben amerikanische Traumwelten die deutsche Fernsehlandschaft erobert? Diese brisante Frage steht im Zentrum einer aufschlussreichen Analyse, die tief in die Strukturen und Dynamiken des deutschen Fernsehens eintaucht. Weit mehr als nur eine Bestandsaufnahme des Programmangebots, entfaltet sich eine packende Untersuchung der kulturellen, gesellschaftlichen und ökonomischen Kräfte, die das deutsche Fernsehen im Spannungsfeld zwischen "Amerikanisierung" und "Europäisierung" prägen. Die Leser erwartet eine fesselnde Reise durch die Entwicklung des deutschen Fernsehmarktes, von den Anfängen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bis zum Aufstieg der privaten Sender, die zunehmend auf US-amerikanische Formate setzen. Dabei werden nicht nur die Vor- und Nachteile dieser Entwicklung beleuchtet, sondern auch die potenziellen Auswirkungen auf die deutsche Identität und Kultur kritisch hinterfragt. Im Fokus stehen die ökonomischen Interessen amerikanischer Programmveranstalter, die mit ausgeklügelten Marketingstrategien wie "Windowing" und Preisdiskriminierung den deutschen Markt erobern. Gleichzeitig werden die Bemühungen der Europäischen Union um eine "Europäisierung" des Fernsehens analysiert, die darauf abzielt, die Abhängigkeit von US-amerikanischen Produktionen zu verringern und die Vielfalt der europäischen Kultur zu fördern. Doch welche Erfolgsfaktoren sind auf dem Weg zu einem einheitlichen europäischen Fernsehmarkt wirklich entscheidend? Und welche Rolle spielen transnationale Medienkonzerne, die längst nicht mehr nur amerikanische Interessen verfolgen? Die Leser erwartet eine fundierte Auseinandersetzung mit den theoretischen Ansätzen zur Globalisierung der Kommunikation, vom "one-way-flow of information" bis zur Theorie des "kulturellen Imperialismus", die neue Perspektiven auf die komplexe Beziehung zwischen Amerika und Deutschland eröffnet. Ob Kulturliebhaber, Medieninteressierte oder einfach nur neugierige Zuschauer – diese Analyse bietet faszinierende Einblicke in die Welt des deutschen Fernsehens und regt zum Nachdenken über die Zukunft unserer Medienlandschaft an. Es ist ein unerlässlicher Beitrag zur aktuellen Debatte über kulturelle Identität, Globalisierung und die Macht der Bilder im 21. Jahrhundert. Tauchen Sie ein in eine Welt voller unerwarteter Wendungen und kontroverser Standpunkte, die Ihr Bild vom deutschen Fernsehen nachhaltig verändern werden. Es ist mehr als nur eine Analyse, es ist eine Einladung zum kritischen Diskurs über die Zukunft unserer Medien und unsere Kultur.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Welche Rolle spielen amerikanische Produkte auf dem deutschen Fernsehmarkt?
Analyse des Fernsehprogramms vom Kölner Privatsender RTL
Analyse des Programms des öffentlich - rechtlichen Fernsehsenders ZDF
Vergleich und Zusammenfassung der beiden untersuchten Fernsehsender
Zum Verständnis des Begriffs „Amerikanisierung”
Die gesellschaftspolitische und sozioökonomische Entwicklung der USA und der Bundesrepublik Deutschland
Die Entwicklung und die Rolle des Mediums Fernsehen in Deutschland und den USA...
Kulturelle Aspekte des „Amerikanisierungprozesses”
Das Kulturverständnis in den USA
Das Kulturverständnis in Deutschland
Die kulturelle Auseinandersetzung mit der „Amerikanisierung” des Fernsehens in Deutschland
Die Bedeutung ökonomischer Einflußgrößen für die Entwicklung des deutschen Fernsehens
Ökonomische Ziele amerikanischer Programmveranstalter
Ökonomische Ziele deutscher Programmveranstalter
„Windowing“ und Preisdiskriminierung als Beispiele für internationale Marketingstrategien der USA
Der deutsche Fernsehmarkt im Kontext einer „Europäisierung“
Die EG-Fernsehrichtlinie von 1989
„Europäisierung“ versus „Amerikanisierung“
Erfolgsfaktoren auf dem Weg zum einheitlichen europäischen Fernsehmarkt
Die Macht auf dem Medienmarkt
Theoretische Ansätze - Amerikas Einfluß auf die Globalisierung der Kommunikation..
Der „one-way-flow of information“
Die Theorie des „Kulturellen Imperialismus“
Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
Einleitung
„Was wollen wir denn heute abend machen?“ - „Na, fernsehen, was sonst?“
Die triste Antwort ist alltäglich in deutschen Haushalten zu vernehmen. Für viele Menschen ist das Fernsehen inzwischen zur wichtigsten Freizeitbeschäftigung avanciert. Bestimmte Sendungen sind den Zuschauern sogar so wichtig, daß sie ihren Tagesrhythmus auf das Fernsehprogramm abstimmen. Andere Aktivitäten werden zugunsten der „Droge Fernsehen“ zurückgestellt.
Doch, was ist es, das die Zuschauer so fasziniert? Unterhaltungsprogramme genießen gegenwärtig die größte Resonanz. Informations- und Bildungssendungen werden von einer zunehmend geringeren Anzahl Fernsehzuschauer konsumiert. Dabei ist zu beobachten, daß sich viele Programme heute an US-amerikanischen Vorbildern ausrichten und diese imitieren. Ein großer Anteil des Programms deutscher Fernsehveranstalter wird ohnehin direkt durch den Kauf von Ausstrahlungsrechten amerikanischer Programme bestritten. Oft ist gerade in diesem Zusammenhang von einer „Verdummung“ des Publikums die Rede.
Sind damit aber die USA für die Entwicklung des deutschen Fernsehsektors bzw. gar für Wirkungen der Programme auf das deutsche Publikum verantwortlich? Kann man von einer „Amerikanisierung“ des deutschen Fernsehens sprechen? Diese Arbeit gibt zunächst einen Überblick über das gegenwärtige Programm- angebot deutscher Fernsehveranstalter. Um die Tendenz der „Amerikanisierung“ des deutschen Fernsehprogramms zu untersuchen, erfolgt dann eine Analyse der gesellschaftlichen und kulturellen, sowie ökonomische Aspekte, die für die Ent- wicklung auf dem deutschen Film- und Fernsehmarkt ausschlaggebend waren bzw. noch relevant sind. Schließlich geht es um die Fragen, welchen Einfluß US-ameri- kanische Unternehmen heute auf den deutschen Fernsehmarkt haben, und ob die „Amerikanisierung“ als ein Beitrag zur Globalisierung der Kommunikation verstan- den werden kann.
Welche Rolle spielen amerikanische Medienprodukte auf dem deutschen Fernsehmarkt ?
Analyse des Fernsehprogramms vom Kölner Privatsender RTL
„Amerikanische Fernsehprodukte besetzen heutzutage die wichtigsten und den Großteil der Programmplätze!“
Um diese Behauptung zu untermauern, analysierten wir das Fernsehprogramm des wichtigsten deutschen Privatfernsehsenders RTL über den Zeitraum von einer Woche.
Bei dem Beobachtungszeitraum handelt es sich um die Woche vom 16.8.99 ab 6:00 Uhr bis zum 23.8.99 6:00 Uhr morgens. Eine schlichte Auszählung ergab, daß von 257 in den dieser Woche ausgestrahlten Sendungen, 96 in den USA produziert wurden, das entspricht einem Anteil von rund 38 %. Dies ist aber nur der durchschnittliche Anteil der amerikanischen Produktionen am RTL-Programm in dieser Woche. Bricht man die Beobachtungszeit auf die einzelnen Tage herunter, so ergeben sich große Unterschiede zwischen den einzelnen Wochentagen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1
Besonders ausgeprägt ist der amerikanische Sendeanteil am Wochenende. Während Werktags etwa 20% des RTL-Programms aus den USA stammen, erhöht sich der Anteil am Samstag und Sonntag auf 79% bzw. 61%. Damit hebt sich das Wochenendprogramm von RTL deutlich vom üblichen Werktagsprogramm ab. Wie schon angesprochen wurden in dieser Woche insgesamt 96 amerikanische Produktionen ausgestrahlt. Den größten Anteil unter diesen Sendungen stellte dabei das Programmformat Serie. 55 Folgen, aus 21 verschiedenen Serien1 wurden dabei in dieser Woche bei RTL gezeigt. Die meisten Folgen wurden von den Serien: „Der Hogan Clan“, „Springfield Story“, „Reich und Schön“, „Die Nanny“ und „Mary Tyler Moore“ gezeigt. Von ihnen wurden jeweils 5 Folgen gesendet, wobei häufig die am Tag gezeigten Folgen noch einmal im Nachtprogramm wiederholt wurden.
Bei den Ausstrahlungszeiten war kein einheitlicher Trend zu erkennen. Am häufigsten liefen die Serien im Vormittagsprogramm, wobei „Der Hogan Clan“, die „Springfield Story“ und „Reich und Schön“ Werktags ab 9:00 Uhr direkt hintereinander gesendet wurden. Ansonsten verteilten sich die amerikanischen Serien uneinheitlich auf das restliche Tagesprogramm. Generell läßt sich aber sagen, daß die amerikanischen Serien bei RTL nicht in der Primetime laufen.
Eine einheitliche Linie lässt sich hingegen bei den 37 ausgestrahlten amerikanischen Trickfilmen2 in dieser Woche erkennen. Sie wurden generell am Wochenende im Vormittagsprogramm von RTL gezeigt. Das liegt wohl sicherlich daran, daß es sich bei der angesprochenen Publikumsgruppe hauptsächlich um Kinder handelt, die sehr häufig die Vormittage des Wochenendes für ihren Fernsehkonsum nutzen. Diese gezeigten Trickfilme war auch der Grund dafür, daß der amerikanische Sendeanteil bei RTL am Wochenende so hoch schnellt. Jeweils ab 6:00 bis etwa gegen 12:00 Uhr am Samstag bzw. Sonntag wurden ausschließlich amerikanische Trickfilmproduktionen gezeigt, während Werktags dieses Genre nicht bedient wurde. Danach folgten teilweise Doppelfolgen (Beverly Hills 90210, Prinz von Bel Air) von den schon angesprochenen Serien.
Große amerikanische Spielfilmproduktionen wurden in dieser Woche bei RTL nur viermal dem Rezipienten angeboten. Sie stellen generell ein großes „Highlight“ im Abendprogramm von RTL dar. Besonders auffällig ist dabei, das drei von den vier amerikanischen Spielfilmen in der Primetime am Wochenende liefen. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass man sich am Wochenende höhere Einschaltquoten erhofft, als an einem „normalen“ Wochentag.
Will man nun ein kleines Fazit ziehen, so kommt man nicht an der Tatsache vorbei, dass das Programm von RTL sehr stark mit amerikanischen Produktionen durchsetzt ist. Gerade am Wochenende werden dem geneigten Fernsehzuschauer vorrangig amerikanische Trickfilme, Serien und Spielfilme angeboten. Das liegt zum einem sicherlich daran, dass die Programmverantwortlichen von RTL das Programm relativ billig füllen müssen. Durch den zweifelsfreien Preisvorteil, den die amerikanischen Medienprodukte haben, kann man mit ihnen relativ billig viel Sendezeit füllen. Auch die soziale und politische Situation in der Bundesrepublik Deutschland in der Vergangenheit unterstützen die Programmverantwortlichen bei der Auswahl von amerikanischen Produktionen für den deutschen Fernsehmarkt, gerade bei den privaten Fernsehveranstaltern.
Analyse des Programms desöffentlich - rechtlichen Fernsehsenders ZDF
In Deutschland besitzen wir ein duales Fernsehsystem! Dabei werden die Fernsehsender in private und öffentlich - rechtliche Anbieter unterschieden. Um nun eine Aussage über die „Amerikanisierung“ des deutschen Fernsehprogramms treffen zu können, müssen wir in unsere Analyse natürlich auch die öffentlich - rechtlichen Anbieter mit einbeziehen.
Unsere Wahl fiel dabei auf die öffentlich - rechtliche Fernsehanstalt ZDF, die bei den Zuschaueranteilen 1998 einen dritten Platz3 belegte.
Um einen Vergleich zu den Ergebnissen der Analyse des Fernsehprogramms von RTL zu bekommen, wählten wir für unsere Analyse des ZDF - Programms den gleichen Zeitraum, 16.8.99 ab 6:00 Uhr bis zum 23.8.99 6:00 Uhr, aus.
Insgesamt 279 Sendungen strahlte das ZDF in diesem Zeitraum aus, wobei 7 Produktionen aus den USA stammten und 11 aus anderen amerikanischen und europäischen Ländern. Relativ kamen also in dieser Woche 2,7% der Sendungen aus den USA und 3,9 % aus Länder wie z.b. Großbritannien, Spanien, Frankreich und Kanada. Den größten Anteil stellte dabei Frankreich mit 1% (3 Produktionen), und England, Kanada und Australien, mit jeweils 0,35% (1 Produktion).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2
Verkleinert man, vergleichbar mit der Analyse vom RTL-Programm, nun den Beobachtungszeitraum auf die einzelnen Wochentage, so stellt man kaum Unterschiede beim amerikanischen Anteil fest. Er bleibt die ganze Woche relativ konstant, nur am Wochenende, vergleichbar mit RTL, steigt er leicht an. Bei den anderen ausländischen Produktionen ist kein Unterschied zwischen den einzelnen Wochentagen festzustellen. Ihr Anteil liegt relativ konstant zwischen drei und fünf Prozent. Er steigt dabei auch am Wochenende nicht spürbar an.
Bei der Auswahl der ausländischen Fernsehproduktionen setzten die Programmverantwortlichen beim ZDF in der untersuchten Woche ausschließlich auf das Genre Spielfilm. Die anderen Genre (Serien, Trickfilme), die im RTL-Programm noch so deutlich im Vordergrund gestanden, wurden beim ZDF-Programm im analysierten Zeitraum nicht berücksichtigt.
Besonders bemerkenswert bei der Analyse, war die Tatsache, das an den ausländischen Filmen, die nicht aus den USA kamen, häufig mehrere Länder an der Produktion beteiligt waren. Diese Tatsache war bei den ausgestrahlten USamerikanischen Filmen nicht zu beobachten.
Sowohl die amerikanischen, als auch die anderen ausländischen Medienprodukte, wurden vorrangig in der Primetime platziert. Während die Produktionen der anderen Länder Werktags sehr stark dominieren, nimmt der Anteil der US- amerikanischen Produkte am Wochenende in der Primetime deutlich zu. Fast man die Ergebnisse noch einmal kurz zusammen, so kommt man zu der Aussage, dass die amerikanischen Medienprodukte in dieser Woche eine untergeordnete Rolle im ZDF-Programm gespielt haben. Es war eine deutliche Nationalitätenstreuung zu erkennen. Dem ZDF - Zuschauer wurden dabei in der Woche vom 16.8.99 bis zum 23.8.99, 18 Spielfilme aus 9 verschiedenen Ländern zur Rezeption angeboten, wobei die US-amerikanischen Produkte mit 7 Produktionen die größte Gruppe stellten.
Vergleich und Zusammenfassung der beiden untersuchten Fernsehsender
Wie schon angesprochen wählten wir für unsere kurze Analyse des Fernsehprogramms vom ZDF und RTL den gleichen Untersuchungszeitraum aus. Hierbei handelte es sich um eine ganz „normale“ Fernsehwoche, sie wurde weder durch Feiertage oder besondere Veranstaltungen (z.b. Sport usw.) unterbrochen. Natürlich wäre für eine umfassende Analyse ein längerer Untersuchungszeitraum nötigt gewesen, doch um generelle Tendenzen herauszulesen war der gewählte Rahmen durchaus ausreichend.
Vergleicht man die erhaltenen Zahlen nun direkt miteinander, so ergeben sich doch deutliche Unterschiede. Um es ganz banal auszudrücken: RTL setzt sehr stark auf amerikanische Fernsehproduktionen, wobei das Wochenende deutlich von diesen Produkten dominiert wird. Im Gegensatz dazu, wird beim ZDF mehr Wert auf Internationalität gelegt. US-amerikanische Medienprodukte spielen unter den ausländischen Fernsehprodukten immer noch eine entscheidende Rolle, aber auch Filme und Serien aus anderen Ländern werden dem ZDF-Zuschauer angeboten.
Nun stellt sich die Frage: Warum ist das so?
Wie schon einmal angesprochen, spielen heutzutage finanzielle Zwänge eine entscheidende Rolle bei der Programmgestaltung. Gerade die privaten Fernsehanbieter müssen darauf achten, daß sich ihr angebotenes Fernsehprogramm refinanzieren läßt. Diesen Zwängen unterliegen öffentlich - rechtliche Fernanstalten nur teilweise, da sie ihr Programm nur zu einem geringen Teil durch die Werbung refinanzieren müssen, bleiben häufig Spielräume in der Programmgestaltung. Sicherlich müssen diese Anstalten heutzutage auch auf ihre Einschaltquoten Rücksicht nehmen, doch es ergeben sich immer noch genügend Sparten für ein etwas anspruchvolleres Programm. Sicherlich tragen auch die europäischen Kulturaustauschprogramme zu dem Anteil der ausländischen, nicht- amerikanischen Medienprodukte bei.
Amerikanische Filme und Serien haben eine Reihe von Vorteilen: Durch die weltweite Vormachtstellung der USA auf dem Mediensektor, werden die Preise für die Senderechte durch die amerikanischen Produzenten diktiert und kontrolliert. Weiterhin werden diese Produkte vom deutschen Fernsehrezipienten akzeptiert, wobei die soziokulturelle Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg dafür sicherlich ausschlaggebend war und ist.
Die US-amerikanischen Filme und Serien prägen weiterhin unsere Programmlandschaft, auch weil gerade die zuschauerkräftigen privaten Fernsehsender (RTL, SAT 1, Pro7 usw.) weiterhin stark auf solche Produkte setzen.
Zum Verständnis des Begriffs „Amerikanisierung”
„Amerikanisierung” - was ist darunter eigentlich zu verstehen? Ist dieser Begriff in seiner geographisierenden Form nicht völlig irreführend? Amerika ist ein Kontinent, bestehend aus weit mehr Staaten als nur den Vereinigten Staaten (USA). Wer hier in Deutschland oder Europa von Amerika spricht, meint zumeist die USA. Doch die USA stellen zwar einen dominanten, aber nicht den einzigen Staat auf den Kontinenten Süd- und Nordamerika dar. Vielmehr müßte demnach von US-Amerikanisierung gesprochen werden. Das Wort „Amerikanisierung” wird dennoch auch in Fachkreisen häufig verwendet. Doch was wird im deutschen Sprachgebrauch damit gemeint? Ist es die Angst vor dem Einschleichen US- amerikanischer Werte, ist es die Angst vor dem Verlust der kulturellen Identität der eigenen Nation? Oder ist es vielmehr das Ausbreiten der sogenannten „popular culture” der USA über Ländergrenzen hinaus.
In einer Welt, in der die Kommunikation über Ländergrenzen hinweg etwas alltägliches geworden ist, ist es ganz natürlich, daß verschiedenen Kulturen aufeinandertreffen. Der Einfluß der USA ist und bleibt ein Sonderfall. In fast allen Gesellschaftsbereichen, sei es Kultur, Politik oder Wirtschaft, gibt es Trends, die auf eine Konvergenz zu US-amerikanischen Gepflogenheiten schließen lassen. Besonders im Bereich der audiovisuellen Medien übernehmen die USA eine Rolle, die von vielen Medienkritikern und Kulturpolitikern als zu dominant eingeschätzt wird. Die amerikanische Kultur zieht in die Wohnzimmer der Deutschen ein. Wird in der deutschen Fernsehkritik beispielsweise mit Blick auf fiktionale Serien mit negativem Unterton von „Amerikanisierung” gesprochen, geht es dabei in der Regel um Trivialisierung, Kommerzialisierung oder Brutalisierung (Hallenberger 1992).
„Amerikanisierung” steht in Deutschland vor allem für den wachsenden Einfluß US-amerikanischer Kulturgüter, vor allem im Bereich der audiovisuellen Medien. Im folgenden soll untersucht werden, was die beiden Kulturen Deutschlands und der USA unterscheidet und warum die Deutschen die amerikanischen Einflüsse so bereitwillig aufnehmen. Zum besseren Verständnis der kulturellen Eigenheiten der beiden Staaten ist es notwendig, die gesellschaftlichen und sozioökonomischen Hintergründe der USA und der Bundesrepublik Deutschland zu betrachten.
Die gesellschaftspolitische und sozioökonomische Entwicklung der USA und der Bundesrepublik Deutschland
In den USA wie auch in der Bundesrepublik Deutschland herrschen gesicherte demokratische Verhältnisse, die in beiden Staaten auf Weltanschauungen basieren, die eng mit dem christlichen Glauben verbunden sind. In beiden Staaten gelten grundlegende westliche Werte und Ordnungsvorstellungen. Die USA sind jedoch gegenüber Deutschland geographisch, wirtschaftlich und bevölkerungsmäßig absolut überlegen. Sie besitzen nicht nur gegenüber Deutschland eine Vormachtstellung, sondern üben politischen und militärischen Einfluß auf nahezu alle Staaten dieser Erde aus.
Die USA sind ein traditionelles Einwandererland mit einer relativ jungen Geschichte. Die US-Bürger stammen in der Mehrzahl von Europäern oder von afrikanischen Sklaven ab. Die Ureinwohner Amerikas, die Indianer, leben fast ausschließlich in Reservaten und nehmen in der Gesellschaft eine kaum wahr- nehmbare Rolle ein. So haben sich die US-Bürger in den letzten zwei Jahrhun- derten ein demokratisches Nationalbewußtsein gebildet, das auf der Mischung verschiedenster Kulturen basiert, das aber bis heute von der weißen Rasse dominiert wird.
Deutschland hingegen ist kulturell vergleichsweise heterogen strukturiert, mit einer traditionell verankerten Loyalität zum eigenen Staat. In den USA hat sich eine starke, antistaatliche, individualistische Grundhaltung herausgebildet. Dies liegt darin begründet, daß die Menschen, die sich entschlossen hatten, in die neue Welt auszuwandern, zumeist den strengen politischen Ordnungen ihrer Heimatländer entkommen wollten (Gramberger 1994). Das spiegelt sich bis heute in fast allen Bereichen der Gesellschaft wider. In den USA arbeiten die meisten Interessen- vertretungen auf kommerzieller Basis, während in Deutschland viele Angelegenheiten durch staatliche, öffentliche oder gemeinschaftliche Träger geregelt werden. So sind in den USA viele Einrichtungen, die in Deutschland von öffentlicher Hand betrieben werden, kommerziell organisiert. Insbesondere betrifft das Bildungswesen, Sportangebote sowie Kulturangebote, darunter auch das Fernsehen.
Die individualistische Tradition in den USA räumt den Bürgern des Landes weitreichende persönliche Freiheiten in Politik und Wirtschaft ein. In der Verfassung ist die Freiheit der Meinungsäußerung eines der wichtigsten Gebote, die auch wie in Deutschland der Artikel 5 des Grundgesetzes, absolute Rundfunk- und Pressefreiheit garantiert. Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Staaten ist die föderale Struktur. Beide Länder sind föderalistisch organisiert, wobei in den USA der föderalistischen Struktur eine weit größere Bedeutung zukommt. Dies läßt auf grundsätzliche Gemeinsamkeiten in der nationalen Kommunikations- situation schließen.
Die USA sind seit Ende des Kalten Krieges die dominierende Weltmacht. In dieser Position der militärischen und wirtschaftlichen Stärke dienen sie vielen Ländern dieser Erde als Vorbild, so auch der Bundesrepublik Deutschland. Entwicklungen der Gesellschaft fanden in den USA bisher zehn bis zwanzig Jahre früher statt als in der Bundesrepublik Deutschland. Das gilt insbesondere für die Entwicklung von der Industriegesellschaft hin zu einer nachindustriellen Dienstleistungsgesellschaft. Dies zeigt der Anteil der Erwerbstätigen in Handel und Dienstleistungen. Gleiches gilt für die Anzahl der Fernsehgeräte je 1.000 Einwohner, die in den USA bereits 1966/67 einen Verbreitungsgrad hatte, der in der Bundesrepublik Deutschland erst 1987 erreicht wurde (Göttlich 1992).
Der zuvor beschriebene Entwicklungsvorsprung ist allerdings mit dem Übergang zur Informationsgesellschaft gefährdet. Mit der zunehmenden Globalisierung der Märkte sind die führenden Industrienationen der Welt, zu denen Deutschland und die USA gerechnet werden, gezwungen, Technologien in einem rasanten Tempo weiterzuentwickeln, um damit ihre Stellung auf den internationalen Märkten nicht zu verlieren. Vor allem die asiatischen Staaten, allen voran Japan und China, drangen mehr und mehr in den klassischen US-amerikanischen Markt ein.
Im Gegensatz zu Japan zum Beispiel stellt Deutschland keine so große Bedrohung dar, da die deutsche Industrie hauptsächlich komplementär zu den US-amerika- nischen zu sehen ist. Deutschland stellt für die USA die führende wirtschaftliche Kraft in Europa dar und ist für die USA ein Absatzmarkt, der gerade im Hinblick auf die europäische Union immer mehr an Bedeutung gewinnt. Deutschland wird von den USA als Tor zu Europa gesehen. Im umgekehrten Sinne sind die USA für Deutschland von ebenso großer wirtschaftlicher Bedeutung; sie bilden nach West- europa für Deutschland den zweitwichtigsten Absatzmarkt (Gramberger 1994).
Die Entwicklung und die Rolle des Mediums Fernsehen in Deutschland und den USA
Die USA hatten eine kurze, knapp mehr als 200jährige Geschichte. Sie besteht aus 50 Teilstaaten, die gemeinsam den mächtigsten Staat der Welt bilden. Die föderalistische Struktur ist in der USA weit stärker ausgeprägt als in Deutschland. In der Entwicklungsphase gewannen Medien an integrierender Kraft - erst der Hörfunk und später auch das Fernsehen.
Bedingt vor allem durch die Weitläufigkeit des Landes, hatten gemeinsame Fernsehprogramme von der Ost- bis zu Westküste, von der Karibik bis zur kanadischen Grenze eine ähnliche Funktion wie die erste transkontinentale Eisenbahn ein Jahrhundert zuvor (Schneider 1992).
In Deutschland war und ist dieser Integrationseffekt ebenfalls gegeben, doch lange nicht in einer solch ausgeprägten Form. Hier sind die räumlichen und kulturellen Entfernungen, die zwischen den Menschen mit Hilfe des Mediums Fernsehen überwunden werden, nicht annähernd so groß wie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine vergleichbare Situation ergibt sich allerdings für die europäische Gemeinschaft. Denn diese steht seit einigen Jahren vor ähnlichen Integrationsanforderungen. Der Weg zu einem vereinten Europa führt nur über die Verständigung der unterschiedlichen Kulturen, die in Europa vertreten sind. Diese vielen verschiedenen Kulturen können auch mit Hilfe des Medium Fernsehens mehr voneinander erfahren und sich einander näher kommen. Genau dieser Prozeß fand in den USA schon vor 50 Jahren statt, kann aber noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden.
Ebenso wie der Hörfunk war auch das Fernsehen in den USA von Anfang an privatwirtschaftlich organisiert. Nichtkommerzielles Fernsehen bildete sich erst 20 Jahre später als das kommerzielle heraus.
In Deutschland herrscht eine genau umgekehrte Situation. Hier ist das öffentlich- rechtliche Fernsehen lange Zeit der einzige Anbieter gewesen, bis das Bundesverfassungsgericht in seinem Dritten Rundfunkurteil vom 16. Juni 1981 den Ländern die Möglichkeit einräumte, in ihrer jeweiligen Gesetzgebung neben dem öffentlich-rechtlichen auch den privaten Rundfunk zuzulassen (Donsbach, Mathes 1996).
In den USA war und ist das Fernsehen vom Publikum abhängig, das Fernseh- programm wurde von Anfang an auf größtmöglichen Zuschauererfolg ausgelegt. Im Vergleich mit späteren Entwicklungen im Fernsehen der Bundesrepublik Deutschland besaßen die USA in diesem Punkt gleich einen doppelten Entwicklungsvorsprung (Hallenberger 1992). Auf der einen Seite einen technischen: In den USA wurde das Fernsehen weitaus früher zu einem echten Massenmedium als in Deutschland.
In den USA gab es Ende der 30er Jahre kaum Fernsehgeräte in Privatbesitz, zum offiziellen Programmstart anläßlich der New Yorker Weltausstellung 1939 waren es nur knapp 500 Geräte. In den Nachkriegsjahren nahm die Entwicklung einen rasanten Aufschwung. 1948 gab es in den USA schon eine Million Fernsehgeräte. In Deutschland konnte sich erst mit dem Wirtschaftswunder eine breitere Masse Fernsehgeräte leisten.
Auf der anderen Seite hatten die USA auch einen inhaltlichen Vorsprung: Wegen der privatwirtschaftlichen Organisation der audiovisuellen Medien hatten sich dort schon auf größtmöglichen Zuschauererfolg hin optimierte Unterhaltungsgenres entwickeln können, lange bevor es in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt eine echte Konkurrenz um Einschaltquoten gab (Hallenberger 1992). Mit der Einführung des Farbfernsehens in den 50er Jahren wurde das Fernsehen in den USA zum integrativen Bestandteil eines funktionierenden Konsumsystems. Das Fernsehen wurde zur Ware, bzw. zum Zwischenhändler, denn die eigentliche Ware sind die Werbebotschaften, die mit dem Programm von den Rezipienten aufgenommen werden. Die Film- und Fernsehindustrie stellte sich schnell auf die neuen technischen Entwicklungen ein, und binnen kürzester Zeit entstand auf dem US-amerikanischen Markt ein umfangreiches, farbfernsehtaugliches Programm- material.
Ganz anders verlief die Entwicklung des Fernsehens in Deutschland. Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges war Deutschland von den Alliierten besetzt. Ihnen oblag es auch, das Rundfunksystem neu zu organisieren. Im Westen Deutschlands beabsichtigten die Alliierten, den Einfluß des Rundfunks nach der Zerschlagung des nationalsozialistischen Regimes so gering wie möglich zu halten. Anfangs gab es Überlegungen, die bestehenden Rundfunkstrukturen den Zonen zu übertragen, dies scheiterte aber an den Amerikanern. Denn für Rundfunk nach amerikanischem Vorbild fehlte im zerstörten Deutschland der Werbemarkt.
So wurde das britische, öffentlich-rechtliche Modell übernommen, da das französische zu zentralistisch war, und eine neuerliche Gefahr für den Mißbrauch geliefert hätte (Donsbach, Mathes 1996).
Nach den jeweiligen Landesrundfunkgesetzen gründeten sich Rundfunkanstalten, die sich 1950 zur Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland zusammenschlossen. Die Finanzierung erfolgte, im Gegensatz zu den USA, aus Gebühren und nur zu geringen Teilen aus Werbeeinnahmen. Auf die Entwicklung im Osten Deutschlands soll in diesem Zusammenhang nicht eingegangen werden, da sie für die heutige Situation des deutschen Fernsehgeschehens nicht signifikant ist.
Das Fernsehen stellte nach seiner Wiedereinführung im Westen Deutschlands im Jahre 1954 vorwiegend ein Informationsmedium für all jene dar, die es sich leisten konnten. Je mehr Bürger sich jedoch einen Fernseher leisten konnten, desto mehr rückte auch die Unterhaltung ins Blickfeld der Zuschauer.
Ein großes Problem für das deutsche Fernsehen stellte die Einführung des Farbfernsehens dar. Mit der Umstellung auf farbige Programme mußte von den Sendeanstalten gewährleistet werden, daß diese auch auf den alten Schwarz-Weiß- Geräten zu empfangen waren. In Europa bildeten sich zudem unterschiedliche Farbnormen heraus, was für die weitere Entwicklung der durch den 2. Weltkrieg geschwächten Film- und Fernsehindustrie nicht gerade förderlich sein sollte. Farbfilme konnten nicht gesendet werden, da sie im Schwarz-Weiß-Fernsehen wegen Helligkeitsproblemen nicht zu erkennen waren. So gab es Fußballspiele, bei denen die Spieler trotz unterschiedlicher Trikotfarben im Schwarz-Weiß-Fernsehen nicht zu unterscheiden waren (Göttlich 1992). Im Zuge dessen wurde auf US- amerikanisches Programmaterial zurückgegriffen.
Mit der Einführung des Kabel- und Satellitenfernsehens erhöhte sich die Anzahl der technisch möglichen Fernsehkanäle enorm, während terrestrische Fernsehkanäle weiter knapp blieben. Folge dieser neuen technischen Möglichkeiten war die schrittweise Liberalisierung des Rundfunks. In den 80er Jahren wurden in Deutschland erstmals private Anbieter zugelassen, heute sind rund 20 private deutsche Fernsehsender im Kabel zu empfangen. Ihre Zahl wird im Hinblick auf die Einrichtung von Spartenkanälen in Zukunft weiter steigen.
Mit der Zulassung privater Anbieter verstärkte sich die kulturelle Durchsetzung des deutschen Fernsehens mit US-amerikanischem Programmaterial, und gleichzeitig die Diskussion über Gefahren und Risiken einer schleichenden „Amerikanisierung” des deutschen Medienalltags.
Kulturelle Aspekte des „Amerikanisierungsprozesses”
Das Kulturverständnis in den USA
Die Kultur der USA nimmt weltweit eine Sonderstellung ein. Was heute unter „Amerikanisierung” verstanden wird, ist ein Prozeß, der zu allererst in den USA einsetzte. Der kulturelle Transformationsprozeß begann in den USA mit der Entstehung der modernen Massenkultur um 1900 und erfaßte zunächst die amerikanische Kultur selbst. In den USA identifizieren sich die Menschen im Gegensatz zur europäischen Klassenspaltung in Elite und Masse, in ’oben’ und ’unten’, in einer umfassenden „popular culture” (Fluck 1998) - einer Kultur, an der jeder Bürger partizipieren kann.
Die USA sind als Einwandererland zu einem Schmelztopf der Kulturen geworden. Aufgrund dieser Multikulturalität der Gesellschaft wurde es nötig, daß sich Kommunikationsformen entwickelten, die unabhängig von Kultur und Bildungshintergrund verständlich waren. Diese Herausbildung von einer allgemeinverständlichen und allgemein zugänglichen Kultur wird von Kritikern als Massenkultur bezeichnet. Doch die „popular culture” ist keine reine Massenkultur, sondern sie profitiert und lebt von der Koexistenz verschiedener kultureller Traditionen und Stile. Die Multitethnizität und Multikulturalität der US- amerikanischen Gesellschaft führte zu Mischformen und Synergieeffekten, die die europäische Kultur in dieser Intensität nicht kennt. (Fluck 1998). Dieses Kulturgemisch wurde zum treibenden Motor für die amerikanische Unterhaltungs- industrie auf der Suche nach allgemein akzeptierten Unterhaltungsformen.
Ziel dieses Prozesses war es, Ausdrucksformen zu finden, die ganz verschiedene soziale und ethnische Gruppen erreichen konnten. Diese Entwicklung wurde durch die Suche der Plattenfirmen, Rundfunkanbieter und Filmindustrie nach ökonomischem Erfolg begünstigt, wenn nicht sogar initiiert.
Resultat dieses Transformationsprozesses war eine Allgemeinverständlichkeit kultureller Güter; die verschiedenen Kulturen konnten gleichermaßen erreicht werden. So können der Film, das Fernsehen und auch die Musik als Produkte der „popular culture” gesehen werden, die den kulturellen Amerikanisierungsprozeß auf den Weg gebracht haben.
Das Endprodukt der „popular culture” ist eine kulturelle Universalsprache, die alle Menschen verstehen können. Kulturkritiker haben diesen Transformationsprozeß lange als die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner angesehen, und daraus den Schluß gezogen, „popular culture” sei gleichbedeutend wie Banalität und Trivialität.
Doch in der „popular culture” geht es nicht nur um Reduktion sondern um Vereinfachung der grundlegenden Kommunikations- und Verständnisbedingungen, die der inhaltlichen Ausfüllung als übergeordnet betrachtet werden können. In der „popular culture” werden die Zugangsbedingungen zu den Kulturangeboten erheblich vereinfacht. Das Privileg des sozialen Zugangs zur Kultur entfällt genauso wie die Voraussetzung einer bestimmten Rezeptionskompetenz nicht unbedingt gegeben sein muß. Die „popular culture” spricht eine Sprache, die alle verstehen.
An der Realisierung der „popular culture” mitzuwirken ist akzeptierter und respektierter Job der kreativen Intellektuellen in den USA. Das Fernsehen entwickelte sich durch seine Visualisierungsmöglichkeit und den relativ einfachen Zugang zum dominantesten Medium der popular culture.
Die Formate der US-amerikanischen Sendungen, die in Europa und Deutschland sehr beliebt aber auch umstritten sind, sind ohne Frage Ergebnis dieses Entwicklungsprozesses zu einer Universalsprache, die auch die Menschen in anderen Ländern erreichen kann. Durch die technischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte hat sich gerade in den USA ein riesiges Spektrum an zielgruppenspezifischen Programmen etabliert. Diese Vielfalt zeigt, daß die „popular culture” das Publikum nicht auf eine Ebene normiert und reduziert hat. Die Individualisierungstendenzen sind auch in der „popular culture” der USA nicht verloren gegangen.
Das Kulturverständnis in Deutschland
In der deutschen Gesellschaft ist das Bildungsbürgertum traditionell viel einflußreicher als in der amerikanischen. Das hat vielfältigste historische Ursachen. Unter anderem ist die deutsche Gesellschaft geographisch und sozial immobiler, kulturell und ethnisch einheitlicher. Der Faktor der Multikulturalität spielt in Deutschland eine wesentlich geringere Rolle als in den USA. Dieser hohe Grad an Homogenität hat eine direkte Form kultureller Hegemonie begünstigt, die „Hörigkeit” der Massen gegenüber der Hochkultur, das heißt das Volk orientiert sich am Wertesystem der gebildeten Schicht und kulturell am Geschmack des Bildungsbürgertums (Sonnert 1993).
Traditionell ist in Deutschland der Staat eine der mächtigsten Hochburgen dieses Bildungsbürgertums. Generell genießen in Deutschland staatliche Einrichtungen und Stellen mehr Respekt als in den USA.
Die meisten kulturellen Einrichtungen und Angebote sind in Deutschland dem Staat, den Ländern oder den Kommunen unterstellt, das heißt sie werden von öffentlicher Hand eingerichtet, gefördert und finanziert.
Nur ein sehr geringer Teil der Kultur ist in Deutschland ausschließlich privat finanziert. Bis vor wenigen Jahren traf dies auch auf das Fernsehen in Deutschland zu. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zwar nicht vom Staat abhängig, unterliegt aber auch keinem direktem wirtschaftlichen Erfolgsdruck. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen steht genau wie viele andere öffentliche Einrichtungen unter dem Einfluß des Bildungsbürgertums. Die Programmgestaltung erfolgt auf Basis der Rundfunkstaatsverträge, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Pflicht der Grundversorgung und der Vielfalt einräumt. Fernsehen gilt in Deutschland als Medium und Faktor der Meinungsbildung und als Kulturgut, das besonderer ordnungspolitischer Vorgaben bedürfe und nicht dem freien Kräftespiel des Marktes überlassen werden könne, privater Rundfunk steht unter einer begrenzten Staatsaufsicht. So formulierte es die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in seinem 3. Rundfunkurteil vom 16. Juni 1981. Dieses Urteil zeigt, daß auch die Rechtsprechung, Gesetzgebung sowie vertragliche Regelungen von den Normen und Werten der stark in Deutschland und Europa verwurzelten Hochkultur geprägt sind.
Die Zulassung von kommerziellem Fernsehen in Deutschland impliziert die Abschwächung der traditionellen ständischen Hochkultur in Deutschland. Diese Medien stehen nicht mehr unmittelbar unter dem kulturellen Einfluß des Bildungsbürgertums in Deutschland. Mit der Einführung des kommerziellen Fernsehens setzten Tendenzen ein, die das Selbstverständnis dieser Hochkultur in Frage stellen. Doch auch private Anbieter sind in Deutschland dem Gemeinwohl verpflichtet und sind in gewissem Maße Regeln unterworfen, wie zum Beispiel die Gewährleistung der Vielfalt.
Auch in Deutschland setzt mit dem technischen Fortschritt eine Tendenz zu vielen Spartenprogrammen ein. Diese Entwicklung ist aber hauptsächlich von kommerziellen Anbietern vorangetrieben worden.
Die kulturelle Auseinandersetzung mit der „ Amerikanisierung ” des Fernsehens in Deutschland
Seit es im deutschen Fernsehen US-amerikanische Produktionen zu sehen gab, regelmäßig ab dem Beginn der 60er Jahre, ist die Diskussion über deren Wirkung nicht abgeflaut.
Im Zentrum der Diskussion stehen vor allem drei wesentliche Aspekte. Zum ersten, die Auswirkungen US-amerikanischer Produktionen auf das Programm selbst, die im vorangehenden Kapitel schon ausführlich dargelegt wurden. Des weiteren lebt die Diskussion über die Wirkungen dieser Produktionen auf das deutsche Publikum und nicht zuletzt auf das Amerikabild der Deutschen immer wieder auf. Inzwischen sind US-amerikanische Fernsehproduktionen ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms geworden. Sind sie damit aber auch zum Bestandteil der deutschen Kultur geworden? US-amerikanische Produktionen bilden einen Kontext zu deutschen bzw. europäischen Film- und Fernsehproduktionen, und stellen somit einen wichtigen Faktor der Interdependenz dar.
Die unterschiedlichen Entwicklungen des Mediums Fernsehen in den beiden betrachteten Staaten weisen darauf hin, daß diesem Medium jeweils eine völlig andere Rolle in der Gesellschaft zukommt. In der Bundesrepublik Deutschland wurde das Fernsehen von den Verantwortlichen als Medium für die Information, Bildung und Unterhaltung der Bevölkerung angesehen. Aber die Fernsehzuschauer sahen im Fernsehen weder ein kulturell wertvolles, noch verhängnisvolles Medium, sondern ein Unterhaltungsmedium (Schneider 1992). Erst mit der Einführung des dualen Systems bildeten sich zwei Auffassungen über das Fernsehen heraus. Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten streben weiterhin ein Programm an, das dem Auftrag der Grundversorgung und der Vielfalt gerecht wird. Dennoch müssen sich auch diese Sender am Publikum orientieren, denn auch die öffentlich-rechtlichen Sender sind von Einschaltquoten abhängig, wenn auch nicht in so hohem Maße wie die privaten Sender. Vor allem das Programm der privaten Sender in Deutschland wird mit amortisierten US-amerikanischen Produktionen gefüllt. Der Erfolg dieser Programme in Deutschland läßt sich mit der Theorie der „popular culture” plausibel erklären. Auch hier werden mit diesen Sendungen viele Menschen erreicht, da die Rezeptionsbedingungen so einfach wie möglich gestaltet wurden. Das traditionelle Bildungsbürgertum steht dieser Entwicklung seht kritisch gegenüber, denn durch diese Entwicklung wird sein Einfluß in der Gesellschaft geschwächt. „Amerikanisierung” - das heißt soviel wie die Errichtung einer weltweiten „popular culture”. Alle Länder im Einflußbereich der USA unterliegen der Gefahr oder der Chance, Teile dieser popular culture zu übernehmen. Die Gegner der sogenannten „Amerikanisierung” sehen darin die Gefahr eines kulturellen Identitätsverlustes für die jeweiligen Staaten . Diese Bedenken sind durchaus begründet und leiten für viele Länder einen Prozeß des Nachdenkens über die eigene Kultur ein. Oft wird mit gesetzlichen Regelungen versucht, den Anteil US-amerikanischer Sendungen möglichst gering zu halten. Auch in Deutschland herrscht bis heute eine unspezifische Angst vor nationaler und kultureller Einebnung durch die USA. Der kulturelle Einfluß der USA steigt mit der Verbreitung der Produkte dieses Landes, und zwar in Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt. Die Akzeptanz der US-amerikanischen Produkte ist in vielen Ländern sehr hoch, auch in Deutschland. Auf diese Art kann sich eine Annäherung der Kulturen vollziehen, ähnlich wie dies zu Beginn unseres Jahrhunderts in den USA geschehen ist. Auf dem Weg zu einer weltweiten Verständigung wird es nicht ausbleiben, daß sich die verschiedenen Kulturen weiter annähern und sich auf gemeinsame Kommunikationsbedingungen einlassen.
Die Bedeutung ökonomischer Einflußgrößen für die Entwicklung des deutschen Fernsehens
Die dargelegten gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen in den Ver- einigten Staaten von Amerika und in Deutschland haben eine Entwicklung im Sinne der „Amerikanisierung“ des deutschen Fernsehens erst ermöglicht. Jedoch sind die maßgeblichen Ursachen für einen Einfluß Amerikas auf das deutsche Fernsehen in ökonomischen Zielen beider Staaten zu suchen, die im folgenden analysiert werden sollen.
Aus wirtschaftlicher Perspektive stehen sich in diesem Kontext zwei Seiten gegenüber: zum einen das Interesse amerikanischer Produzenten, ihre Produkte auch in Deutschland zu vermarkten, und andererseits die Nachfrage deutscher Programmveranstalter nach amerikanischen Programmteilen.
Ö konomische Ziele amerikanischer Programmveranstalter
Das in den USA praktizierte Modell des kommerziellen Rundfunks ist marktorien- tiert und zielt somit auf Gewinnmaximierung ab. Dabei steht der Wettbewerb um hohe Einschaltquoten im Vordergrund, um die existentiellen Werbeeinnahmen zu sichern und langfristig hohe Marktanteile zu forcieren. US-amerikanische Net- works verfolgen dabei von vornherein Marktstrategien des internationalen Marke- ting, die sich auf die Produkt-, Entgelt-, Distributions- sowie die Kommunikations- politik auswirken.
Im Hinblick auf die Amerikanisierung des deutschen Fernsehmarktes lassen sich verschiedene Dimensionen beobachten: begünstigt durch die Weiterentwicklungen der technischen Übertragungsmöglichkeiten sind amerikanische Programme heute über Kabel und Satellit direkt in deutschen Haushalten empfangbar. Dazu gehören beispielsweise CNN-International oder Cartoon Network (Gershon 1997). Andere Programme werden für die europäische Ausstrahlung modifiziert, so zum Beispiel MTV Europe oder NBC Europe. Des weiteren ist es, wie in dieser Arbeit bereits ausführlich dargelegt wurde, inzwischen als Selbstverständlichkeit anzusehen, daß deutsche Programmanbieter komplette US-amerikanische Sendungen bzw. Sen- dungskonzepte aufkaufen. Insbesondere mit Serien, die sich in den Vereinigten Staaten längst amortisiert haben, können Produzenten durch eine internationale Vermarktung immer noch Gewinne erzielen, ohne daß ihnen zusätzliche Produktionskosten entstehen.
Eine weitere Möglichkeit der Beeinflussung nehmen amerikanische Unternehmen durch direkte Beteiligungen an deutschen Programmveranstaltern wahr, so auch der Time Warner Konzern, der am Nachrichtenkanal n-tv beteiligt ist und der Disney-Konzern, der Anteile an Super-RTL besitzt (Wenzel 1998). Auf die interationalen Marketingstrategien US-amerikanischer Unternehmen soll im Anschluß an eine Betrachtung der wirtschaftlichen Ziele der deutschen Filmund Fernsehindustrie eingegangen werden.
Ö konomische Ziele deutscher Programmveranstalter
Vor dem Hintergrund einer zunächst öffentlich-rechtlichen Organisation des Rundfunks in Deutschland waren die Programme nicht auf Wirtschaftlichkeit, sondern vielmehr auf die Erfüllung des Grundversorgungsauftrags ausgerichtet. Eine Konkurrenz um Zuschauerzahlen und Werbekunden trat erstmals mit dem Sendebeginn des ZDF 1963 ein. Und erst durch die Zulassung des dualen Systems, mit der Entstehung neuer privater Sender, wurde die Mischfinanzierung aus Ge- bühren und Werbeeinnahmen zum Problem. Denn infolge der im Rundfunkstaats- vertrag festgelegten Werberichtlinien verloren die öffentlich-rechtlichen Sendean- stalten einen erheblichen Anteil ihrer Werbeeinnahmen an private Anbieter. 1996 gingen lediglich 9,4 Prozent der Nettowerbeumsätze an die Öffentlich-Rechtlichen, während private Veranstalter insgesamt 90,6 Prozent der Nettowerbeumsätze ver- buchen konnten (Wenzel 1998). Als Konsequenz dieser Entwicklung sind ARD und ZDF heute zu Kosteneinsparungen und Reformen gezwungen, was sich letzt- lich aus Sicht des Zuschauers negativ auf die Programmqualität auswirken muß. Heute müssen sich die öffentlich-rechtlichen Anstalten ebenso wie die privaten Anbieter am Durchschnittsgeschmack des Publikums ausrichten, um ihre - wenn auch stark zurückgegangenen - Werbeeinnahmen zu sichern. Wie in den USA gewinnen damit in Deutschland Programme, die vornehmlich Unterhaltungsfunk- tion besitzen, an Bedeutung, während die Informations- und Bildungsfunktion der Programme zurückgedrängt wird. So findet man im Programm von ARD und ZDF inzwischen ähnliche Formate wie bei den Privaten - beispielsweise billig produzier- te Soap-Operas oder Nachmittagstalkshows.
Mit dem seit den 80er Jahren in Deutschland fortschreitenden Prozeß der Kommerzialisierung schien die Alternative, die Ausstrahlungsrechte für amerikanische Produktionen einzukaufen, diese zu synchronisieren und in Deutschland auszustrahlen immer verlockender. Sowohl den öffentlich-rechtlichen als auch insbesondere den privaten Veranstaltern bot sich damit die Chance, eigene Produktionskosten einzusparen und kostengünstig Sendezeit zu füllen. Außerdem versuchen deutsche Programmveranstalter durch die Imitation erfolgreicher, amerikanischer Sendungsformate auch hier Profit zu machen.
Der strukturelle Vorsprung, den die USA durch den von Anbeginn kommerziell organisierten Rundfunk genießen, ermöglicht es, Nutzen aus den in Deutschland existierenden Produktionsdefiziten zu ziehen.
1988 lag der Anteil amerikanischer Produktionen an den Programmen der EGLänder bei 24 Prozent, während in Amerika nur zwei Prozent des Fernsehprogramms aus Importquellen stammten (Kallas 1992). Über ihr weltweit ausgerichtetes Verleih- und Vertriebsnetz erreichen die USA nach einer Schätzung der Motion Picture Association of America (MPAA) jährlich Einnahmen von 7,5 Milliarden Dollar für TV- und Filmproduktionen (Gershon 1997).
„ Windowing “ und Preisdiskriminierung als Beispiele für internationale Marketingstrategien der USA
Der Erfolg amerikanischer Sendungen und Programmformate läßt sich am einfach- sten durch den Blick in eine aktuelle Fernsehzeitung ablesen. Hinter der Durchset- zung dieser Produkte steht jedoch auch ein fundierter Marketingmix. Zwei Voraussetzungen sind für das internationale Marketing von Fernseh- und Filmprodukten von essentieller Bedeutung: zum einen die Einordnung dieser Produkte als öffentliche Güter, d.h. die Nutzung des Gutes durch jeden weiteren Konsumenten beeinflußt die Nutzung des Gutes durch die anderen Nutzer nicht. Außerdem sind die Produktionskosten von Fernseh- und Filmprodukten fix, d.h. mit zunehmenden Zuschauerzahlen sinken die Produktionskosten pro Zuschauer. Für den Export von Film- und Fernsehproduktionen verbleiben lediglich Distribu- tions- und gegebenenfalls Synchronisationskosten. Somit ist es billiger, ein einzel- nes Produkt für die weltweite Vermarktung herzustellen als separate Produkte für individuelle Märkte zu erarbeiten.
Amerikanische Marketingstrategien sind folglich auf die Erhöhung der Publikums- zahlen sowie die optimale Ausnutzung der verschiedenen Vertriebskanäle ausge- richtet.
Zu den von den USA praktizierten internationalen Marketingstrategien gehört auch das sogenannte „Windowing“. Diese strategische Vorgehensweise bezeichnet die gewinngerichtete Beeinflussung von Distributionszeitpunkten bzw. -zeiträumen und Distributionskanälen für Fernseh- und Filmprodukte. Nachdem ein Kinofilm beispielsweise im Mutterland USA in den ersten vier Monaten gelaufen ist, kommt er erst vier bis 18 Monate nach der Erstaufführung in den USA in deutsche Kinos. In den US-amerikanischen Videotheken erscheint der Film sechs bis 30 Monate, in Deutschland neun bis 24 Monate nach der Erstaufführung (Gershon 1997). Gleichsam werden das Senden des Films im Kabelfernsehen und in den öffentlichen Fernsehstationen, sowie der Zeitpunkt der Amortisation eines Produktes koordiniert.
Der Preis als Steuerinstrument des Marktes wird durch Angebot und Nachfrage beeinflußt. Die Strategie des „Windowing“ ermöglicht deshalb eine zielgerichtete Entgeltpolitik, das sogenannte „Pricing“. Ein Element des „Pricing“ ist die Preisdis- kriminierung. Dabei nutzen die Produzenten den Vorteil, ihr Produkt an verschie- dene Kunden zu unterschiedlichen Preisen zu verkaufen. Der Preis richtet sich dabei nach der Zahlungsfähigkeit und -willigkeit des Importkunden sowie den nationalen Produktionskosten der Importnation. Je mehr private Anbieter es in einem Importland gibt, desto höher können die Preise für ein und dasselbe Produkt angesetzt werden. US-amerikanische Anbieter versuchen dabei immer unter den Eigenproduktionskosten des Kunden zu liegen und gleichzeitig günstigere Kondi- tionen zu bieten als Konkurrenten des jeweiligen nationalen Marktes. Die Anzahl und der Preis der zu verkaufenden Fernsehstunden ergeben sich aus dem Zusam- menspiel mehrerer Faktoren, zu denen die Größe der potentiellen Zielgruppe, die gesamten verfügbaren ökonomischen Ressourcen, die Sprache, das Pro-Kopf-Ein- kommen und die Stufe der Kommerzialisierung im jeweiligen Importland gehören (Sepstrup 1990).
Im Jahr 1995 betrugen die amerikanischen Spielfilmumsätze insgesamt 18,5 Milliarden Dollar. Davon wurden allein 43 Prozent auf dem Auslandsmarkt erwirt- schaftet. Die Einnahmen aus dem Kinoverleih waren auf dem Binnenmarkt der USA und auf dem Auslandsmarkt anteilig gleich mit jeweils 2,5 Milliarden Dollar. Auffällig ist hingegen die Statistik zum Profit-Window Fernsehen, das im Jahr 1995 insgesamt 1,8 Milliarden Dollar Umsatz einbrachte. Mit 57 Prozent stammt hier der Hauptanteil der Einnahmen aus Importerlösen. Relativ gering sind die An- teile des Auslandsmarktes auf dem Pay-TV-Sektor. Da dieser außerhalb der Verei- nigten Staaten noch weitaus weniger etabliert ist, belaufen sich die Umsätze „nur“ auf 515 Millionen Dollar, was einem Anteil von 33 Prozent des gesamten Pay-TV- Umsatzes entspricht (Artopé 1995).
Die Entwicklung des Film- und Fernsehmarktes in Europa hat zu einer deutlichen Abhängigkeit der Programmveranstalter von den Zulieferungen US-amerikanischer Produzenten geführt. Jedoch häufen sich seit einigen Jahren die Diskussionen um die Wirkungen der aus Amerika importierten Programme. Die Förderung nationaler Programme sowie der Programmaustausch innerhalb Europas stehen heute im Zentrum der europäischen Film- und Fernsehpolitik.
Der deutsche Fernsehmarkt im Kontext einer „ Europäisierung “
Weltweit hat das Fernsehen stark an Bedeutung gewonnen, es gilt heute als wichtigster Einflußfaktor auf die sogenannte „popular culture“ (Gershon 1997). Die Produktionen der amerikanischen Film- und Fernsehindustrie zielen auf eine breite Publikumsmasse ab; sie entstehen unter der Prämisse, daß im Anschluß an die nationale Vermarktung zusätzlich Einnahmen durch ein entsprechendes inter- nationales Marketing erfolgen.
Made in Hollywood gilt längst als Gütezeichen. Dennoch wurde seitens der Importländer Kritik laut; man befürchtet, daß die kulturell einseitig geladenen Programme der USA nationale Identitäten gefährden und eigenständige Kulturen verdrängen könnten. Um diese Entwicklung zu verhindern und die Abhängigkeit von Amerika im Fernsehbusiness zu schwächen, sollen die Förderung der audiovisuellen Produktionsindustrie und die Eröffnung eines europäischen Binnenmarktes verstärkt Anreize für innereuropäische Produktionen schaffen.
Erste Maßnahmen wurden diesbezüglich seitens der Europäischen Gemeinschaft in den 80er Jahren unternommen. Im Juni 1984 legte die damalige EG-Kommission den Bericht „Fernsehen ohne Grenzen - Grünbuch über die Errichtung des Gemeinsamen Marktes für den Rundfunk, insbesondere über Satellit und Kabel“ vor. Diesem Bericht folgten diverse Beschlüsse des Europäischen Parlaments. Im März 1989 traf der Europarat das Übereinkommen über grenzüberschreitendes Fernsehen, und im Oktober des gleichen Jahres erfolgte auf einem Treffen der Außenminister die Verabschiedung der sogenannten EG-Fernsehrichtlinie, der „Richtlinie des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungs- vorschriften der Mitgliedsstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit“ [auch „European Television Without Frontiers Directive (89/552)“]4.
Die EG-Fernsehrichtlinie von 1989
Auf dem Weg der „Europäisierung“ sollen mit Hilfe der Fernsehrichtlinie im wesentlichen zwei Ziele unter den zwölf Mitgliedsstaaten durchgesetzt werden: einerseits die Schaffung eines einheitlichen europäischen Fernsehmarktes, indem Probleme der grenzüberschreitenden Übertragung beseitigt werden; zweitens sollen Anreize für die Bildung europäischer Kooperationen geschaffen werden. Den Erfolg der Direktive 89/552 sollen verschiedene Maßnahmen ermöglichen: An erster Stelle steht das Verbot, die Rezeption von Programmen anderer Mitgliedstaaten einzuschränken oder eine Distribution über Kabel zu verhindern. Außerdem sind Regeln zur Angleichung der nationalen Organisation der Fernseh- werbung aufgestellt worden. So dürfen beispielsweise maximal 15 Prozent der gesamten Sendezeit täglich und maximal 20 Prozent der Sendezeit stündlich für Werbung genutzt werden. Tabakwerbung und Werbung für bestimmte Arzneimittel sind verboten. Die Programme dürfen sich nicht gegen die Entfaltung von Minder- heiten richten. Sollte es dennoch zu einer Verletzung individueller Interessen kom- men, ist der Betroffene berechtigt, darauf zu reagieren. Die Programmveranstalter sind angehalten, die Mehrheit der verfügbaren Sendezeit für europäische Produk- tionen bereitzustellen, sofern dies möglich ist; ausgenommen davon sind Nach- richten, Sport, Spielshows, Werbung und Teletext. Für die Kontrolle der Einhal- tung dieser Vorgabe ist die Europäische Komission zuständig. Zehn Prozent der Sendezeit müssen, wenn möglich, mit Inhalten unabhängiger europäischer Pro- duzenten ausgefüllt werden. Die Zeitspanne zwischen der Erstausstrahlung eines Filmes und der Ausstrahlung im Fernsehen soll zwei Jahre betragen. Für die US-amerikanische Film- und Fernsehindustrie bedeuten insbesondere die Regelungen zum Anteil europäischer Produktionen am Gesamtprogramm eine Bedrohung ihrer Exporterlöse. Anläßlich der GATT-Verhandlungen von 1993 ver- suchten sie deshalb, die Film- und Fernsehindustrie ins GATT-Abkommen einzu- beziehen. Da die europäischen Subventionssysteme für den freien Austausch der Handelsware Film auf dem internationalen Markt wettbewerbsverzerrend gewesen wären, hätte diese Entscheidung für die europäische Film- und Fernsehindustrie einen herben Rückschlag bedeutet. Das konnte die EU jedoch verhindern, indem sie die Ware Film schließlich als Kulturgut definierte und an ihrer Position festhielt, alle kulturellen Angelegenheiten aus dem GATT-Abkommen auszuschließen. Das Programm 89/552 der EU soll bis 30. Dezember 2000 in allen Mitgliedstaaten implementiert sein. Über die Einhaltung und die Ergebnisse der Direktive wacht die Europäische Kommission. Zwischenberichte sind beispielsweise im Internet auf den Seiten der Europäischen Union abrufbar.
Die Europäische Union fördert weiterhin bestimmte Film- und Fernsehaktivitäten, die zu einer Stärkung des europäischen Marktes beitragen können. Mit dem Pro- gramm MEDIA-I von 1991 bis 1995 sollte beispielsweise die Produktion und der Vertrieb europäischer Produktionen weiterentwickelt werden. Aufgrund der zu- nehmenden Abhängigkeit der europäischen Filmindustrie von ausländischen Im- portprodukten willigte die Europäische Kommission trotz Kritik an den Ergebnis- sen der Initiativen von MEDIA I in eine Verlängerung des Programms um fünf Jahre ein. MEDIA II, das bis ins Jahr 2000 ausgelegt ist, zielt insbesondere auf die Bereiche Ausbildung, Entwicklung und Vertrieb ab (vgl. Hertel 1997, 68-74).
„ Europäisierung “ versus „ Amerikanisierung “
Mit Maßnahmen wie den Bestimmungen der „Fernsehrichtlinie“ wollen die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten den Prozeß der „Europäisierung“ des Filmund Fernsehmarktes in Europa vorantreiben, die europäische Integration fördern und analog dazu eine „Amerikanisierung“ verhindern.
Aber oft wird unter „Europäisierung“ in dem Zusammenhang einfach die Negation der „Amerikanisierung“ verstanden und damit die bewußte Abwendung von der kommerziellen Struktur des Fernsehens und den damit verbundenen Auswirkungen auf das Programm. Eine „Europäisierung“ kann sich jedoch nur im Rahmen der Deregulierung und Kommerzialisierung des Film- und Fernsehmarktes vollziehen. Veränderungen in der Marktstruktur - wie beispielsweise die Entstehung von Networks, an denen auch amerikanische Unternehmen beteiligt sind - werden zwangsläufig nach dem amerikanischen Vorbild erfolgen. Auch in Zukunft werden europäische Programmveranstalter auf Importe angewiesen sein.
Kallas (1992) warnt außerdem davor, zwischen der „trivialen Amerikanisierung“ und der „elitären Europäisierung“ zu unterscheiden. Viele gute und niveauvolle amerikanische Produktionen würden dabei völlig übersehen und der Bedarf an Trivialität und Unterhaltung des europäischen Publikums unterschätzt.
Erfolgsfaktoren auf dem Weg zum einheitlichen europäischen Fernsehmarkt
Für den Erfolg europäischer Produktionen auf dem nationalen und internationalen Markt reicht es nicht aus, den Anteil amerikanischer Produktionen per Gesetz ein- zuschränken. Im Gegenzug müssen europäische Produktionen gestärkt werden. Produktionsfirmen der Vereinigten Staaten besitzen deutliche Vorteile durch hohe Produktionsbudgets und das weiträumig organisierte Verleih- und Vertriebsnetz. Durch Koproduktionen können deutsche und europäische Produzenten die Nach- teile, die sich aufgrund begrenzter Produktionsbudgets ergeben, zum Teil ausglei- chen. Denn damit reduzieren sich die Produktionskosten für die einzelnen an der Produktion beteiligten Partner. Als Nebeneffekt kann daraus auch eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Produzenten, Regisseuren und Schauspielern erwach- sen. Im Kooperationsprozeß ist es sehr wichtig, die Erfahrungen amerikanischer Firmen zu nutzen. Dazu gehört beispielsweise auch die Einsicht, sich von der bisher üblichen einfachen Form der Verantwortungsteilung zu trennen. Die Ver- antwortung und Finanzierung eines Projektes sind an eine Nation bzw. eine Produktionsfirma zu übergeben. Aufgabe der Produktionsfirma ist es dann, ein Produkt zu schaffen, das eher auf eine gesamteuropäische Zielgruppe abgestimmt ist als nur auf ein einzelnes nationales Publikum. Schließlich darf der Erfolg - zumindest eines qualitativ als gut einzustufenden Produktes - nicht mehr an der unzureichenden Promotion scheitern. Die Werbung für europäische Film- und Fernsehprodukte muß auf ein deutlich höheres Niveau angehoben werden, und neben dem Verleih- und Vertriebsnetz der Vereinigten Staaten muß auch in Europa ein komplexes Vertriebsnetz entstehen, über das die Produkte international ver- marktet werden können.
Dennoch reichen diese Verbesserungen organisatorischer Art nicht aus. Denn als Haupthindernis der Distribution europäischer Film- und Fernsehproduktionen wer- den immer noch die Synchronisation oder die Untertitelung gesehen. In den Ländern Europas wird das Sprachproblem sehr unterschiedlich gehandhabt, wobei insbesondere die Kosten für einen derartigen Mehraufwand ein wesentliches Krite- rium sind, wenn es um die Entscheidung für oder gegen den Import geht. In Deutschland werden importierte Filme traditionsgemäß synchronisiert. Die Abkehr vom System der Synchronisation hin zur Untertitelung von Filmen würde wirt- schaftlich ein sehr hohes Risiko darstellen, abgesehen davon, daß die gesamte Syn- chronisationsbranche durch eine solche politische Entscheidung zerstört würde. In Frankreich, Belgien und den Niederlanden hingegen ist die Untertitelung importier- ter Filme üblich. Als drittes Beispiel sei in diesem Zusammenhang Großbritannien zu nennen. Fremdsprachige Filme haben nämlich kaum eine Chance, überhaupt in britische Kinos oder ins Fernsehen zu kommen. Eine professionelle Synchronisa- tions- oder Untertitelungsbranche existiert nicht; bei Bedarf werden diese Aufgaben an Firmen außerhalb Großbritanniens in Auftrag gegeben.
Um den innereuropäischen Programmaustausch dennoch zu ermöglichen, wurde mit dem BABEL-Projekt, das zum MEDIA-Programm der EU gehört, eine Initiative zur Förderung von Untertitelungen und Synchronisationen ins Leben gerufen.
Doch auch für den Export europäischer Filme in die Vereinigten Staaten scheint die Sprache eine kaum zu überwindende Barriere zu sein, da die Akzeptanz von Synchronisationen dort sehr gering ist. Dieser Nachteil kann vielleicht nur durch die Überzeugung durch die Qualität der Produktionen und durch verstärkte PRArbeit und Marketingaktivitäten ausgeglichen werden.
Die Macht auf dem Medienmarkt
In der Diskussion um den Einfluß auf die Film- und Fernsehindustrie Europas geht es inzwischen nicht mehr allein um den Einfluß der USA. Die globale Arena, so die Argumentation, würde heute nicht mehr durch die US-amerikanische Macht son- dern durch eine immer stärkere Position transnationaler Medienkonzerne dominiert.
Diese transnationalen Medienkonzerne zeichnen sich dadurch aus, daß sämtliche strategischen Entscheidungen und die Zuteilung der Ressourcen streng nach ökonomischen Zielen erfolgen. Im Hinblick auf die Erschließung von Absatz- märkten nutzen sie den Vorteil aus, auf Märkten einzusteigen, die dem Heimat- markt ähnlich sind. Die Business Strategy und die Corporate Culture des Unternehmens spiegeln dabei oft die Ideen der Gründungsperson wider (Gershon 1997).
Zu den gegenwärtig führenden Konzernen gehören Time Warner mit Hauptsitz in den USA, die in Deutschland beheimatete Bertelsmann AG, der japanische Konzern Sony, die US-amerikanische Walt Disney Corporation und News Corporation Limited mit Hauptsitz in Australien.
Über die politischen Einflußmöglichkeiten dieser transnationalen Konzerne gibt es gegensätzliche Auffassungen. Auf der einen Seite argumentiert zum Beispiel der amerikanische Medienkritiker Ben H. Bagdikian (1990), daß marktdominante Kon- zerne im Medienbereich einen wesentlichen Einfluß auf die veröffentlichten Nachrichten und Informationen, auf die öffentliche Meinung, die Populärkultur und politische Einstellungen hätten. Diese Konzerne hätten gleichzeitig einen achtbaren staatlichen Einfluß, da sie die Wahrnehmung des öffentlichen Lebens seitens des Publikums einschließlich der Wahrnehmung von Politik und Politikern beeinflußten.
Anders argumentiert Richard A. Gershon (1997), Professor an der Ohio University in den USA. Transnationale Medienkonzerne, die weltweit Investitionen tätigen, wie beispielsweise die Bertelsmann AG, könnten gar keinen Einfluß nehmen, da sie in sich zu divers strukturiert sind. Die stark profitorientierte Unternehmensstrategie würde eine kritische Selektion bestimmter Medienwerke außerdem nicht erlauben.
Wenn man die Sichtweise Gershons zugrunde legt, ergibt sich allerdings ein weite- res Problem. Da transnationale Medienunternehmen ihren wirtschaftlichen Inter- essen folgend mit ihren Produkten auf die Profitsteigerung und eine Erhöhung des Marktpotentials ausgerichtet sind, gibt es für sie keine Schranken hinsichtlich der Produktinhalte. „We’re only giving the public what it wants.“ (Wir geben der Öffentlichkeit nur das, was sie verlangt), lautet in dem Moment die Rechtfertigung der Produzenten. Moralische Restriktionen gelten nicht. Bisher ist es nicht ge- lungen, Richtlinien auf internationaler Ebene zu finden, die die Gefahren der Veröf- fentlichung bestimmter Inhalte mindern könnten. Ein Ausweg, den beispielsweise die Bertelsmann-AG verfolgt, sind selbstauferlegte Beschränkungen.
Theoretische Ansätze - Amerikas Einfluß auf die Globalisierung der Kommunikation
Aufgrund der Konkurrenz zwischen amerikanischen Unternehmen und transnatio- nalen Medienkonzernen gerät die Auffassung von der „Amerikanisierung“ im Me- dienbereich zunehmend in die Kritik. Während Hollywood ein wichtiger Produzent von Film- und Fernsehunterhaltungsprodukten bleibt, sind viele Hollywood- Studios inzwischen im Besitz transnationaler Medienkonzerne. Die weltweite Distribution und der Austausch von Medienprodukten wurden und werden stetig durch den rasanten technischen Fortschritt begünstigt. Gleichzeitig rückten aber Fragen um die Wirkungen dieser Entwicklung ins Zentrum des wissenschaftlichen Forschungsinteresses. Seit den 60er Jahren, als unter anderem der kanadische Medienphilosoph Marshall McLuhan seine Theorie vom „globalen Dorf“ in die Diskussion um eine Globalisierung der Kommunikation brachte, fand eine kontinuierliche theoretische Aufarbeitung dieses Phänomens durch die Kom- munikationswissenschaft statt. Die maßgeblichen Etappen und Positionen dieses Aufarbeitungsprozesses sollen im folgenden skizziert werden.
Der „ one-way-flow of information “
Ein Argument gegen die Globalisierung der Kommunikation ist bis heute die Beobachtung, daß sich Kommunikationsprozesse global ungleich entwickeln. Man spricht dabei vom sogenannten „one-way-flow of information“, dem einseitig gerichteten Informationsfluß, von dem einige Partner mehr, andere hingegen weniger bzw. gar nicht profitieren können. Dabei geraten einige Regionen in der Welt zudem in ein Abhängigkeitsverhältnis von den dominierenden Nationen, was einer wirklichen Globalisierung der Kommunikation entgegensteht.
Die Theorie des „ Kulturellen Imperialismus “
Diese neue Art der Abhängigkeit war auch Grundlage für die Theorie des „Kulturellen Imperialismus“. Sie beklagt, daß westliche (insbesondere amerikanische) politische und militärische Interessen die globale Kommunikation dominieren, und daß traditionelle Kulturen infolge des Eindringens westlicher Werte zurückgedrängt werden.
Ein Hauptvertreter dieser Theorie in den späten 60ern sowie den 70er Jahren war Herbert Schiller. Die Theorie des „kulturellen Imperialismus“ hatte einen starken Einfluß auf den weiteren kommunikationswissenschaftlichen Forschungsprozeß, sie war allerdings bei weitem nicht unumstritten. Thompson, ein amerikanischer Soziologie, kritisiert mehrere Schwachstellen der Theorie (vgl. Thompson 1995). Hauptsächlich stellt er die von Schiller zugrunde gelegten Machtstrukturen in Frage. Nach dem zweiten Weltkrieg sei, argumentiert Thompson, die ökonomische Macht nicht allein auf die Vereinigten Staaten konzentriert gewesen, vielmehr müßten auch die politischen und symbolischen Konflikte während der Ära des Kalten Krieges berücksichtigt werden. Wirtschaftlich hätte sich in den vergangenen Jahren eine multipolare Entwicklung vollzogen, bei der auch Europa (ins- besondere Deutschland), Japan und die industrialisierten Länder Südost-Asiens an Bedeutung gewannen. Der Kollaps des kommunistischen Regimes in Osteuropa und die Zerschlagung der Sowjetunion hätte zu einer neuen geopolitischen Ord- nung geführt. Neue Formen symbolischer Macht, die unter anderem aus nationali- stischen Tendenzen und fundamentalistischen Religionen resultieren könnten, spielten gegenwärtig weltweit eine wichtige Rolle, wenn es um die ökonomische Stellung am Weltmarkt geht.
Auch Schiller selbst schätzt ein, daß seine Theorie des „Kulturellen Imperialismus“ in ihrer ursprünglichen Form heute nicht mehr haltbar ist (Thompson, 1995). Der „amerikanische kulturelle Imperialismus“ hätte sich in eine kulturelle Dominanz der transnationalen Konzerne gewandelt. Während sich die ökonomischen Strukturen des Marktes internationalisiert hätten, bleibe die kulturelle Dominanz jedoch ameri- kanisch, wenn es um die Form und Inhalte von Medienprodukten geht.
Fazit
Betrachtet man das Programmangebot deutscher Fernsehsender, so läßt sich der starke Anteil amerikanischer Sendungen bzw. imitierter amerikanischer Formate nicht leugnen.
Die Programmanalyse hat gezeigt, das besonders die privaten Anbieter in Deutschland zu einer „Amerikanisierung” des deutschen Fernsehalltags führen. Die Dominanz der US-amerikanischen Programmangebote im deutschen Fernsehen zieht Konsequenzen für die kulturelle Entwicklung Deutschlands nach sich. Durch den Einzug des US-amerikanischen Phänomens der „popular culture” in die Wohnzimmer der Bürger wird das Selbstverständnis der traditionellen Hochkultur in Deutschland angegriffen und geschwächt. Die „popular culture”, die oft unmittelbar mit „Amerikanisierung” der Kultur gemeint ist, wird von den meisten Ländern als Gefährdung der eigenen kulturellen Identität betrachtet. Sie bietet aber gleichzeitig eine Basis für die Kommunikation unterschiedlicher Kulturen, die als Chance zur besseren Verständigung betrachtet werden kann.
Aus wirtschaftlicher Perspektive wird die Dominanz US-amerikanischer Unter- nehmen auf dem internationalen Film- und Fernsehmarkt gegenwärtig durch den zunehmenden Einfluß transnationaler Medienkonzerne relativiert. Die USA als tra- ditionelles Exportland von Film- und Fernsehprodukten werden dennoch versu- chen, ihre Marktposition zu behaupten. Der Markteinstieg gestaltet sich für Konkurrenten durch den Entwicklungsvorsprung US-amerikanischer Unternehmen schwierig, jedoch nicht unüberwindbar. Viele Nationen fürchten einen zu starken Einfluß amerikanischer Medienprodukte auf nationale Kulturen und haben deshalb Maßnahmen eingeleitet, um das Eindringen westlicher, insbesondere amerikani- scher Werte und die Verdrängung nationaler Identitäten zu verhindern. Auch seitens der Europäischen Union erfolgen Bemühungen, europäische Film- und Fernsehproduktionen zu fördern.
Es gilt zu beobachten, ob die Internationalisierung des Marktes eine zukünftige kulturelle Dominanz der USA verhindern kann.
Literaturverzeichnis
Artopé, Alexander / Axel Zerdick u.a. (1995): Die Folgen der Media-Mergers in den USA. Die neue Ausgangssituation auf dem deutschen und europäischen Fernsehmarkt, Berlin / München, in: Carlos Hertel: Die Wa(h)re Kunst: Ansätze zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Filmindustrie, Potsdam: 92
Baltes, Martin / Fritz Böhler / Rainer Höltschl / Jürgen Reuß (Hg.) (1997): Medien verstehen. Der McLuhan-Reader, Mannheim
Browne, Nick (1994): American Television. New Directions in History and Theory, Chur
Donsbach, Wolfgang / Rainer Mathes (1994): Rundfunk, in: Elisabeth Noelle-Neumann /
Winfried Schulz / Jürgen Wilke (Hg.): Fischer Lexikon Publizistik
Massenkommunikation, Frankfurt/M.: 475-518
Fluck, Winfried (1998): „Amerikanisierung“ der Kultur. Zur Geschichte der amerikanischen Populärkultur, in: Harald Wenzel (Hg.): Die Amerikanisierung des Medienalltags, Frankfurt/ M. / New York
Gangloff, Tilmann P. (Hg.) (1994) / Stephan Abarbanell: Liebe, Tod und Lottozahlen. Fernsehen in Deutschland: Wer macht es? Was bringt es? Wie wirkt es?, Hamburg / Stuttgart Gellner, Winand (Hg.) / Werner Bläser / Dieter Stolte (1989): Europäisches Fernsehen - American Blend?: Fernsehmedien zwischen Amerikanisierung und Europäisierung, Berlin Gershon, Richard A. (1997): The Transnational Media Corporation. Global Messages and Free Market Competition, Mahwah, New Jersey
Göttlich, Udo (1992): Farbinseln im schwarz-weißen Meer. Zum Wandel der televisuellen Repräsentationstechnik durch die Einführung des Farbfernsehens in der Bundesrepublik Deutschland 1967-1978, in: Irmela Schneider (Hg.): Amerikanische Einstellung. Deutsches Fernsehen und US-amerikanische Produktionen, Heidelberg: 39-60 Gramberger, Marc R. (1994): Wider den häßlichen Deutschen. Die verständnisorientierte Öffentlichkeitsarbeit der Bundesrepublik Deutschland in den USA, Münster / Hamburg Hallenberger, Gerd (1992): „Amerikanisierung“ versus „Germanisierung“. Quizsendungen im deutschen Fernsehen - eine „mittelalterliche“ Programmform?, in Irmela Schneider (Hg.): Amerikanische Einstellung. Deutsches Fernsehen und US-amerikanische Produktionen, Heidelberg: 81-95
Hamm, Ingrid (1995): Bericht zur Lage des Fensehens. Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Güthersloh
Heinrich, Jürgen (1994): Medienökonomie. Band 1: Mediensystem, Zeitung, Zeitschrift,
Anzeigenblatt, Opladen
Hertel, Carlos (1997): Die Wah)re Kunst: Ansätze zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Filmindustrie, Potsdam
Hoffmann-Riem, Wolfgang (1981): Kommerzielles Fernsehen. Rundfunkfreiheit zwischen ökonomischer Nutzung und staatlicher Regelungsverantwortung: das Beispiel USA, Baden- Baden
Jakobeit, Cord / Ute Sacksofsky / Peter Welzel (Hg.) (1992): Die USA am Beginn der neunziger Jahre, Opladen
Kallas, Christina (1992): Europäische Film- und Fernsehproduktionen, Baden-Baden
Kleinsteuber, Hans J. (1992): Die Soap Opera in den USA: Ökonomie und Kultur eines populären Mediums, in: Irmela Schneider (Hg.): Amerikanische Einstellung. Deutsches Fernsehen und US-amerikanische Produktionen, Heidelberg: 136-155
McLuhan, Marshall (1995): Die Gutenberg-Galaxis: das Ende des Buchzeitalters, Bonn, Paris
Ludes, Peter (1992): Von der gemeinwohlorientierten Dienstleistung zum Geschäft mit Showeinlagen. Fernsehnachrichtensendungen in den USA und in der Bundesrepublik, in: Irmela Schneider (Hg.): Amerikanische Einstellung. Deutsches Fernsehen und USamerikanische Produktionen, Heidelberg: 61-80
McLuhan, Marshall (1995): Die Gutenberg-Galaxis: das Ende des Buchzeitalters, Bonn / Paris
Noelle-Neumann, Elisabeth / Winfried Schulz / Jürgen Wilke (Hg.) (1996): Fischer Lexikon. Publizistik. Massenkommunikation, Frankfurt/M.
Schneider, Irmela (1992): Amerikanische Einstellung. Deutsches Fernsehen und US- amerikanische Produktionen, Heidelberg
Sepstrup, Preben (1990): Transnationalization of Television in Western Europe. Academic
Research Monograph # 5, London, in: Richard A. Gershon: The Transnational Media Corporation. Global Messages and Free Market Competition, Mahwah, New Jersey: 39-40 Sonnert, Gehard (1992): Berufsringen - eine neue Arena für die Reproduktion politischer und kultureller Werte, in: Crod Jakobeit / Ute Sacksofsky / Peter Welzel (Hg.): Die USA am Beginn der neunziger Jahre, Opladen: 77-93
Thompson, John B. (1995): The Media and Modernity. A Social Theory of the Media, Stanford, California
Wells, Alan (1996): World Broadcasting: A Comparative View, Norwood, New Jersey
Wenzel, Harald (Hg.) (1998): Die Amerikanisierung des Medienalltags, Frankfurt/M. / New York
Westphal, Siegrid / Joachim Arenth (1995): Uncle Sam und die Deutschen. 50 Jahre deutsch- amerikanische Partnerschaft in Politik, Wirtschaft und Alltagsleben, München / Landsberg
Winckler, Klaus (1984): Kommerzielles Fernsehen in der Medienkonkurrenz. USA - Analyse eines Unterhaltungsoligopols, Berlin
Zielinski, Siegfried (1989): Audiovisionen. Kino und Fernsehen als Zwischenspiele in der
Geschichte, Reinbek bei Hamburg
http://medialine.focus.de/M/MA/ma.htm
Datengrundlage für die Analyse aus:
http://www.rtl.de
http://www.zdf.de
Anhang
Die amerikanischen Serien und Trickfilme (Trickfilmserien) bei RTL in der Woche vom 16.8 -23.8.99 im Überblick
[...]
1 Detaillierte Aufstellung im Anhang
2 Detaillierte Aufstellung im Anhang
3 Quelle http://medialine.focus.de/M/MA/ma.htm
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Schlüsselthemen, die Kapitelzusammenfassungen und die Schlüsselwörter umfasst. Der Text untersucht die Rolle amerikanischer Medienprodukte auf dem deutschen Fernsehmarkt, insbesondere im Hinblick auf die "Amerikanisierung".
Welche Fernsehsender werden in dem Text analysiert?
Der Text analysiert das Fernsehprogramm des Kölner Privatsenders RTL und des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ZDF, um den Anteil amerikanischer Produktionen zu ermitteln und die Unterschiede zwischen den Sendern hervorzuheben.
Was ist die Definition von "Amerikanisierung" im Kontext des Textes?
"Amerikanisierung" wird im Text als der wachsende Einfluss US-amerikanischer Kulturgüter, insbesondere im Bereich der audiovisuellen Medien, verstanden. Es geht um die Angst vor dem Verlust der kulturellen Identität und die Ausbreitung der "Popular Culture" der USA.
Welche gesellschaftspolitischen und sozioökonomischen Unterschiede zwischen den USA und Deutschland werden im Text hervorgehoben?
Der Text betont, dass die USA ein Einwanderungsland mit einer relativ jungen Geschichte sind, während Deutschland kulturell heterogener strukturiert ist. In den USA herrscht eine starke individualistische Grundhaltung, während in Deutschland staatliche Einrichtungen eine größere Rolle spielen. Die USA haben einen Entwicklungsvorsprung in Bezug auf die Entwicklung von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft.
Wie hat sich das Fernsehen in den USA und Deutschland entwickelt?
In den USA war das Fernsehen von Anfang an privatwirtschaftlich organisiert und auf den größtmöglichen Zuschauererfolg ausgelegt. In Deutschland war das öffentlich-rechtliche Fernsehen lange Zeit der einzige Anbieter. Erst später wurden private Anbieter zugelassen.
Welche kulturellen Aspekte des "Amerikanisierungsprozesses" werden im Text diskutiert?
Der Text vergleicht das Kulturverständnis in den USA, das von einer umfassenden "Popular Culture" geprägt ist, mit dem Kulturverständnis in Deutschland, das traditionell vom Bildungsbürgertum beeinflusst wird. Die kulturelle Auseinandersetzung mit der "Amerikanisierung" des Fernsehens in Deutschland wird als eine Diskussion über Trivialisierung, Kommerzialisierung und den Verlust der kulturellen Identität dargestellt.
Welche ökonomischen Einflußgrößen werden für die Entwicklung des deutschen Fernsehens betrachtet?
Der Text analysiert die ökonomischen Ziele amerikanischer und deutscher Programmveranstalter. Amerikanische Programmveranstalter verfolgen internationale Marketingstrategien zur Gewinnmaximierung. Deutsche Programmveranstalter müssen aufgrund des Wettbewerbs um Zuschauerzahlen und Werbekunden zunehmend auf Wirtschaftlichkeit achten. Die Strategien des „Windowing“ und der Preisdiskriminierung als Beispiele für internationale Marketingstrategien der USA werden erläutert.
Welche Rolle spielt die "Europäisierung" des deutschen Fernsehmarktes?
Der Text diskutiert die EG-Fernsehrichtlinie von 1989 und die Bemühungen der Europäischen Union, die europäische Film- und Fernsehproduktion zu fördern und die Abhängigkeit von Amerika zu verringern. Die "Europäisierung" wird als eine Alternative zur "Amerikanisierung" dargestellt, wobei die Deregulierung und Kommerzialisierung des Film- und Fernsehmarktes berücksichtigt werden müssen.
Welche theoretischen Ansätze werden zur Erklärung des Einflusses Amerikas auf die Globalisierung der Kommunikation herangezogen?
Der Text erörtert den "one-way-flow of information" und die Theorie des "Kulturellen Imperialismus". Es wird argumentiert, dass sich der "amerikanische kulturelle Imperialismus" in eine kulturelle Dominanz der transnationalen Konzerne gewandelt hat.
Welche transnationalen Medienkonzerne werden im Text erwähnt?
Zu den führenden Konzernen gehören Time Warner, Bertelsmann AG, Sony, Walt Disney Corporation und News Corporation Limited.
- Quote paper
- Sven Boehme (Author), 2000, Die "Amerikanisierung" des deutschen Fernsehens, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/98595