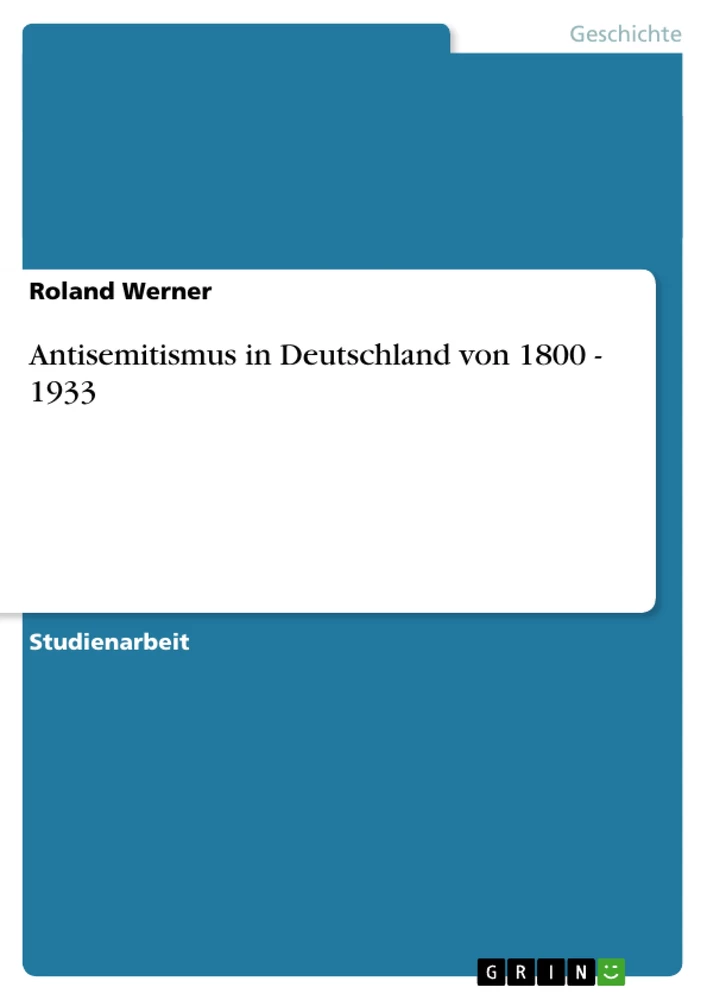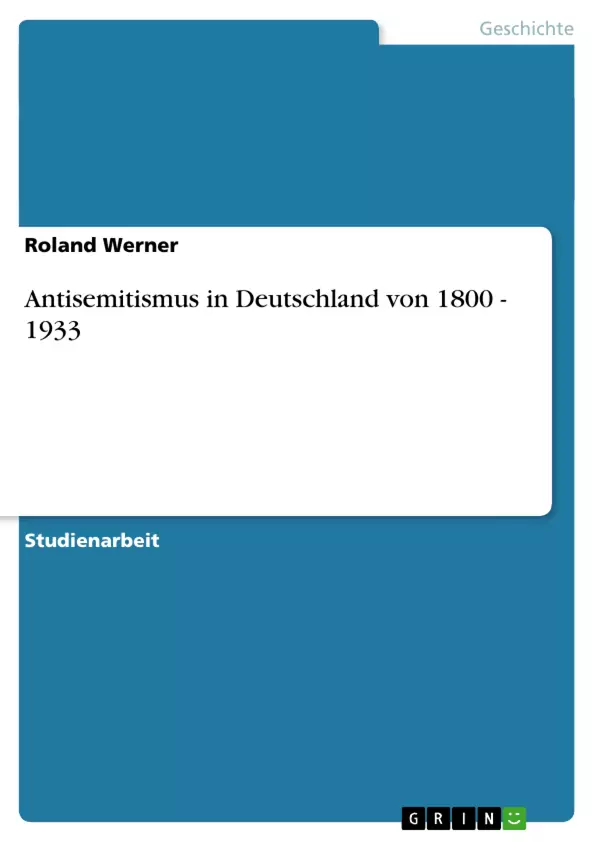Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Vorgeschichte des Antisemitismus - Judenfeindschaft
3. Die Emanzipation der Juden in Mitteleuropa
4. Die Entwicklung bis 1848 - Assimilierung und beginnender Antisemitismus.
5. ,,Antisemitismus" ein Wort wird Programm
6. Konsolidierung des Antisemitismus 1890 - 1914
7. Erster Weltkrieg und Weimarer Republik
8. Zusammenfassung 16
9. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
,,...und bis heute. All diese Zwischenfälle fanden in Momenten ernster Krisen statt, als die Unterdrückung des Volkes und die Verteilung seiner Bestrebungen am schwer- sten waren. Als die Bevölkerung sich in ihren sozialen und humanen Bedürfnissen frustriert fand, wendeten sie sich in ihrer Not gegen das nächste und verletzbarste Objekt - die Juden"1 Judenfeindschaft, eine immer währende Geisel, wie auch immer genannt oder betrieben!
Würden wir diesen Fakt als gegeben hinnehmen und ihn auch nicht hinterfragen so wäre es weniger historisch als ethisch verwerflich. Es geht bei der Judenfeindschaft nicht in erster Linie um den Juden oder die Jüdin, sondern um die Minderheit, einen schwächeren Teil der Gesellschaft, und daraus sollte sich auch eines der Ziele der Antisemitismusforschung ergeben: Der Nachweis, daß Menschen ,egal in welcher Epoche ihres Daseins, anfällig sind für Unterdrückung andersgearteter, schwächerer Mitmenschen.
Somit kann Antisemitismusforschung ein Beitrag zur Bekämpfung z. B. der Behin- dertenfeindlichkeit oder der Ausländerfeindlichkeit der heutigen Zeit sein. Denn wenn nur einige durch solche Forschungsarbeit begreifen würden, daß es zwar in unserer Natur liegt, nicht gleichstarke Menschen als schwach anzusehen, dieses uns aber nicht berechtigt sie zu verurteilen oder gar zu unterdrücken. Dann hat auch histor- isches Forschen Sinn.
Deshalb möchte ich mich in meiner hier vorgelegten Arbeit mit der Entstehung des Antisemitismus beschäftigen. Wie konnte aus der eher religiös gefärbten Judenfeind- schaft, welche natürlich zu allen Zeiten auch ein Politikum darstellte, dieser rassisch und ideologisch geprägte Antisemitismus entstehen ?
Besonders tragisch erachte ich die Rolle der deutschen Universitäten in diesem Zusammenhang2.
2. Vorgeschichte des Antisemitismus: Judenfeindschaft
Um die Judenfeindschaft zu verstehen ist es notwendig ganz tief in die Geschichte der Menschen einzutauchen.
Die Juden, Anhänger einer monotheistische Religion, die weit vor den beiden anderen Weltreligionen, welche die Antike und das Mittelalter im europäischen und mediterranen Einflußbereich prägten3, entstand, waren in den Städten der Antike, kulturell und zahlenmäßig, ein ernstzunehmender Faktor. Auf Grund der relativen Toleranz des Hellenismus, konnten sich die Juden in den Städten ansiedeln und dort ein reges Wirtschaftsleben entfalten.
Erst das Aufeinandertreffen der polytheistischen, machthungrigen Römer und der stark freiheitsliebenden Juden (besonders nach der Eroberung Palästinas, Pompejus eroberte 63 v.u.Z. Jerusalem) leitete eine bis dato unbekannte Unterdrückung der jüdischen Bevölkerung ein. Die folgenden 200 Jahre sollten besonders tragisch im jüdischen Leben des östlichen Mittelmeerraumes werden. Angefangen mit dem Pogrom in Alexandria (30 u.Z.),über den ,,Jüdischen - Krieg" (66 - 70 u. Z.) bis hin zum Aufstand des ,,Bar Kochba" (132 -135)4.So wurde das Dasein der Juden in Palästina nahezu beendet. Mit der Ausbreitung des Christentums im mediterranen Raum und dessen Annerken- nung als Staatsreligion im Römischen Reich setzte sich die Diskriminierung der Juden im gesamten Einflußbereich des christlichen Klerus fort. Mit Hilfe irriger Theorien, z. B der der angeblichen Hostienschändung, des Ritualmordes oder des Gottesmordes, schürten christliche Würdenträger immer wieder das Ressentiment gegen die Juden, unter ihnen auch so namhafte Personen wie Gregor von Tours oder der heilige Agobard. Das geschützte Leben der Juden im Reich der Karolinger und später der Ottonen fand ein jähes Ende mit dem Beginn der Kreuzzugsbewegung um 1100. Am 3. Mai 1096 wurde mit dem Pogrom in Speyer eine ungebremste Haßtirade gegen die jüdische Bevölkerung Mittel- und Westeuropas losgetreten. Allein 1096 sollen _ 12000 jüdische Menschen bei Plünderungen ums Leben gekommen sein5. Erst mit dem Ende der Kreuzzüge im ausgehenden 13. Jh. (1291 fällt Akko, der letzte Stützpunkt der Kreuzritter in Palästina) beruhigte sich die Situation wieder. Trotz alledem, Juden blieben Bürger 2. Klasse, es war ihnen untersagt in der Landwirtschaft oder im handwerklichen Bereich tätig zu seien, so das sie in Berufen wie Geldverleih oder im Pfandwesen arbeiten mußten. Dies brachte allerdings wieder enorme Probleme mit sich. Aufgrund der Schulden, die nichtjüdische Bevölkerungsteile (vorallem Bauern) bei jüdischen Geldverleiern hatten, galten die Juden als Sündenbock für fast alle Negativereignisse. Diese Sündenbockrolle haftete den Juden bis in die Neuzeit an. Dies äußerte sich immer wieder durch Pogrome, so geschehen in Deggendorf 1337 oder bei der Plünderung der Judengasse in Frankfurt 1614.
Erst mit dem Wirken Moses Mendelssohns (1729 -1786) sollte diese über 1500 Jahre andauernde Leidensgeschichte der jüdischen Religionsgemeinschaft aufgebrochen werden. Nun folgte eine rasante Entwicklung der Juden hin zum gleichberechtigten Bürger, wenigstens ,,de jure".
3. Die Emanzipation der Juden in Mitteleuropa
Die juristische Gleichstellung der Juden ist ein Verdienst der Epoche der Aufklärung.
Fortschrittliche Geister wie Moses Mendelssohn oder Christian Wilhelm Dohm6 rückten die Gleichstellung der jüdischen Minorität in den Blickpunkt der Politik. Das geistige Gut dieser Zeit stand Pate, als 1782 der Habsburger Joseph II. ein umwälz- endes ,,Toleranzedikt" erließ, was die juristische Gleichstellung der Juden beinhaltete. Es folgten weitere Höhepunkte der Gleichberechtigung jüdischer Menschen: die amerikanische Verfassung (1787) und die französische Verfassung (1791). Erst 1812 erließ auch Friedrich Wilhelm der III. von Preußen ein Toleranzedikt, was aber weit hinter seinen Vorgängern zurückblieb. Mit Napoleons Eroberungskrieg erlangten auch die Bürger der anderen deutschen Staaten in den Genuß der mittler- weile nicht mehr ganz so judenfreundlichen französischen Verfassung7.
In ganz Mittel und Westeuropa drängten die Juden nun in das öffentliche Leben, sie wollten beweisen, daß sie durchaus Deutsche unter Deutschen waren, was sich in der Beteiligung an den Freiheitskriegen (1812 - 1815) enorm ausdrückte. Jedoch zeigte das Engagement der Juden für die deutsch Nation nicht den gewünschten Erfolg. Im Laufe des Wiener Kongresses mußten die mitteleuropäischen Juden erneuter recht- licher Benachteiligung tatenlos zusehen. Dies soll aber keineswegs den Eindruck ver- mitteln, es wären nun wieder voremanzipatorische Zustände, im rechtlichen Sinne, herbeigeführt worden.
Ein Abbild der Benachteiligung jüdischen Bürger war die nun einsetzende Taufbewegung, ,,Die Taufe war das Eintrittsbillett zur europäischen Kultur, meinte Heinrich Heine."8 Zum Beispiel war es in Preußen nur als getaufter Christ möglich höhere Ränge in der Armee zu bekleiden, desweiteren war es Juden auch nicht gestattet in den Staatsdienst einzutreten oder eine Professur anzunehmen. All das ließ einige Anhänger der jüdischen Religion die Taufe9 vollziehen unter ihnen namhafte Deutsche wie Heinrich Heine, vormals Chaim Bückeburg.
Zusammenfassend läßt sich sagen, das ausgehende 18. und das beginnende 19. Jh. waren nicht nur die Jahre der bürgerlichen Emanzipation und des Niedergangs des Adels in Mittel- und Westeuropa sondern es waren auch Jahre der Befreiung der Juden aus ihrem Gettodasein. Die Juden waren wieder zu einem Faktor in kulturellen und wissenschaftlichen, besonders naturwissenschaftlichen, Bereichen herange- wachsen. Der nicht mehr aufzuhaltende Assimilierungsprozeß förderte auch die Verständigung auf menschlicher Ebene, allerdings ohne die Vorurteile vom ,,Juden" untergehen zu lassen.
4. Die Entwicklung bis 1848 - Assimilation und beginnender Antisemitismus
Die Zeit zwischen 1820 und 1849 gilt als Hochphase der Assimilation der Juden in die bürgerliche Gesellschaft, es war die Zeit Heines und vieler anderer fortschrittlicher Geister. Aber es war auch die Epoche der ,,politischen Romantik", eine verklärte Auf- fassung des bisher Dagewesenen, als ideales System galt die Ständegesellschaft preußischer Prägung. Der Konservativismus dieser Zeit ließ auch die religiös ge- formten Vorurteile wieder aufleben. Da Kirche und Staat nach dem Sieg über das reformierte Frankreich wieder enger zusammen rückten, ließ sich das nicht vermeiden. Desweiteren zog sich der Antisemitismus durch alle drei großen politischen Beweg- ungen der 1820er - 1840er Jahre. Der Konservativismus lehnte so oder so emanzi- patorische Bestrebungen als, das politische System gefährdend ab. Auch der Liberalismus war nicht frei von judenfeindlichem Gedankengut. Es galt (zwar nicht bei der Mehrheit der liberalen Bewegung) als erstrebenswert die jüdische Religion abzu- schaffen und die Juden als Christen in die bürgerliche Gesellschaft zu integrieren. Konnte man sich doch mit dieser Auffassung auf Vordenker der liberalen Bewegung mit so klangvollen Namen wie Voltaire berufen, also: Emanzipation gegen Anpassung. Weitergehender jedoch war die Ausprägung einer neuen politischen Richtung, der des deutschen Nationalismus. Hierbei wurden die Juden als Störfaktor in der Entwik- klung hin zum deutschen Nationalstaat angesehen. Besonders in Anbetracht der antideutschnationalen Politik des Wiener Kongresses wurde den Juden Bestechungs- vorwürfe gemacht, die jüdischen Bürger Deutschlands waren als Feinde der deutschen Einheit ausgemacht. Viel fataler erscheint mir bei dieser Bewegung aller- dings die neue Betrachtungsweise der jüdischen Religionsgemeinschaft als unabän- derliche Vereinigung, die der nun als erstrebenswert erscheinenden germanisch - christlichen Nation grundsätzlich feindselig gegenüberstand. Nach Ansicht vieler Nationalisten der damaligen Zeit war es eben keine Frage der Religion mehr, was den ,,Juden" vom ,,Deutschen" unterschied, sondern das gegensätzliche Wesen der ,,Guten" (national gesinnten Deutschen) gegenüber den ,,Schlechten" (antideutschen, nur auf ihr wohl bedachten Juden). Der angebliche Volkscharakter der Juden trat immer mehr in den Vordergrund.
,,...Am eindringlichsten vertrat Friedrich Frühs, Professor für Geschichte an der Berliner Universität, diesen Standpunkt. 1816 erschien seine vieldiskutierte Schrift Ü ber die Ansprüche der Juden an das deutsche Bürgerrecht. Nach Auffassung des Berliner Historikers konnten Juden ihres Glaubens wegen keine loyalen Bürger eines deutschen Nationalstaates sein. Denn in der deutschen Nation seien germanische und christliche zu einem organischen Ganzen zusammengewachsen."10
Es ist das die tragische Vorgeschichte, die Marr11 oder Gobineau12 möglich machte. In diese Zeit fällt auch der Beginn des antisemitischen Denkens an deutschen Universitäten. So in Jena oder Gießen, wo Burschenschaften den Ausschluß aller Juden aus studentischen Kooperationen erreichten.
Im Großen und Ganzen waren die Jahre vor der ,,Achtundvierziger Revolution" aber gekennzeichnet von einer noch nie dagewesenen Eingliederung jüdischer Bürger in die Gesellschaft Mitteleuropas, natürlich regional differierend. Hierbei ist aber nicht aus den Augen zu verlieren, daß die voranschreitende Assimilation mit einer beträcht- lichen Aufgabe jüdischer Identität einherging. Dieses neue Gefüge in der bürgerlichen Gesellschaft barg, wie die 2. Hälfte des 19. und die 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigen sollte, weitreichende Miß- und Unverständnisse, deren Ursachen auf altver- trauten und das ist das ,,Moderne" dieser Epoche, auf neuen politisch greifbaren Parolen fußten.
5. Antisemitismus, ein Wort wird Programm
Im Folgenden soll dargestellt werden, was den Übergang von einem zwar politisch geprägten aber noch wenig evidenten Antisemitismus13, zu jenem rassisch und später auch sozialdarwinistisch gearteten Antisemitismus ausmachte.
Die 2. Hälfte des 19. Jh. ließ sich anfänglich für die Emanzipation der Juden gut an, die ,,achtundvierziger Revolution" brachte für kurze Zeit die absolute Gleichberechtig- ung mit sich. Des weiteren hatten die Juden eine politische Heimstatt im Liberalismus dieser Zeit gefunden, das heißt vorallem, daß die Judenfeindschaft in der liberalen Bewegung Grundlagen verlor und sie sich auch den Schutz von Minderheiten auf die Fahnen schrieb. Die Verfassung, die in der Frankfurter Paulskirche verabschiedete wurde beweist es eindringlich.
Nicht verschwiegen werden darf allerdings, daß es zu Beginn der Revolution zu schwerwiegenden Anfeindungen jüdischer Bürger kam. In Baden begannen die revolutionären Ereignisse sogar mit einem antijüdischen Bauernaufstand14.
Die nach dem Scheitern der Revolution einsetzende Restaurationspolitik beendet die kurze Phase der Gleichberechtigung der deutschen Juden sehr vehement. Nur in wenigen deutschen Staaten, primär Kleinstaaten wie Nassau, Braunschweig oder Sachsen - Weimar, blieb die Emanzipationsgesetzgebung der 1848er Verfassung in Kraft.
Die soziale Struktur der jüdischen Bevölkerung hatte sich allerdings in der 1. Hälfte des 18. Jh. enorm verändert, Juden hielten in die bürgerlichen Berufe (Ärzte, Rechts- anwälte oder in künstlerische Richtungen) Einzug. Damit wurden sie auch in die bürgerliche Gesellschaft integriert, freilich wie schon erwähnt nur gegen die Aufgabe jüdischer Traditionen und jüdischer Lebensweisen.
Das Wesen des sich in Entstehung befindlichen ,,modernen Antisemitismus" zeigte sich nun immer deutlicher. Wilhelm Marr, der das Wort ,,Antisemitismus" in die politischen Gefilde der damaligen Zeit und hierdurch auch in die folgenreiche Zukunft einführte15 gab einer gedanklich schon vorbereiteten Bewegung einen sehr bezeich- nenden Namen. Es war J. A. Gobineau, der in seiner bis 1855 in 4 Bänden erschiene Publikation: ,,Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen" erstmals in dieser Form die Überlegenheit der ,,arischen"16 Rasse gegenüber anderen Mensch- enrassen, vornehmlich der bei ihm als Rasse geltenden Juden, dazustellen suchte. Hier- bei wurde er von den antisemitischen Ansätzen R. Wagners und des, meiner Meinung nach, fälschlich als antisemitisch bezeichneten Werkes F. Nietzsches geleitet. Dieses von Gobineau verfaßte Buch galt fortan als Grundlage antisemitischer Politik. Das schwerwiegende dieser Schrift ist die angebliche Wissenschaftlichkeit die diesem Werk auch in dem Bildungsbürgertum Anhänger verschaffte. Trotz alledem kann nicht von einer übersteigert zunehmenden antisemitischen Bewegung in Deutschland gesprochen werden. Es war eher ein schleichender Prozeß. Die Jahre der rasch vonstatten gehenden Industrialisierung war eine Zeit, in der keine wesentlichen Krisen das deutsche Volk erschütterten. So brauchte man also keinen Sündenbock und der Antsemitismus war eher eine politische Ausrichtung die ein Randdasein fristete, jedoch wahrgenommen werden konnte, z.B. an den Universitäten, bis 1870 zwar ein Hort des Liberalismus. Graduell kam es jedoch in den Professorenkollektiven zu einer gewissen Angst vor den jüdischen Akademikerkol- legen, die in den noch wenig etablierten Fachgebieten naturwissenschaftlicher Art erhebliche Autoritäten hervorbrachten. Wo ist nun aber der Knackpunkt, d.h. der oder die Auslöser des Antisemitismus hin zur politisch einflußreichen Bewegung zu suchen? Ein ausschlaggebender Faktor war die Reichseinigung 1871, bei der erstmals in der Geschichte des deutschen Volkes ein einheitliches und allgemeines Wahlrecht zugelassen wurde. Das und die Einigung der vielen deutschen Staaten unter der Führung Preußens gab dem nationalen Lager natürlich viel Aufschwung. Da Antisemitismus ein Teil der nationalen Politik der damal- igen Zeit war, rückte dieser auch immer mehr in das politische Interesse. Desweiteren hatten viele Parteien gegenüber den liberalen Parteien Profilierungsschwierigkeiten, vornehmlich religiös geartete Parteien und bei jenen wiederum die katholisch gepräg- ten Parteien und Organisationen. Was lag also näher als ein altbekanntes Vorurteil, mittlerweile pseudowissenschaftlich eingepackt, politisch zur Profilierung zu verwen- den. Der Antisemitismus sollte hierbei gute Dienste leisten. Hauptsächlich in ostelb- ischen und anderen ländlichen Gegenden zeitigte diese Politik Erfolge. Hier war der Bildungsstand der Bevölkerung noch nicht so hoch und die Juden sehr wenig integrier. Mit dem fortschreitenden Aufschwung der Gründerjahre ging auch die Assimilierung der Juden in ihre letzte Phase, die Juden waren nun nach 2 Jahrtausenden der Un- gleichheit nahezu gleichberechtigt und das nicht nur de jure sondern auch in manchen zukunftsorientierten, liberalen Kreisen des Bürgertums galten Juden als Menschen unter Menschen.
Lange sollte dieser Zustand nicht anhalten. Mitte der achtziger Jahre brach der Grün- derboom zusammen. Die nun folgende, sogenannte, Gründerdepression übertraf alle bis dahin bekannte Wirtschaftskrisen, durch die Abhängigkeit ganzer Produktions- zweige untereinander waren Firmenpleiten auf der Tagesordnung. Vor allem kleinere und mittlere Handwerksbetriebe mußten aufgeben. Die Verschlechterung der sozialen Lage ganzer Bevölkerungsschichten war vorprogrammiert. Eine neue Krise war ange- brochen und somit auch die Suche nach den ,,Schuldigen". Es waren, wie nahezu üblich, die Juden , wenn auch aus unterschiedlichen Beweggründen heraus. So waren die Juden für die konservativen Kräfte die Speerspitze des Liberalismus und damit schuld an der herrschenden Misere. Die Kirchen beklagten ihren schwindenden Einfluß auf die Politik und hatten ebenfalls die jüdischen Politiker als Verantwortliche ausgemacht. Die kirchlichen Parteien beklagten sich daher über eine ,,Verjudung" der Parlamente. Alfred Stöcker evangelischer Hofpastor in Berlin gründete am 5. Januar 1878 die ,,Christliche Soziale Arbeiterpartei" ( im Folgenden CSP). Anfänglich als protestan- tischer Gegenpol zur Sozialdemokratie gedacht, glitten Stöckers Reden und Veröffent lichungen immer mehr in antisemitische Hetztiraden ab. Nach seiner ersten als anti- semitisch anzusehenden Rede (19.9.1878) war Stöcker in nationalen und konserva- tiven Kreisen ein gerngesehener Agitator, er galt als Volksredner. 1878 kann als Zäsurjahr in der Entwicklung des politischen Antisemitismus angesehen werden, noch nie wurden so viele antisemitische Reden gehalten, noch nie so viele judenfeindliche Schriftwerke verfaßt. 1879 gründete, der schon erwähnte W. Marr die ,,Antisemiten- liga" welche sich für die ,,Vernichtung jüdischen Wesens mittels Aufrichtung des deutschen Volksbewußtseins" einsetze. Zwar fristeten die antisemitischen Parteien, von denen die beiden genannten nur eine kleine Auswahl sind, parlamentarisch ein Schattendasein, ihr Wirken auf außerparlamentarischer Ebene kann aber als ent- scheidend für das Eindringen antisemitischer Ideologien in das öffentliche Bewußt- sein und den politischen Alltag angesehen werden. Antisemitismus wurde im politischen Kampf immer legitimer und auch immer radikaler in seinen Ausbrüchen. Auch das deutsche Bildungsbürgertum und die Universitäten blieben nicht mehr ver- schont von dieser massiv aufkommenden Diskriminierung der deutschen Bürger jüdischen Glaubens. Ein Vertreter dieser Auffassung ist der Berliner Historiker Heinrich v. Treitschke17,der mit seiner 1880 erschienenen Schrift: ,,Ein Wort über unser Judentum" den ,,Berliner Antisemitismusstreit"18 auslöste. Teitschke war auch einer jener Unterstützer der 1880 von Bernhard Förster und Max Liebermann von Sonnenberg an Bismarck geleiteten Petition, die den Ausschluß aller Juden aus staatstragenden Funktionen forderte. Treitschke befand sich dabei in illusterer Gesellschaft, auch Richard Wagner förderte diese Petition. Interessant wird diese Petition, die weniger als ein Prozent der deutschen Bevölkerung unterschrieb, wenn man betrachtet welche Bevölkerungsschichten diese Petition signierten. Nachdem 1880 ein Jurastudent mit Namen Dulon einen Ausschuß zur Förderung der Petition an den Universitäten gründete, kam diese Petition zu trauriger Berühmtheit, im Durch- schnitt setzten 19% der Studenten ihre Unterschrift unter diese Petition, an einigen norddeutschen Universitäten waren es sogar bis zu 50% der Studenten19. Es war also eine deutliche antisemitische Stimmung an den Universitäten zu verzeichnen, deren Höhepunkt keineswegs erreicht war. Es war lediglich der Anfang.
Aber wieso? Ab 1880 war über den akademischen Arbeitsmarkt eine schwere Struk- turkrise hereingebrochen, eine logische Erscheinung, wenn man den Boom, den die Universitäten nach 1848 erlebten, bedenkt und in Betracht zieht, daß der Nachhole- bedarf an Akademikern nach 30 Jahren quantitativ überhöhter Überausbildung aufge- arbeitet war. Somit hatten die Studenten nicht mehr die guten Berufsaussichten der ,,Nachachtundvierzigerzeit" oder der Gründerjahre. Neben diese ,,Zukunftsangst" ge- sellte sich auch noch die zur Zeit des ausgehenden 19. Jh. angewachsene ,,Status- angst" an den Universitäten und im Bildungsbürgertum. Die zunehmende Industriali- sierung wurde als feindlich, dem akademischen Status abträglich angesehen (Juden galten immer noch als treibende Kraft des Parlamentarismus, die die Industrialisier- ung vorantrieb. Juden standen aufgrund ihrer finanziellen Macht20 im Schußfeld anti- liberaler Anfeindungen.) . Und so bildete sich an den Universitäten eine antisemitisch geprägte Schicht, die sicherlich nicht die Mehrheit darstellte jedoch mit _ 25% Anteil antisemitischer Studenten21 auch keine Minderheit war. In den ausgehenden acht- ziger Jahren des 18. Jh. war der Antisemitismus jedoch im gesamtpolitischen Zusam- menhang nur wenig bedeutsam, nur als ungefährlichste Opposition contra Bismarck war der Antisemitismus vereinzelt Ideenträger konservativer Bismarckgegner. Aber an den Universitäten begann er sich latent festzusetzen. ,,...Damit erscheinen die 1880er und frühen 1890er Jahre als Zeitraum allmählicher politischer Umorientierung derjenigen Teile des (Bildungs-) Bürgertums, die noch nicht gleich Ende der 1870er Jahre ins konservative Lager umgeschwenkt sind."22 "...Begleitet von einem Generat- ionswechsel zerbröckelte in diesem Zeitraum auch die liberale Phalanx der Profes- sorenschaft, die sich nun zunehmend in den neuen, aggressiv antiliberalen und antidemokratischen Agitationsverbänden engagierte."23
6. Die Konsolidierung des Antisemitismus 1890 -1914
Wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben war der Antisemitismus noch zu keiner bedrohlichen politischen Größe angewachsen. Trotz alledem läßt sich von dieser Zeit, 30 Jahre vor und 30 Jahre nach der Jahrhundertwende, ein roter Faden hin zum Holocaust ziehen. Es war der latent vorhandene, jederzeit wiederbelebbare Antisemitismus der sich im Bewußtsein mancher gesellschaftlichen Schichten, vorallem des Bildungsbürgertums (Ärzte, Juristen), mittleres Beamtentum und in der Handwerkerschaft, festsetzte (was die historische Entwiklung der weiteren Zeit bewies). Auch das Jahr 1890 spielte in der ,,Wiederbelebbarkeit des Antisemitismus" eine entscheidende Rolle. Nach der Aufhebung der Sozialistengesetze war der Vormarsch der Sozialdemokratie nicht mehr aufzuhalten, konservative Kreise leisteten freilich erbitterten Widerstand. Im Zuge dessen der Antisemitismus wieder als Ideenträger herhalten mußte. Es gründeten sich eine Vielzahl antisemitischer Verbände und Vereine so z.B. der ,,Deutsche Handelshilfe Verein" (im folgenden DHV), welcher sich nach Aussagen führender Vertreter aus dem Antisemitismus geboren sah. Der DHV war weniger auf parlamentarischer Ebene tätig, allerdings um so mehr im Alltag. Er brachte eine Menge Schriften antisemitischen Inhalts heraus und führte eine große Anzahl Versammlungen durch. Im DHV waren besonders Jugendliche eingebunden, Lehrlinge und Studenten. Wie die historische Forschung später nachwies war der DHV eine der Kaderschmieden für spätere antisemitische Parteien und Verbände. Mit der Gründung des DHV und dem 1893 ins Leben gerufene ,,Alldeutschen Verband" läßt sich eine Radikalisierung des antisemitischen Gedankengutes verzeichnen. Es wird nicht mehr von der Vernichtung oder Beseitigung der jüdischen Kultur oder des jüdischen Wesens gesprochen, vielmehr von der Förderung der nordisch, german- ischen Rasse und damit der Beseitigung (es ist noch nicht von Vernichtung gespro- chen worden) der jüdischen Rasse. Der ,,Alldeutsche Verband" nahm das Gedanken- gut W. Marrs auf, der von einer politischen Legierung des Antisemitismus mit dem Nationalismus ausging. Desweiteren tauchte im Zusammenhang mit dem Programm des ,,Alldeutschen Verbandes" erstmals, in so klarer Form, die Forderung nach einem ,,Nationalsozialistischem Radikalismus" auf. Das bedeutete die Zurückstellung des Individuums unter den nationalen Gemeinsinn. 1894 wurde die Gobineau - Gesell- schaft in das politische Dasein gerufen. Gegründet von dem Gobineau - Übersetzer Ludwig Scheman kam noch eine neuere Komponente des Antisemitismus hinzu: Der Sozialdarwinismus. Es wurde die Forderung nach der Umsetzung der rassisch, bio- logischen Erkenntnisse in politische Taten aufgemacht. Der Sozialdarwinismus stellt eine völlig verklärte Sichtweise der darwinschen Lehre dar, wenn auch kein deutsches Phänomen so doch einzigartig in seiner rassischen Auslegung in Deutschland. Dies zeigte ein 1900 durchgeführtes Preisausschreiben der Firma Krupp zu diesem Thema. Durch diese Entwicklung wurde deutlich, daß sich der Antisemitismus zu einer festen Größe im deutschen Alltag entwickelte, getragen vom Kleinbürgertum und dem mittleren (Bildungs-) Bürgertum. Zwar übertrieben, aber im Ansatz den Zustand im deutschen Bildungsbürgertum charakterisierend, ist die Äußerung eines verantwort- lichen Mitgliedes des ,,Kyffhäuserbundes" (in ihm waren mehrere stark konservative Burschenschaften zusammengeschlossen): ,,...Heute ist der Gedanke des gesell- schaftlichen Antisemitismus ja so ziemlich ein selbstverständliches Gemeingut aller akademischen Kreise geworden." Äußerst bezeichnend war es auch, daß im Bil- dungsbürgertum größter Wert auf ,,nichtjüdische" Abstammung gelegt wurde. So ,,kämpfte" Bruno Heydrich24 sein ganzes Leben gegen solche Anfeindungen aus dem Hallenser Bürgertum, dem er auch angehörte. Als er diesen ,,Kampf", mehr oder weniger gewonnen hatte, ging auch die Anmelderate von Kindern und Jugendlichen der Hallenser bürgerlichen Gesellschaft an seiner Musikschule nach oben. Das in solchen Verhältnissen viele der Führungselite im 3. Reich zugehörigen Personen aufwuchsen ist kein Geheimnis. Neben Heyrdich auch Heinrich Himmler oder Arthur Nebe.
7. Der erste Weltkrieg und Weimar Republik
Nach einem kurzen Aufflammen des Antisemitismus 1912,.im Anschluß an den seit Bestehen der SPD bedeutendsten Wahlerfolg der Partei (1912 erstmals wurde die SPD stärkste Partei bei Reichstagswahlen) war die imperialistische Politik Wilhelm II. und des Reichskanzlers Hollweg tonangebend, am Vorabend des 1. Weltkrieges kannte Wilhelm II. keine Parteien mehr sondern nur noch Deutsche. Und da er auf jüdische Financiers, wie Walther Rathenau oder Franz Oppenheimer bei der Aufrüstung des Heeres angewiesen war und dank des Machtwortes (Ich kenne keine Parteien mehr, nur noch Deutsche) kam der Antisemitismus oberflächlich zum erliegen. Unterschwellig waren Antisemiten aber weiterhin tätig, was die Gründung des ,,Reichshammer- bundes" und der Thulegesellschaft (aus dieser Loge kam der Chefideologe des 3. Reiches Alfred Rosenberg.) 1912 beweist.
Im nationalen Taumel der ersten Kriegsmonate schien der Antisemitismus besiegt. Diese Annahme wurde schon nach dem ersten Kriegsjahr und den ausbleibenden Erfolgen an der Westfront adabsurdum geführt. Der jüdische Soldat (10000 Freiwillige jüdische Soldaten zu Beginn des Krieges, also gegenüber Hunderttausenden freiwil- ligen Nichtjuden eine verschwindend geringe Anzahl) galt fortan als Feigling und Drückeberger, man brauchte ja wieder einen Sündenbock. Dies steigerte sich soweit, daß die Zensur der kriegsberichterstattenden Presse antisemitische Artikel nicht zen- sierte, ja sogar förderte. Einen guten Einblick in die geistige Beschaffenheit des Heeres erlauben die Kriegstagebücher des jüdischen Frontsoldaten Julius Marx, der Ende 1914 schon schrieb:"...daß man mich als Juden scheel ansieht. Bei Kriegsbe- ginn schien jedes Vorurteil verschwunden, nun hört man wieder die alten verhaßten Redensarten."25. Im Reich kam es lange zu keiner Reaktion auf den im Heer wieder aufflammenden Antisemitismus. Als am 11. Oktober 1916 jedoch eine ,,Statistische Erhebung über die Dienstverhältnisse der deutschen Juden im Kriege" angeordnet wurde(dieser sogenannte Oktobererlaß kam aus dem Hause des preuß. Kriegsminis- ters) wurde damit eine neue antisemitische Agitationswelle ausgelöst, die bisher un- geahnte Ausmaße annahm und durch die Nichtveröffentlichung der Ergebnisse noch geschürt wurde. Es ist daher nachvollziehbar, daß dieses Datum (11.10.1916) als Wendepunkt in der antisemitischen Bewegung des 1. Weltkrieges angesehen wird. Besonders radikal - antisemitisch wirkende Gruppen wie der ,,Reichshammerbund" machten sich die nun sehr schnell, durch das kriegsbedingte Elend ganzer Bevölker- ungsschichten, umschlagende Stimmung zu Nutze und warfen immer wieder neue antisemitische Parolen in den politisch sich immer radikaler gebenden Alltag. So ist es nicht verwunderlich, das alte Vorurteile, die Wucherei und Schwarzmarkthandel mit dem ,,Juden" gleichsetzten, erneut auftauchten. Der jüdische Kriegsgewinnler, ein uraltes Ressentiment gegen die Juden, war wieder lebendig.
Die Gründung der ,,Deutschen Vaterlandspartei" 1917 stellte einen neuen Scheitel- punkt des Antisemitismus im Kaiserreich dar. Durch die sich abzeichnende Niederlage und der im Inland aufkeimenden Opposition gegen den Krieg wägte sich das konser- vative Lager im Zugzwang und so gründete sich die ,,Deutsche Vaterlandspartei" als Schmelztiegel der national - völkischen Bewegung, mit enormen antisemitischen Be- strebungen. Aus dieser Bewegung kommt die ursprünglich auf die Juden bezogene ,,Dolchstoßlegende". Im September 1918 konstituierte sich innerhalb der Antisemit- ischen Bewegung um die ,,Deutsche Volkspartei" und den ,,Altdeutschen Verband" ein Ausschuß zur ,,Bekämpfung des Judentums". Die Ziele dieses Ausschusses wurden von den beiden führenden Personen deutlich gemacht. H. Laß, schon vor dem Krieg Vorsitzender des ,,Altdeutschen Verbandes", ließ nicht einen Funken Ungewißheit in seinen Äußerungen zu: "Ich werde vor keinem Mittel zurückschrecken und mich in dieser Hinsicht [bezogen auf die Judenpolitik(der Verf.)] an den Ausspruch Heinrich von Kleids, der auf die Franzosen gemünzt war, halten: Schlagt sie tot, das Weltige- richt fragt Euch nach den Gründen nicht!"26 und auch K. v.Gebsattel ließ wenig Un- zweideutigkeiten erkennen als er 1918 sagte:"...die Lage zu Fanfaren gegen das Judentum und die Juden als Blitzableiter für alles Unrecht zu benutzen."27 Die Richtung war also klar.
Mit der Konstituierung des ,,Deutschvölkischen Schutz und Trutzbundes"(Im Folgen- den DSTB) erreichte das Wirken der Antisemiten um Claß und Gebsattel ihren bisherigen Höhepunkt, was in den Wirren der ersten ,,Weimarer - Jahre" nicht besonders schwer war, da die Menschen in dieser chaotischen Epoche sehr schnell für radikale Parolen zu begeistern waren. Das drückte sich auch in Mitgliederzahlen aus, 1919 waren _ 30000 Mitglieder dem DSTB eingegliedert. Besonders unter dem Eindruck des Zusammenschlusses der 3 größten antisemitischen Verbände (DSTB, ,,Reichshammerbund", Deutschvölkischer Bund) 1919 unter der organisatorischen Leitung Alfred Roths, ein begeisterter Rassenfanatiker, ist diese Mitgliederzahl zu betrachten. Es waren 1922 allerdings schon über 200000 Mitglieder im DSTB, was sich keineswegs in dieser Zeit von der übrigen Entwicklungen der Weimarer Republik abhob. Wie schon dargestellt waren die Universitäten im ablaufenden 19. und begin- nenden 20. Jh. ein Hort des Antisemitismus (siehe Kapitel 5 & 6) und so verblüfft es keineswegs, daß 40% der Mitglieder des DSTB Akademiker waren. Ein weiterer Indikator für die antisemitische Hetze in diesem Ausmaßen waren die hohen Auflagen von Büchern wie: ,,Die Protokolle der Weisen von Zion" oder ,,Judas Schuldbuch"..
Die weitere Entwicklung möchte ich nur kurz beleuchten, da es im Allgemeinen und darum sollte es gehen meiner Meinung nach hinlänglich bekannt ist, wie sich das national - völkische Lager, in den verschiedensten Schattierungen betätigte. Vorangetrieben von Krisen innenpolitischer und außenpolitischer Art und sich gleichenden Argumenten. An der Spitze standen anfänglich die vielen Freicorps und natürlich der DSTB, auch die zahlreichen Burschenschaften waren an der antisemitischen Hetze nicht unbeteiligt. Nach dem Hitler - Putsch 1923 und dem Mord an W. Rathenau 1924 sowie nach dem Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929 waren es vorallem national - völkische Verbände und Parteien, die der NSDAP treu zur Seite standen und deren Machtübernahme 1933 erst möglich machten. Ohne einen Hugenberg oder Alfred Roth ohne Claß oder Gebsattel wäre es nicht möglich ge- wesen den Antisemitismus als staatstragendes Element zu etablieren.
Ich hoffe, auch in Anlehnung an das von mir gehaltene Referat mit der kurzen Darstellung der Ereignisse antisemitischer Art in der Weimarer Republik den Intentionen meiner behandelten Fragestellung nahe gekommen zu seien.
8. Zusammenfassung
Wohl kein Thema in der Weltgeschichte ist ausführlicher behandelt worden als der moderne Antisemitismus. Aber auch kein Thema unterlag emotionsgeladeneren Dis- kusionen, nach Kenntnis des Holocaust auch vollkommen zu Recht, wie dieses. Die Frage jedoch wie konnte es zu den Krematorien von Auschwitz kommen wird immer mit viel Spekulativem einhergehen. War es schon Nero der dies vorbereitete oder war es Hitler und seine Mannen allein? Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen und auch immer nicht die absolute seien. Deshalb möchte ich hier keine dazu- fügen. Eines ist mir allerdings nach meinen Recherchen wichtig zu sagen: Es ist nicht nur das Ressentiment gegenüber den Juden, was den Antisemitismus möglich machte sondern es sind Machtgier und Fanatismus. Es heißt Wissen sei Macht, ein trauriger Satz, die Situation an den deutschen Universitäten in den 80 Jahren zwischen 1875 und 1945 betrachtend.
Meiner Meinung nach und das habe ich zu Beginn dieser Abhandlung schon be- schrieben, ist es wichtig aus dem was wir heute wissen Lehren zu ziehen und es ist die Aufgabe der Lehrenden dieses Wissen weiterzugeben um Geschehenes zu verstehen und dadurch eine Wiederholung unwahrscheinlicher zu machen.
9. Literaturverzeichnis
Berding, Helmut: ,,Moderner Antisemitismus in Deutschland", 1988, Suhrkamp Verlag Frankfurt a. M.
Czermak, Gerhard: ,,Christen gegen Juden - Geschichte einer Verfolgung", 2. aktualisiert Neuauflage, 1997, Rowohlt Verlag, Einbeck
Fricke, Dieter (Hrsg.): ,,Die bürgerlichen Parteien in Deutschland", Band I, 1968, Bibliographisches Institut, Leipzig
Gutman, Israel (Haupthrsg.): ,,Die Enzyklopädie des Holocaust", Band I - III, 1995,
R. Piper GmbH & Co. KG München
Kampe, Norbert: ,,Studenten und ,,Judenfrage" im deutschen Kaiserreich", 1988, Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen
Katz, Jacob: ,,Die Hep - Hep Verfolgungen des Jahres 1819", 1994 Metropol Verlag Berlin
Toury, Jacob: ,,soziale und politische Geschichte der Juden in Deutschland 1847-1871", 1977, Droste Verlag, Düsseldorf
[...]
1 E. O.Stelling: ,,Ant i Jewish Piots in Germany in 1819", Historica Judaica, vol.XII zitiert in : Jacob Katz: ,,Die Hep - Hep Verfolgungen des Jahres 1819", 1994, Metropol Verlag Berlin, Seite 11
2 In der Zeit von 1850 - 1945
3 Christentum (entstanden um 0) und Islam (entstanden um 610)
4 während diese Aufstandes wurden nahezu 1000 Siedlungen zerstört und _ 580000 Menschen niedergemetzelt, vergl.: Gerhard Czermak: ,,Christen gegen Juden - Geschichte einer Verfolgung", 2. Auflage 1997, Rowohlt Verlag Reinbek, Seite 20
5 vergl. Gerhard Czermak: ,,Christen gegen Juden - Geschichte einer Verfolgung", 2. Auflage 1997, Rowohlt Verlag Reinbek, Seite 60
6 C. W. Dohm, preußischer Staatsbeamter, veröffentlichte 1781 das Werk: ,,Über die bürgerliche Verbesserung der Juden"
7 Napoleon verfügte 1807 ein Judenedikt, was die rechte der Juden wieder einschränkte, jedoch nicht bedeutete, daß der juristische Zustand vor der franz. Revolution wieder inkraft trat.
8 Gerhard Czermak: ,,Christen gegen Juden - Geschichte einer Verfolgung", 2. Auflage 1997, Rowohlt Verlag Reinbek, Seite 118
9 der Anteil der getauften Juden betrug vor 1948 weniger als 1,5%
10 Helmut Berding: ,,Moderner Antisemitismus in Deutschland", 1988, Suhrkamp Verlag Frankfurt a. M., Seite 61
11 Wilhelm Marr, geb. 16.11.1819, gest. 17.07.1904, W. Marr belegte in seinem 1879 erschienenen Werk: ,,Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum" das Wort Antisemitismus rassisch - biologisch
12 Joseph Arthur Gobineau geb. 14.07.1816, gest. 13.10.1882 in seinem Werk wurden die Juden als rassisch minderwertig dargestellt
13 Dieser hier beschriebene Antisemitismus ist noch wenig divergent zu der herkömmlich Judenfeindschaft, jedoch sind Ansätze von Antisemitismus ,,marrscher" Prägung erkennbar, so damals aber noch nicht unter dem Wort Antisemitismus. Es wird zum allgemeinen historischen Verständniss in der Forschung aber von einem ,,Frühen Antisemitismus" gesprochen.
14 3. - 4. März 1848, die selben Krawalle richteten sich dann auch gegen den grundbesitzenden Adel.
15 siehe Anm. 11
16 ursprünglich der Linguistik entlehnt, die arischen Sprachen: indoarische Sprache = Teil der indogermanischen Sprachfamilie.
17 H. v. Treitschke, geb. 15.9.1834, gest. 28.4.1896
18 Tehodor Mommsen kritisierte Treitscke aufgrund seiner antisemitischen Äußerungen scharf.
19 zieht man von den 100% Studierenden noch die _ 10% jüdischen Studenten ab ( die wohl kaum diese Petition unterschrieben hätten) so erscheint das Ergebnis noch etwas relativiert, es war also nahezu ein Viertel der nichtjüdischen Studentenschaft die die Petition unterschrieben.
20 gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil gab es viele jüdische Industrielle und Finaciers gemessen an der gesamten Bevölkerung, überstieg der Anteil der Juden selten 10%.
21 siehe Anm. 19
22 Norbert Kampe: ,,Studenten und ,,Judenfrage" im deutschen Kaiserreich", 1988 Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Seite 72
23 ebenda
24 Vater Reinhardt Heydrichs ( R. Heydrich Leiter des SD und später des RSHA / Stellv. Himmlers)
25 Julius Marx: ,,Kriegstagebuch eines Juden", Frankfurt 1964, Seite 129 vergl: Helmut Berding: ,,Moderner Antisemitismus in Deutschland", 1988, Suhrkamp Verlag Frankfurt a. M., Seite 168
26 vergl.: Helmut Berding: ,,Moderner Antisemitismus in Deutschland", 1988, Suhrkamp Verlag Frankfurt a. M., Seite 178
Häufig gestellte Fragen zum Antisemitismus
Was ist das Hauptthema dieses Textes?
Dieser Text befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des Antisemitismus, insbesondere in Deutschland und Mitteleuropa, von den Anfängen der Judenfeindschaft bis zur Weimarer Republik. Er untersucht die religiösen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren, die zur Entstehung und Ausbreitung des Antisemitismus beigetragen haben.
Welche historischen Perioden werden in dem Text behandelt?
Der Text deckt einen breiten historischen Zeitraum ab, beginnend mit der Antike und der frühen christlichen Verfolgung der Juden, über die Emanzipation der Juden im 18. und 19. Jahrhundert, die Entwicklung des modernen Antisemitismus im späten 19. Jahrhundert, den Ersten Weltkrieg und schließlich die Weimarer Republik.
Welche Rolle spielten die Universitäten bei der Entwicklung des Antisemitismus?
Der Text betont die tragische Rolle der deutschen Universitäten bei der Entwicklung des Antisemitismus. Er beschreibt, wie an den Universitäten eine antisemitische Stimmung entstand, die durch wirtschaftliche Krisen, Statusangst und die Ablehnung des Liberalismus verstärkt wurde.
Wer waren einige der Schlüsselfiguren, die im Zusammenhang mit dem Antisemitismus genannt werden?
Der Text erwähnt eine Reihe von Schlüsselfiguren, darunter Moses Mendelssohn, Christian Wilhelm Dohm, Wilhelm Marr, Joseph Arthur Gobineau, Heinrich von Treitschke, Alfred Stöcker, Bruno Heydrich, Richard Wagner und Alfred Rosenberg. Diese Personen spielten unterschiedliche Rollen bei der Entwicklung und Verbreitung antisemitischer Ideen.
Was war die Bedeutung des Wortes "Antisemitismus"?
Der Text erklärt, dass Wilhelm Marr das Wort "Antisemitismus" einführte und damit einer gedanklich schon vorbereiteten Bewegung einen Namen gab. Dies markierte den Übergang von religiös geprägter Judenfeindschaft zu einem rassisch und ideologisch geprägten Antisemitismus.
Was waren die Hauptursachen für den Antisemitismus während der Weimarer Republik?
Die Weimarer Republik war geprägt von politischen und wirtschaftlichen Krisen, die den Antisemitismus befeuerten. Die Dolchstoßlegende, die Juden als Verräter der Nation darstellte, sowie die wachsende Popularität völkischer Ideologien trugen zur Radikalisierung des Antisemitismus bei.
Welche Rolle spielten Wirtschaftskrisen bei der Zunahme des Antisemitismus?
Wirtschaftskrisen wie die Gründerkrise und die Weltwirtschaftskrise führten zu sozialer Not und Arbeitslosigkeit, wodurch die Suche nach Sündenböcken verstärkt wurde. Juden wurden oft für wirtschaftliche Probleme verantwortlich gemacht.
Welche Organisationen förderten den Antisemitismus im Deutschen Reich?
Der Text nennt Organisationen wie den Deutschen Handelshilfe Verein (DHV), den Alldeutschen Verband, den Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund (DSTB) und den Reichshammerbund als wichtige Akteure bei der Verbreitung antisemitischer Ideologien.
Welche Lehren können aus der Geschichte des Antisemitismus gezogen werden?
Der Text betont die Bedeutung, aus der Geschichte des Antisemitismus Lehren zu ziehen, um ein Wiederauftreten solcher Ideologien zu verhindern. Er hebt hervor, dass nicht nur Ressentiments gegenüber Juden, sondern auch Machtgier und Fanatismus eine Rolle spielten.
- Quote paper
- Roland Werner (Author), 2000, Antisemitismus in Deutschland von 1800 - 1933, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/98420