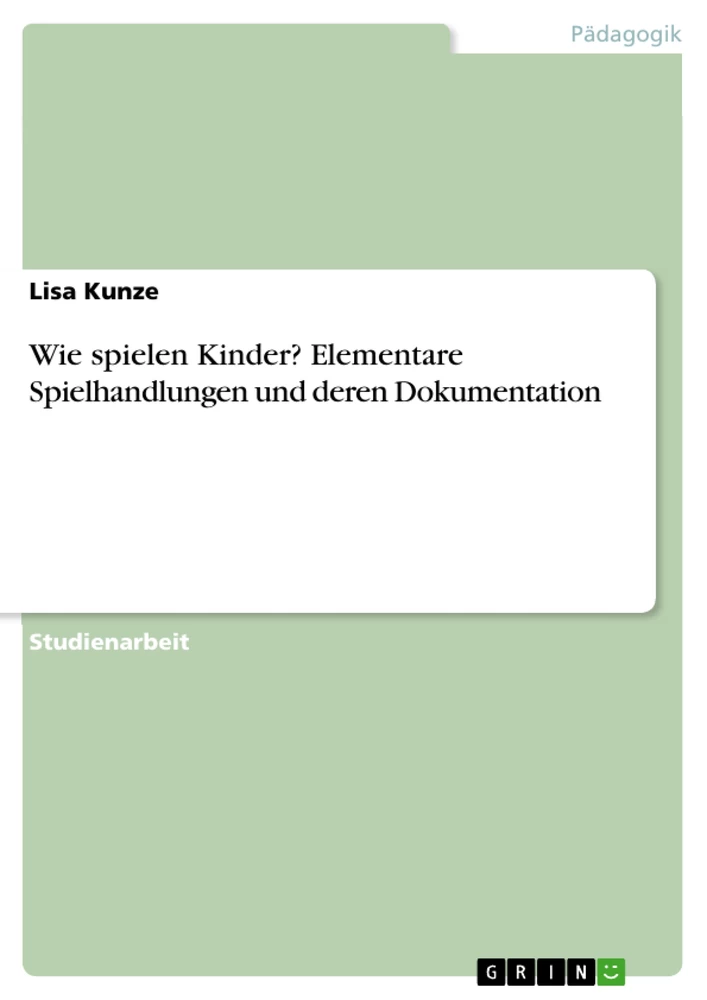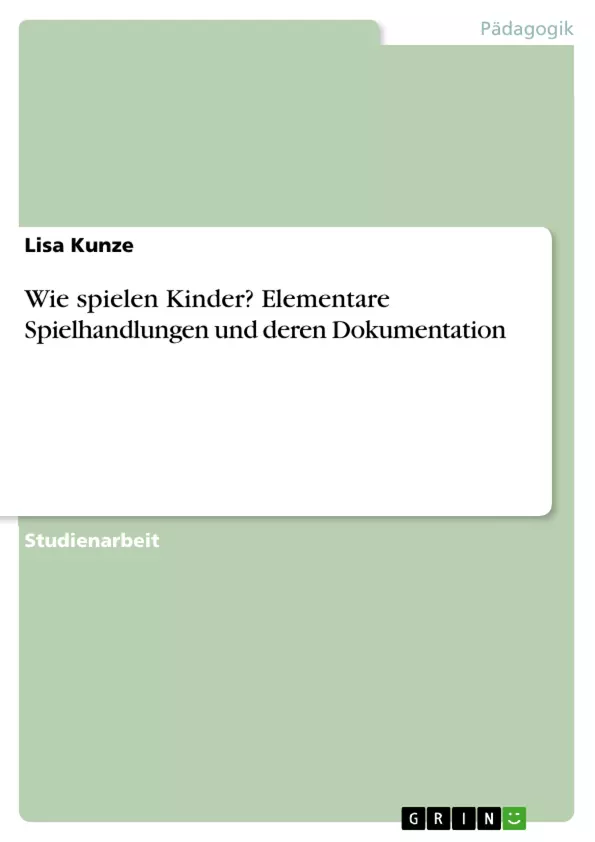In der vorliegenden Arbeit soll die Forschungsfrage welche elementaren Spielhandlungen von Kindern in der Krippe beobachtet werden können und wie diese dokumentiert werden können, beantwortet werden. Diese Arbeit soll Eltern und pädagogischen Fachkräften verdeutlichen, dass Kinder Akteure ihres Lernens sind. Diese Rolle wurde ihnen von Natur aus mitgegeben. Die Grundidee des Konzepts der elementaren Spielhandlungen liegt darin, dass Kinder ohne fremde Einwirkung klug handeln. Alles, was sie dazu benötigen, sind Erwachsene, die dieses Handeln verstehen und gegebenenfalls mit Denkanstößen oder geeigneten Materialien unterstützen.
Kinder beschäftigen sich mit unendlich vielen Fragen. In ihrem Handeln versuchen sie Antworten auf diese Fragen zu finden. Alle Handlungen, die Kinder wiederholt und mit großer Konzentration durchführen, weisen auf einen Selbstbildungsprozess hin. Um insbesondere Kleinkinder unter drei Jahren in dieser Entwicklung optimal begleiten und fördern zu können, lohnt es sich die wiederkehrenden Handlungsmuster genauer zu betrachten und zu dokumentieren.
Aufbauend auf die Einleitung startet die Hausarbeit im zweiten Kapitel mit einer Erläuterung grundlegender Begriffe. Im darauffolgenden Kapitel werden die elementaren Spielhandlungen und die Schematheorie ausführlich beschrieben. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Dokumentation im Portfolio und verdeutlicht dies anhand eines Praxisbeispiels. Abschließend wird die Arbeit gewürdigt und die Bedeutung der Thematik hervorgehoben. Im Rahmen dieser Arbeit werden ausschließlich zwölf elementare Spielhandlungen vorgestellt, da eine vollständige Auflistung und Erläuterung von etwa 40 Spielschemata zu umfangreich wäre.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffserläuterungen
- 2.1 Elementare Spielhandlungen
- 2.2 Early-Excellence-Ansatz
- 2.3 Dokumentation
- 2.4 Portfolio
- 3 Elementare Spielhandlungen von Krippenkindern
- 3.1 Ursprung der Schematheorie
- 3.2 Bedeutung der Schematheorie
- 3.3 Zwölf elementare Spielhandlungen
- 3.3.1 Verstecken
- 3.3.2 Hinter Oberflächen gelangen
- 3.3.3 Umhüllen
- 3.3.4 Transportieren
- 3.3.5 Die Position verändern
- 3.3.6 Umzäunen
- 3.3.7 Die Falllinie untersuchen
- 3.3.8 Den Klang der Dinge untersuchen
- 3.3.9 Die Rotation von Dingen untersuchen
- 3.3.10 Verbinden und Trennen
- 3.3.11 Ordnen
- 3.3.12 Balance
- 4 Dokumentation im Portfolio
- 4.1 Portfolioarbeit
- 4.2 Bedeutung von Portfolios
- 4.3 Portfolios in der Krippe der ActiveKid GmbH
- 4.3.1 Aufbewahrung und Gestaltung des Portfolioordners
- 4.3.2 Portfolioseiten
- 4.3.3 Formulierung der Beobachtungen
- 4.4 Praxisbeispiel: Dokumentation von ausgewählten elementaren Spielhandlungen
- 5 Würdigung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht elementare Spielhandlungen von Krippenkindern und deren Dokumentation im Portfolio. Ziel ist die Darstellung der beiden Themenkomplexe und die Beantwortung der Forschungsfrage: „Welche elementaren Spielhandlungen können in der Krippe beobachtet werden und wie werden diese im Portfolio dokumentiert?“.
- Elementare Spielhandlungen als Ausdruck kindlicher Lernprozesse
- Die Bedeutung der Schematheorie für das Verständnis kindlicher Handlungen
- Die Rolle der Dokumentation im Portfolio für die Beobachtung und Förderung der Entwicklung
- Praxisbeispiel der Portfolio-Dokumentation in einer Krippe
- Bedeutung der Beobachtung und des Verständnisses kindlicher Spielhandlungen für pädagogische Fachkräfte und Eltern
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und führt in die Problematik scheinbar sinnloser Handlungen von Kindern ein. Sie betont die Bedeutung der Beobachtung und Dokumentation wiederkehrender Handlungsmuster als Indikatoren für Selbstbildungsprozesse bei Kleinkindern. Das Ziel der Arbeit ist die Darstellung der elementaren Spielhandlungen und deren Dokumentation im Portfolio, um Eltern und pädagogischen Fachkräften aufzuzeigen, dass Kinder Akteure ihres Lernens sind und Unterstützung durch Verständnis und geeignete Materialien benötigen.
2 Begriffserläuterungen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe der Arbeit, darunter „elementare Spielhandlungen“ (auch Spielschemen oder Schemata genannt), „Early-Excellence-Ansatz“, „Dokumentation“, und „Portfolio“. Es betont, dass elementare Spielhandlungen wiederkehrende Handlungsmuster sind, die Kinder weltweit zeigen und die Aufschluss über deren Erkenntnisgewinn geben. Die Kapitel erläutert, dass nicht jedes Kind alle Schemata ausführt, aber Kombinationen möglich sind und diese Handlungen sich über die Lebensspanne erhalten.
3 Elementare Spielhandlungen von Krippenkindern: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit den elementaren Spielhandlungen und der Schematheorie. Es beschreibt den Ursprung und die Bedeutung der Schematheorie für das Verständnis kindlicher Handlungen und präsentiert zwölf ausgewählte elementare Spielhandlungen (z.B. Verstecken, Umhüllen, Transportieren, Ordnen) als Beispiele für die intensive Untersuchungsarbeit von Kindern, mit der sie die Gesetzmäßigkeiten der Welt erforschen.
4 Dokumentation im Portfolio: Dieses Kapitel widmet sich der Portfolioarbeit und deren Bedeutung für die Dokumentation kindlicher Entwicklung. Es beschreibt die Praxis der Portfolio-Dokumentation in einer Krippe (ActiveKid GmbH), einschließlich der Aufbewahrung, Gestaltung, und der Formulierung von Beobachtungen. Ein Praxisbeispiel zeigt, wie ausgewählte elementare Spielhandlungen dokumentiert werden können.
Schlüsselwörter
Elementare Spielhandlungen, Spielschemen, Schematheorie, Portfolio, Dokumentation, Krippenkinder, Kindheitspädagogik, Beobachtung, Lernprozesse, Selbstbildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Dokumentation Elementarer Spielhandlungen von Krippenkindern im Portfolio
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht elementare Spielhandlungen von Krippenkindern und deren Dokumentation im Portfolio. Der Fokus liegt auf der Darstellung dieser beiden Themenkomplexe und der Beantwortung der Forschungsfrage: „Welche elementaren Spielhandlungen können in der Krippe beobachtet werden und wie werden diese im Portfolio dokumentiert?“.
Welche zentralen Begriffe werden in der Arbeit erläutert?
Die Arbeit definiert wichtige Begriffe wie „elementare Spielhandlungen“ (auch Spielschemen oder Schemata genannt), den „Early-Excellence-Ansatz“, „Dokumentation“ und „Portfolio“. Elementare Spielhandlungen werden als wiederkehrende Handlungsmuster beschrieben, die Aufschluss über den Erkenntnisgewinn von Kindern geben.
Was sind elementare Spielhandlungen und welche Bedeutung haben sie?
Elementare Spielhandlungen sind wiederkehrende Handlungsmuster, die Kinder weltweit zeigen. Sie sind Ausdruck kindlicher Lernprozesse und geben Aufschluss über den Erkenntnisgewinn der Kinder. Die Arbeit nennt zwölf Beispiele, wie z.B. Verstecken, Umhüllen, Transportieren oder Ordnen. Diese Handlungen zeigen, wie Kinder die Gesetzmäßigkeiten der Welt erforschen.
Welche Rolle spielt die Schematheorie?
Die Schematheorie ist zentral für das Verständnis kindlicher Handlungen. Die Arbeit erläutert ihren Ursprung und ihre Bedeutung für die Interpretation der beobachteten Spielhandlungen. Die Schemata werden als wiederkehrende Handlungsmuster beschrieben, die sich über die Lebensspanne erhalten können.
Welche Bedeutung hat die Portfolio-Dokumentation?
Die Portfolio-Dokumentation spielt eine wichtige Rolle für die Beobachtung und Förderung der kindlichen Entwicklung. Die Arbeit beschreibt die Praxis der Portfolio-Dokumentation in einer Krippe (ActiveKid GmbH), einschließlich der Aufbewahrung, Gestaltung und Formulierung von Beobachtungen. Ein Praxisbeispiel zeigt die Dokumentation ausgewählter elementarer Spielhandlungen.
Wie wird die Portfolio-Dokumentation in der ActiveKid GmbH praktiziert?
Die Arbeit beschreibt die praktische Umsetzung der Portfolio-Dokumentation in der Krippe der ActiveKid GmbH. Dies beinhaltet die Aufbewahrung und Gestaltung des Portfolioordners, die Gestaltung der Portfolioseiten und die Formulierung der Beobachtungen der elementaren Spielhandlungen.
Wer profitiert von den Erkenntnissen dieser Arbeit?
Die Erkenntnisse dieser Arbeit sind relevant für pädagogische Fachkräfte und Eltern. Sie sollen dazu beitragen, das Verständnis für kindliche Spielhandlungen zu verbessern und die Bedeutung der Beobachtung und Dokumentation für die Förderung der kindlichen Entwicklung aufzuzeigen. Die Arbeit betont, dass Kinder Akteure ihres Lernens sind und Unterstützung durch Verständnis und geeignete Materialien benötigen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begriffserläuterungen, Elementare Spielhandlungen von Krippenkindern, Dokumentation im Portfolio und Würdigung und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der Thematik, von der Einführung der Problematik bis hin zur praktischen Anwendung und den Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Elementare Spielhandlungen, Spielschemen, Schematheorie, Portfolio, Dokumentation, Krippenkinder, Kindheitspädagogik, Beobachtung, Lernprozesse, Selbstbildung.
- Quote paper
- Lisa Kunze (Author), 2019, Wie spielen Kinder? Elementare Spielhandlungen und deren Dokumentation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/983710