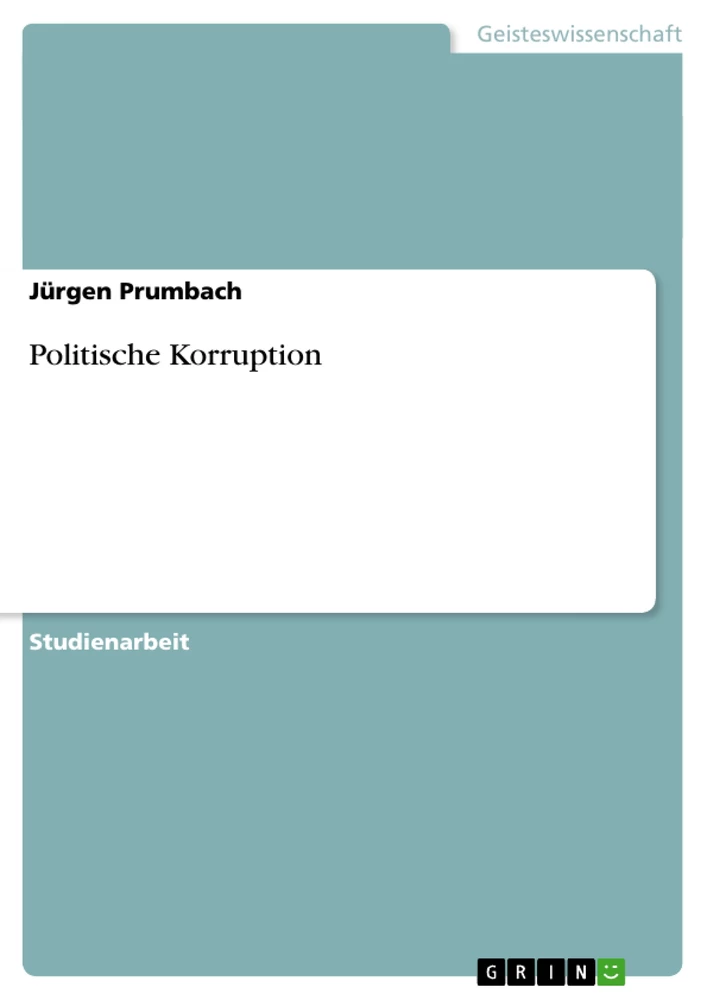Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Allgemeine Definitionen von Korruption in der Literatur
1.1 Der Korruptionsbegriff bei Neckel
1.2 Der Korruptionsbegriff bei Smelser
2. Verschiedene Aspekte zur politischen Korruption
2.1 Unterscheidung von Konzeptionen zur Beschreibung und Erklärung von politischer Korruption
2.1.1 Korruption im Amt zum Zwecke privater Interessendurchsetzung
2.1.2 Politische Korruption als Konflikt zwischen privater und öffentlicher Moral und Interessen
2.1.3 Korruption als tauschförmige Nutzenmaximierung
2.2 Eine rechtliche Betrachtung des Begriffes der politischen Korruption
2.2.1 Die Bestechlichkeitsbestimmungen des Strafrechts und deren tatbestandlichen Voraussetzungen
2.2.2 Einfallstore für politische Korruption
2.3 Zur Rolle der Massenmedien - Instrument der ,,Skandalisierung" oder ,,Vierte Gewalt" ?
2.4 Die Hauptstadt- Affäre 1949
2.5 Korruptionsvorbeugung und Korruptionsbekämpfung
Abschließende Betrachtung
Literaturverzeichnis
Abschlusserklärung
Einleitung
,,I'm a man of principle. Once I`bought, I stay bought" (Drew 1983: 97), ist ein amerikanischer Politikerwitz, der die Thematik des Themas treffend umschreibt. Das Wesen politischer Korruption wird nachfolgend erschlossen und an Hand der Hauptstadtaffäre von 1949 konkretisiert.
Die Arbeiten von Smelser und Neckel dienen im ersten Kapitel der Erschließung des allgemeinen Korruptionsbegriffes.
Nach einer vorläufigen begriffssemantischen Klärung von Korruption werden im zweiten Kapitel zunächst die Wesensmerkmale der politischen Korruption herausgearbeitet. Dazu werden die Konzepte des Autorenteams von Alemann/Kleinfeld zur Erklärung von Korruption im Amte zum Zwecke der persönlichen Vorteilsnahme, zur Erklärung des Konfliktes zwischen privater und öffentlicher Moral und Interessen und des Konzeptes der privaten Nutzenmaximierung vorgestellt, um anschließend rechtliche Aspekte zu beleuchten. In diesem Zusammenhang darf die Rolle der Medien nicht außer Acht gelassen werden, und es wird der Frage nachgegangen, ob sie als ,,Provokative oder die Vierte Gewalt" bezeichnet werden können.
Exemplarisch wird ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, und zwar das der Hauptstadtaffäre von 1949 herangezogen, um ein plastisches Bild von Skandalisierung, die durch mediale Aufdeckung eintritt, aufzuzeigen, und um deren Auswirkungen in der politischen Landschaft zu verdeutlichen.
Im darauf folgenden Abschnitt wird untersucht, welche Möglichkeiten der Bekämpfung und Vorbeugung existieren.
Es bleibt zu hoffen, dass diese Arbeit dem interessierten Leser als eine Einleitung in das Wesen der politischen Korruption dienen wird und vielleicht das Interesse weckt, sich mit bestimmten Aspekten der Thematik noch intensiver zu befassen.
1. Allgemeine Definitionen von Korruption in der Literatur
In diesem ersten Abschnitt wird der Gegenstand der Korruption in der soziologischen Forschung an Hand zweier Autoren aufgezeigt. Unter Punkt 1.1 betrachtet Jürgen Prumbach nach Sighard Neckel Korruption unter dem Gesichtspunkt der Moral. Gewicht wird auch auf die Situation des Tausches gelegt (vgl. Neckel 1995). In der darauffolgenden Betrachtung legt der Autor Smelser seinen Schwerpunkt auf die Darstellung der verschiedenen Tauschmedien. Mit deren Hilfe wird zunächst eine Definition gegeben, dann der Begriff der Korruption von anderen Phänomenen abgegrenzt und schließlich wird noch auf korruptionsfördernde Aspekte eingegangen (vgl. Smelser 1971: 208-215).
1.1 Der Korruptionsbegriff bei Neckel
In seinem Aufsatz über das Wesen der Korruption findet Neckel den Einstieg, indem er die Tatsache aufzeigt, ,,[...] daß man Korruption empörend findet und sie zugleich als vollständig normal betrachtet" (Neckel 1995: 9).
Auf der einen Seite seien wir über einen illegitimen Akt von Bestechung entrüstet, andererseits zeige die Sichtweise der Normalität auch den Zustand unserer heutigen Gesellschaft, in der mit der Käuflichkeit von allem und jedem zu rechnen sei (vgl. Neckel 1995: 9).
Doch um herauszufinden, was gerade schlecht an der Korruption sei, müsse man sich die Besonderheiten dieser Form des Tausches vergegenwärtigen. Zunächst sei auch die Korruption - wie jede Form von Käuflichkeit - ein Vorgang des Tausches, ,,[...] bei dem ein Gut durch die Hingabe einer Gegenleistung seinen Besitzer wechselt" (Neckel 1995: 9), weshalb sie dem Betrachter auch geläufig erscheine. Entscheidend seien jedoch die moralischen Regeln, die diese Handlung begleiten (vgl. Neckel 1995: 9). Ein Prinzip behaupte, dass Menschen eine gegenseitige Verpflichtung durch den Tausch eingingen. Anders als bei einer Schenkung müsse für das eine Gut etwas anderes hergegeben werden. ,,Die Gabe muss erwidert, die Leistung entgolten, der Preis bezahlt werden"(Neckel 1995: 10).
Die zweite moralische Norm postulieret, dass ein Gut nicht getauscht werden dürfe, wenn es als unveräußerlich gelte (vgl. Neckel 1995: 10). Nicht alle Dinge, die wir kennen würden, seien käuflich. Die Frage, wann ein Gut ge- und, vor allem, verkauft werden dürfe, hänge mit dem Stellenwert des jeweiligen Gutes bei moralischen Regeln und Verboten zusammen. So hätten beide Güter den gleichen Wert aufzuweisen. Neckel spricht hier vom sogenannten ,,moralischen Äquivalenzprinzip" (Neckel 1995: 11).
Fortführend beschreibt der Verfasser, wie eine Gesellschaft korrupte Mitglieder sanktioniert. So würden korrupte Personen in ihrem Ansehen abgewertet. Dies geschähe, indem sich der Akt der Käuflichkeit auf die ganze Person ausweite und sie so in ihrer Würde herabsetzen würde (vgl. Neckel 1995: 11). Jedoch gibt es auch den seltenen Fall, dass eine Person aus ihrer Käuflichkeit gar keinen Hehl mache, sondern so diesen Skandal ausnutze, um ihre Anerkennung seitens der Gesellschaft zu beweisen oder zu steigern (vgl. Neckel 1995: 12)1. Auf den nächsten Seiten versucht der Autor zu ergründen, warum Menschen sich trotz der Gefahr einer gesellschaftlichen Ächtung zu korrupten Handlungen bewegen ließen. Mit dem pauschalen Urteil, korrupte Menschen hätten schwache Wesenszüge, könne der Sachverhalt nicht ausreichend erklärt werden (vgl. Neckel 1995: 13). Die Crux liege nach Neckel in dem Vortäuschen der angeblichen Geringfügigkeit des Handelns. Es müsse bei beiden Beteiligten ,,[...] die Illusion eines allenfalls läßlichen Fehlverhaltens"(Neckel 1995: 13) bewahrt werden. Als erstes beschreibt der Verfasser das Verhalten gegenüber der zu korrumpierenden Person, um danach das Verhalten für die Durchführung des Aktes selbst zu beschreiben. Zwei Verhaltensweisen gegenüber der Zielperson seien einzuhalten.
Erstens: Dem Korrumpierten dürfe durch den Korrumpierenden nicht offen gesagt werden, dass er korrumpiert werde. Diese offene Äußerung könne die Person beleidigen, und so die geplante Aktion erst gar nicht zustande kommen lassen (vgl. Neckel 1995: 13).
Der zweite Punkt sei das Verbot gegenüber der Zielperson, welche die gewünschte Leistung direkt und unmittelbar einfordere.
,,Besser ist es, wenn sich das unsittliche Verhalten auf gleiche Weise wie das moralische Handeln einstellt, das sich - einer schon älteren Überzeugung nach - ja von selber versteht"(Neckel 1995: 13).
Denn die Geschichte einer Korruption verlaufe über eine längere Zeitspanne, an deren Anfang ein vermeintliches Sympathiegefühl für einander stehe, welchem erst einige kleine Gefälligkeiten folgen würden, ehe es um die Tat als solche gehe (vgl. Neckel 1995: 13). Diese scheinbare Freundschaft sei maßgeblich dafür verantwortlich, dass bei den korrupten Menschen kein Unrechtsgefühl aufkomme (vgl. Neckel 1995: 13).2
Interessant sei die Gestalt des Schmiergeldes. Weit besser als Geld wirke die Bezahlung in anderen Tauschmedien, wie zum Beispiel Sachzuwendungen. Doch auch hier herrsche das Prinzip der Reziprozität vor (vgl. Neckel 1995: 14). Der Autor kommt nun zu der Einteilung in zwei verschiedene Formen der Korruption.
,, Die gebräuchlichste Form einer Kuvrierung des Kaufpreises ist die Zustellung von Geschenken" (Neckel 1995: 14).
Die scheinbare Legalität werde dadurch erreicht, dass man die Zuwendung als Sympathiebekundung und nicht als Preis für eine Leistung plakatiere (vgl. Neckel 1995: 14). Eine zweite Form der Korruption basiere auf dem Prinzip, jemandem eine Zuwendung zu geben und dann darauf zu warten, bis dieser sich zu einer bestimmten Zeit an den edlen Spender erinnere und dann seine Gegenleistung erbringe (vgl. Neckel 1995: 14). So könne es zu längerfristigen Verpflichtungen kommen. In beiden Fällen sei die Aufklärung3 schwierig.
In der zweiten Form auf jeden Fall, da eine lange Verpflichtung die Spur verwische und so die Verbindung der Personen von Dritten nicht nachvollzogen werden könne (vgl. Neckel 1995: 15). Auch würden oft Güter als Preis bezahlt, die relativ schnell verbraucht würden. Zu dieser Gruppe zählten vor allem exklusive Reisen oder Bordellbesuche (vgl. Neckel 1995: 15). Doch auch das Tauschmedium Geld eigne sich gut für den Akt der Korruption: ,,Im Unterschied zu Zeiten, als Menschen noch mit Armreifen, Schafsherden oder Ländereien gekauft worden sind, hat Geld die Eigenschaft, im Irgendwo verschwinden zu können" (Neckel 1995: 15).
Diese Aussage unterstreiche auch die Bedeutung von Geld in der Korruption der Moderne. Ein anderer wichtiger Punkt sei die Menge des Geldes. In einer Gesellschaft in der alles gekauft werden könne, sei auch die Seele käuflich. Nicht das zu tauschende Gut sei problematisch: Je höher der Preis, desto geringer sei das Gefühl der Käuflichkeit bei der korrupten Person (vgl. Neckel 1995: 15).
1.2 Der Korruptionsbegriff bei Smelser
Der amerikanische Wirtschaftssoziologe Neil Joseph Smelser (vgl. Hillmann 1994: 791) gründet seine Definition von Korruption auf verschiedene Tauschmedien und deren unterschiedliche Ausprägungen in verschiedenen Systemen (vgl. Smelser 1971: 208). Er stellt einleitend fest, dass Korruption erst einmal ein Tausch von Sanktionen oder Belohnungen zwischen verschiedenen Parteien sei (vgl. Smelser 1971: 208). Um sie von anderen Phänomenen klar abgrenzen zu können zieht er das Schema der generalisierten Medien heran, welches vor allem durch den Soziologen Parsons entwickelt worden sei (vgl. Smelser 1971: 208). Generalisierte Medien seien Mittel, welche die Interaktion von Menschen steuern und absichern würden (vgl. Hillmann 1994: 382). Im Einzelnen seien dies Reichtum, Macht, Einfluss und Wertbindung.
Reichtum sei ein Produkt der Wirtschaft und diene der Klassifikation von Gütern hinsichtlich ihres Wertes (vgl. Smelser 1971: 208). Es ließe sich auch der Begriff Geld in unserem heutigen Wirtschaftssystem dafür einsetzen.
Das zweite Medium - Macht - könne als die Fähigkeit eines politischen Systems zur Sicherung des Einhaltens bindender Verpflichtungen gegenüber den Mitgliedern angesehen werden (vgl. Smelser 1971: 208).
Mit Einfluss könne man das Bestreben einer Person bezeichnen, auf das Verhalten von jemandem einzuwirken, indem sie an Normen appelliere, welche für beide verpflichtend seien (vgl. Smelser 1971: 208f.).
Wertbindung sei nach Smelser ein Medium, um Orientierungsleitlinien zu halten. Anders als der Einfluss beruhe dieses Medium auf Pflicht und nicht auf Überredung (vgl. Smelser 1971: 208f.). Eine wichtige Eigenschaft dieser Medien sei die Ebene ihrer Ausprägung in verschieden entwickelten Systemen (vgl. Smelser 1971: 209f.). Für das Medium Reichtum bedeute dies, dass es in wirtschaftlich wenig entwickelten Systemen wie der Tauschwirtschaft nicht sehr bedeutsam sei, ,,da er auf den situationsgebundenen Austausch konkreter Güter beschränkt ist [...]" (Smelser 1971: 209). Doch in der Geldwirtschaft zum Beispiel komme dem Reichtum die Funktion eines Wertesymbols und nicht nur die Bedeutung eines Interaktionsmediums zu (vgl. Smelser 1971: 209). Je generalisierter ein System werde, desto größer werde auch die strukturelle Differenzierung der Gesellschaft. Dies sei nach Smelser eine Art Begleiterscheinung (vgl. Smelser 1971: 209). Smelser spricht sogar von einer gegenseitigen Beziehung zwischen einer höheren Generalisierungsebene und einem höheren Niveau der strukturellen Differenzierung im Gesellschaftssystem (vgl. Smelser 1971: 210). Nach diesen einführenden Bemerkungen gibt der Autor nun die drei grundlegenden Eigenschaften an, welche vorhanden sein müssten, damit von Korruption gesprochen werden könne (vgl. Smelser 1971: 210).
Zunächst müsse das politische System ein Gefüge von unterscheidbaren Elementen vorweisen, wobei offen bleibe, was genau unter Mindestniveau verstanden werden solle (vgl. Smelser 1971: 210). Auch sei es notwendig, dass zwischen öffentlichen und privaten Interessen unterschieden werden könne und es so möglich werden würde, dass das Gemeinwohl sich gegen subjektive Interessen durchsetzen könne (vgl. Smelser 1971: 210f.). So könne es passieren, dass eine Handlung in einer Gesellschaft als korrupt angesehen werde und in einer anderen nicht. Es komme immer auf die strukturelle Differenzierung und das öffentliche Interesse an (vgl. Smelser 1971: 210f.).
Zweitens spreche man von einer Korruption, wenn sich ökonomische und politische Sanktionen überkreuzen würden (vgl. Smelser 1971: 211). Eine Person dürfe also nicht politische Ausnahmeregelungen gegen Geld kaufen, da hier eindeutig das Verhalten des Beamten, welches durch politische Normen und Gesetze geregelt sei, mit den Sachzuwendungen, welche aus dem ökonomischen Privatinteresse entspringen würden, kollidiere (vgl. Smelser 1971: 211).
,,Bei der Korruption werden ökonomische gegen politische Belohnungen getauscht"(Smelser 1971: 211).
Smelser gibt noch eine dritte Notwendigkeit, um bei einer Handlung von Korruption sprechen zu können.
,,Damit eine Handlung als korrupt bezeichnet werden kann, muß zumindest eine überkreuzende Sanktion auf einer anderen Generalisierungsebene liegen, also situationsspezifisch sein"(Smelser 1971: 211).
So bereichere sich jemand bei der Korruptionsform des Interessenskonfliktes, indem er eine Handlung ausführe oder sie unterlasse. In diesem Fall sei der ungeneralisierte Aspekt die Handlung selbst (vgl. Smelser 1971: 212). Bereichere sich eine Person durch den Missbrauch von öffentlichen Mitteln, so liege der ungeneralisierte Aspekt bei dieser Unterschlagung auch in einer konkreten politischen Handlung (vgl. Smelser 1971: 212). Auch bei der Bestechung werde eine Handlung durch die korrupte Person ausgeführt, indem sie sich weigere, bei einem bestimmten Vorgang tätig zu werden (vgl. Smelser 1971: 212). In diesem Fall seien sowohl die politische Handlung als auch die Entrichtung des Bestechungsbetrages ungeneralisiert (vgl. Smelser 1971: 212).
Um nun im folgenden das Phänomen der Korruption von anderen unterscheiden zu können, werden die bisherigen Erkenntnisse zusammengefasst.
,,Korruption beinhaltet also die unmittelbare und situationsspezifische Ausführung einer politischen Handlung im Austausch für eine ökonomische Sanktion"(Smelser 1971: 212).
So definiert könne Korruption von der Einflussnahme von sogenannten Lobbys oder politischen Cliquen unterschieden werden, denn bei diesen Formen der Einflussnahme sei das Merkmal der Zufälligkeit charakteristisch (vgl. Smelser 1971: 212). Würden Wahlkampfspenden oft moralisch kritisiert, so fielen sie jedoch nicht unter den Oberbegriff der Korruption, da eine politische Handlung seitens des Politikers nicht erfolgen könne (vgl. Smelser 1971: 212). Anders sehe die Situation aus, wenn der Politiker seinem Förderer für den Fall eines Wahlsieges Gegenleistungen oder besondere Behandlung versprechen würde (vgl. Smelser 1971: 212). Die Korruption gehöre also zu einer Gemeinschaft von einflussnehmenden Handlungen, bei denen ,,ein situationsspezifisches Überkreuzen von verschiedenen Arten von Medien stattfindet"(Smelser 1971: 212).
Nach der Definition und Einordnung des Begriffes müsse nun der Blick auf die Umstände gerichtet werden, welche die Entstehung der Korruption begünstigten (vgl. Smelser 1971: 213). Da finde sich das Phänomen, dass zwischen staatlichen und regionalen Systemen der politischen Autorität Spannungen entstehen (vgl. Smelser 1971: 213). In einem Staat gebe es viele verschiedene Untersysteme, welche ihren Ursprung in verwandtschaftlichen Beziehungen, Gemeinden oder Kasten und Sippen hätten (vgl. Smelser 1971: 214). Da nun ein nationalstaatliches System für alle Untersysteme gelten solle, würden nun die einzelnen kleinen Systeme überlagert und es entstehe eine Art Konkurrenz (vgl. Smelser 1971: 213f.).
Vielen Autoren nach zu urteilen, entstehe Korruption vor allem aus dieser Konkurrenz heraus (vgl. Smelser 1971: 214). So könne es dazu kommen, dass ein Beamter, welcher loyal gegenüber seinem Staat sei, auch loyal gegenüber den Mitgliedern seiner Sippe sein müsse (vgl. Smelser 1971: 214). Es werde auf diese Weise leicht politische Autorität durch regionale Strukturen überlagert.
Aber Korruption könne auch als Vermittler bei Spannungen zwischen zwei verschiedenen Systemen auftreten (vgl. Smelser 1971: 214). Die Korruption gehöre dann weder zu den nationalen noch regionalen Systemen, sondern bilde eine ganz neue Ebene der Verständigung, da beide Seiten akzeptiert würden und sich so gegenseitig aufeinander einstellen könnten (vgl. Smelser 1971: 214).
Eine weitere begünstigende Bedingung für das Entstehen von Korruption sei die Fähigkeit, in die Beziehungen zwischen Systemen Vertrauen zu gründen und ihnen so eine konkrete Form zu verleihen (vgl. Smelser 1971: 214f.). So würden Sanktionen nicht mehr alleinig aus traditionellen und lokalen Autoritätssystemen erwachsen, sondern ,,[...] werden nun in den Dienst der generalisierten politischen Loyalität gegenüber einem Staatsapparat gestellt [...]"(Smelser 1971: 214). Um Vertrauen in das System zu erlangen, bediene sich eine Person auch der Korruption, da sie als Anpassungsleistung an neue Beziehungen zwischen Bürokrat und Allgemeinheit verstanden werden könne (vgl. Smelser 1971: 215).
2. Verschiedene Aspekte zur politischen Korruption
In diesem Kapitel wird versucht, ein Bild der politischen Korruption zu definieren. Dabei wird das Thema von verschiedenen Seiten aus betrachtet: Zunächst wird sich der allgemeinen Beschreibung des Phänomens der politischen Korruption gewidmet, ehe dann eine rechtliche Betrachtung erfolgt. Ein weiteres Augenmerk soll auf die Rolle der Medien im Zusammenhang mit politischer Korruption gelegt werden. Schließlich werden die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse auf ein konkretes Beispiel aus der Geschichte angewendet. Abschließend soll noch auf die Frage nach Möglichkeiten der Vorbeugung und Bekämpfung von politischer Korruption eingegangen werden.
2.1 Unterscheidung von Konzeptionen zur Beschreibung und Erklärung von politischer Korruption
Da zunächst definitorische Erklärungen für das Phänomen der Korruption von den beiden Autoren Neckel und Smelser genannt wurden wird jetzt auch eine kausal analytische Sichtweise seitens der Literatur betrachtet (vgl. Bellers 1989: 5). Bellers unterscheidet zwischen einer systematischen und einer individualistischen Erklärung von Korruption (vgl. Bellers 1989: 5). Die systematische Erklärung beinhalte als Kernaussage, dass Korruption eine Folgeerscheinung von grundlegenden Veränderungsprozessen sei (vgl. Bellers 1989: 5). So passten sich die Mitglieder eines Systems nicht an den allgemeinen Modernisierungsprozess an, sondern versuchten ihre Strukturen zu bewahren (vgl. Bellers 1989: 5). Wenn Mitgliedern eines Systems durch einen sich vollziehenden Wandel Nachteile entstehen, so versuchten sie diese durch korrupte Praktiken wenigstens anteilsmäßig zu kompensieren (vgl. Bellers 1989: 5). Aber nicht nur einzelne Strukturen wandelten sich. Korruption könne auch ein Indikator für den Wechsel eines ganzen Systems sein. ,, Auf ebenso systematischer Basis ist unter dem ökonomischen Aspekt Korruption - so zynisch es klingen mag - die Ablösung einer monopolistischen Staats-Bürokratie durch einen freien Markt [...]"(Bellers 1989: 6).
Würde man sich der individualistischen Erklärung von Korruption zuwenden, so werde diesem Verhalten zwar eine Funktionalität zugeschrieben, welche jedoch nur vorherrsche, wenn gegen Korruption vorgegangen werde (Friedrich 1973: 139, zitiert nach Bellers 1989: 6f.). Die Theologie sehe die Funktion von Korruption vor allem in der Schaffung oder Stärkung des gesellschaftlichen Moralbewusstsein durch eine negative Vorbildfunktion (vgl. Bellers 1989: 7). Als Weitere Institution gebe die Verhaltensforschung der Korruption die Funktion, dass sich durch sie ein Bruch von speziellen Gruppennormen erkennen ließe. Eine Person werde durch ein solches abweichendes Verhalten erst zum Individuum, was aber nicht heißen solle, dass es nicht auch bessere Möglichkeiten dafür gebe (vgl. Bellers 1989: 7). Der weitere Erklärungsansatz gründe sich auf der Einteilung von Korruption, welche von Heidenheimer et al. in ihrem Ausführungen gewählt wurde und die,,[...] so etwas wie den state of the art der internationalen Korruptionsforschung verkörpert" (von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 259). Deren Erklärung beinhalte hauptsächlich drei Aspekte: Zunächst Amt und Mandat als politische Ressourcen zur eigenen Interessendurchsetzung. Zweitens den Aspekt des Tauchcharakters von politischen und ökonomischen Ressourcen und als dritten Aspekt den Konflikt zwischen privaten und öffentlichen Interessen (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 263).
2.1.1 Korruption im Amt zum Zwecke privater Interessendurchsetzung
Es ließe sich sagen, dass die Korruption erst mit der Entstehung eines Verwaltungs- und Beamtenapparates als Pflichtverletzung eines Staatsdieners gegenüber seinem Dienstherren auftrete (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 263). Besonders in der Zeit von der Gründung des Deutschen Reiches 1871 bis ca. zum ersten Weltkrieg hätte der Wert des unbestechlichen Beamten in der Werteordnung der deutschen Gesellschaft höher als in anderen Staaten gestanden (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 264). Dass der Deutsche Beamte heute jedoch fehlbarer sei als sein Ruf, belegt Paul Noack in seiner entmythologisierenden Äußerung.
,, Die Deutschen haben sich gern in dem Glauben gewiegt, einen jener Staaten zu besitzen, die sich schon immer am widerstandsfähigsten gegen Korruption gezeigt haben"(Noack 1985: 113). Dieser Standpunkt wird auch von Ahlf vertreten (vgl. Ahlf 1998: 7). Eine genaue strafrechtliche Betrachtung der Korruption wird an anderer Stelle4 der Hausarbeit vorgenommen, es wird nur darauf hingewiesen, dass es den Tatbestand der Korruption im Deutschen Strafgesetzbuch nicht gebe und es nur bei Amtsträgern die Tatbestände der Vorteilsannahme, der Bestechung, der Vorteilsgewährung und der Bestechlichkeit gebe (vgl. Ahlf 1998: 27).
Der Begriff der privaten Interessendurchsetzung als Motiv für die Durchführung abweichenden Verhaltens ließe eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten zu, da sich hinter ihm die unterschiedlichsten Motive, Strategien, Ziele und Wirkungen verbergen könnten (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 267). Andererseits sei der juristische Terminus der Verfehlung im Strafgesetzbuch durch Paragraphen klar geregelt und von anderen Phänomenen5 zu unterscheiden (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 267). Dies ließe nur wenig Spielraum, um das Konzept zu verallgemeinern und zu theoretisieren (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 267). Der Tübinger Staatsrechtler Theodor Eschenburg sehe einen wesentlichen Grund für die Entstehung der politischen Korruption in dem Nachdenken von Politikern über eine Art privater Altersvorsorge (vgl. Noack 1985: 123f.). Diese wollten aber auch so etwas wie eine Versicherung für den Fall, dass sie ihr Amt irgendwann einmal wieder verlieren würden: ,,Ihr Sekuritätsdenken geht nämlich über die materielle Sicherung für die Zeit ihrer Parlamentstätigkeit hinaus. Sie wollen ebenso eine ,Versicherung gegen Mandatsverlust` wie - wenn es denn doch geschehen sollte - Entschädigungen für den Fall des Falles"(Noack 1985: 123f.).
2.1.2 Politische Korruption als Konflikt zwischen privater und öffentlicher Moral und Interessen
Um das Wesen der Korruption unter diesem Aspekt erschließen zu können empfehle es sich, zunächst nicht den Punkt der Regelverletzung im Zusammenhang mit politischer Korruption zu sehen, sondern die Form des allgemeinen sozialen Handelns näher zu beleuchten, wie es in verschiedenen Teilbereichen der Geisteswissenschaften thematisiert werde (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 267).
,,Soziales Handeln ... soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist" (Weber, zitiert nach Barth 1997: 35).
Da bei der Korruption Personen bevorteilt würden, obwohl es ihnen nicht zustehen würde, weiche diese Verhaltensform von der Normalität ab und könne demnach als Form abweichenden Verhaltens bezeichnet werden (vgl. Benz in Benz/Seibel 1992: 60). Das Problem, welches Korruption mit der privaten und auch der öffentlichen Moral habe kann so beschrieben werden, dass durch die öffentliche Diskussion oder auch die Art der strafrechtlichen Sanktionierung eine Einsicht in das abweichende Verhalten seitens der Gesellschaft und auch seitens der Täter selten anzutreffen sei, und es so eher zu einer Tolerierung als zu einer moralischen Verurteilung oder Ächtung der Korruption kommen könne (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 269). Ahlf führt übereinstimmend dazu aus:
,,Trotz der öffentlichen Ächtung der Korruption kommt ein Selbsteingeständnis überführter Täter [...] höchst selten vor und auch das Unrechtsbewußtsein ist bei den Vorteilsnehmern kaum anzutreffen" (Ahlf 1998: 7).
Diese Eigenschaft der Korruption sei im Folgenden hilfreich. Nur gebe sie keine Erklärung für Bedingungsfaktoren der politischen Korruption (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 269). Für diese Tatsache nützlich sei die Erkenntnis, dass die rechtlichen Sanktionen des Strafgesetzbuches die sichtbarsten Merkmale dieser Konzeption darstellen würden (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 269). Eine Erklärung von Korruption unter dem Gesichtpunkt der Schädigung des Allgemeininteresses finde sich unverkennbar bei Autoren politischen Denkens (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 269). Allgemein festzustellen sei die These, dass durch politische Korruption die Gesellschaftsstruktur sowie die Institutionen des politischen Systems untergraben und geschädigt werde (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 269). Als letzten Unterpunkt dieses Teilabschnittes sei noch die staatsphilosophische Korruptionstheorie zu nennen, welche ,,[...] moralische, soziale und institutionelle Bedingungsfaktoren der politischen Korruption verknüpf[e] sowie anhand des Menetekels politischen Zerfalls auch Anleitungen zum Kampf gegen die Korruption [...]" (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 269f.) gebe. Hierbei sei jedoch die Ächtung der politischen Korruption als Hemmung sowie subversives Element Grundvoraussetzung (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 270). Gerade dieser Punkt sei es, der erfüllt werden müsse, damit Präventionsprogramme ansetzen könnten und Aussicht auf Erfolg hätten (vgl. Ahlf 1998: 53).
2.1.3 Korruption als tauschförmige Nutzenmaximierung
Der Historiker Jacob van Klaveren vergleiche den Beamten als Unternehmer, welcher je nach Nachfrage etwas verkaufe, um seinen persönlichen Profit zu steigern (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 270). Van Klaveren sei einer der Autoren, welche die Korruptionsforschung mit dem Gesichtspunkt einer ,,[...] ökonomischen Kosten-Nutzen- Argumentation [...]" (von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 270) bereichert hätte. Korruption werde also als ein individuelles Mittel der Profitmaximierung unter Marktgesetzen verstanden. Eine Besonderheit des korrupten Tausches in politischen Systemen liege vor allem darin, dass er verdeckt erfolgen müsse, weil sich mindestens eine Seite in der Illegalität des Normensystems aufhalte (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 271)6. Die Frage, ob Korruption häufiger in der Wirtschaft oder im politischen System anzutreffen sei, kann nicht zur Zufriedenheit geklärt werden, da die ökonomische Theorie auf dieser Tatsache ihren Erklärungsansatz gründe, Neugebauer in seinen Ausführungen jedoch von keiner Korrelation ausgehe (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 271f.). Ökonomen würden den korrupten Tausch als die Herbeiführung eines Marktes in Gebiete verstehen, bei denen es ansonsten staatliche Reglementierung gebe. Dabei verhalte er sich aber nicht nach dem Grundsatz von Angebot und Nachfrage, sondern es komme zu einer Störung des legalen Marktes (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 272). Es werde jedoch davor gewarnt, politische Korruption vornehmlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Vor allem der Autor Rose-Ackermann moniere dies und weise auf die Besonderheiten des politischen Prozesses hin (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 272). Ein großer Vorteil des ökonomischen Ansatzes sei die Präsentation von vielfältigen Ursachen für die Entstehung der Korruption (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 272). Diese seien gerade gut, um geeignete Maßnahmen für eine erfolgreiche Korruptionsvorbeugung oder Korruptionsbekämpfung entwickeln zu können (vgl. Ahlf 1998: 51)7. Neugebauer unterscheidet vier Motive, welche vornehmlich zu politischer Korruption führen.
Zunächst werde die Lösung von Selektionsprozessen erwähnt. Dann sei der Korrumpierende an der Durchsetzung höherer Erträge interessiert. Der dritte Grund liege in der schnelleren Abwicklung von Entscheidungsabläufen und schließlich diene die politische Korruption der Absicherung anderer illegaler Handlungen (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 272). Die ökonomische Theorie beleuchte weiterhin die ökonomischen Folgen der politischen Korruption. So komme es durch Korruption zu einer wirtschaftlichen Schädigung des Systems, welches die entstehenden Mehrkosten auf ihre Mitglieder übertrage (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 273). Auch zähle die politische Korruption zu den sogenannten opferlosen Straftaten, da es keine klassischen Opfer gebe, welche im Normalfall Strafanzeige stellen würden (vgl. Ahlf 1998: 28). Durch die Zusammenarbeit zwischen dem Korrumpierenden und dem Korrumpierten stehe das System als ökonomisch Geschädigter oftmals alleine da (vgl. Ahlf 1998: 28).
Es wurde schon gesagt, dass der ökonomische Ansatz davon ausgehe, dass Korruption mehr im politischen Bereich als in der Wirtschaft auftrete, obwohl meist ökonomische Erklärungen geliefert würden (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 273). Als Gründe würden vor allem eine komplexere Organisationsstruktur und Unflexibilität bei dem Arbeitsverhältnis, bei Karrierechancen sowie bei der Entlohnung genannt (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 273). Die ökonomische Theorie beschäftige sich schließlich auch mit den persönlichen Risiken, welche ein korruptes Verhalten bergen könne. Diese Risiken würden durch drei verschiedene Kontrollfelder hervorgerufen: Als erstes fänden sich zunächst natürlich verschiedene Kontrollprozesse zwischen den einzelnen Institutionen. Es werde die Skandalisierung der Medien erwähnt sowie die Sanktionen des Strafgesetzbuches (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 274). Eine einhellige Meinung der Korruptionsforschung sei die Annahme, dass Korruption mit einer größer werdenden Aufdeckungswahrscheinlichkeit weniger häufig anzutreffen sei (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 274)8. Ein Hauptaugenmerk liege dabei auf dem Budget, welches für diese Aufdeckungen aufgewendet werde (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 274).
Im Bereich des Strafgesetzbuches lägen die Ansatzpunkte für eine wirksame Kontrolle einerseits in der Definition der Tatbestände und zum anderen in der Festlegung der Höhe der jeweiligen Strafe (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 274). Der ökonomische Ansatz ziele hier darauf ab, eine Vergleichbarkeit zwischen der Höhe der Bestechungssumme und der Höhe der Strafe zu fordern (vgl. von Alemann/Kleinfeld in Benz/Seibel 1992: 274).
2.2 Eine rechtliche Betrachtung des Begriffes der politischen Korruption
Ziel dieses Kapitels ist eine Aufzeigung der juristischen und politischen Möglichkeiten für Korruption. Dabei wird auch erörtert, inwieweit rechtliche oder politische Regelungen in Deutschland die Korruption begünstigen oder ihr schaden. Beginnend wird zunächst auf die rechtlichen Bestimmungen im Einzelnen eingegangen, die unter dem Synonym der Korruption zu finden seien (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 82).
2.2.1 Die Bestechlichkeitsbestimmungen des Strafrechtes und deren tatbestandlichen Voraussetzungen
Zunächst einmal müsse festgehalten werden, dass es in der Bundesrepublik Deutschland den Straftatbestand der Korruption überhaupt nicht gebe (vgl. Ahlf 1998: 27). Die Korruption von Amtsträgern werde nur fragmentarisch in den Bestechungsdelikten § 331- 334 des Strafgesetzbuch behandelt (vgl. Ahlf 1998: 27). Dabei werde versucht, den Staat und dessen Bürger zu schützen, indem Personen daran gehindert würden, ihr Amt zu missbrauchen (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 82). Indem der Staat einzelnen Personen Macht verleihe laufe er auch Gefahr, dass diese Personen die Macht missbrauchen würden. Auch wäre diese Machtübertragung an Personen nur zu billigen, wenn sie auch zu kontrollieren sei (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 82).
Nun werden die vier Paragraphen einzeln nach den erforderlichen Vorraussetzungen betrachtet, welche erfüllt sein müssen, um in diesem Fall von einem Tatbestand sprechen zu können. Der § 331 des StGB regle den Tatbestand der Vorteilsnahme (vgl. Ahlf 1998: 58). Täter nach § 331 StGB könne nur ein Amtsträger oder aber eine dem öffentlichen Dienst besonders verpflichtete Person sein (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 83). Das auszutauschende Medium könne dabei sowohl materiell als auch immateriell sein. ,,§ 331 beschränkt sich nicht nur auf materielle Vorteile" (Bellers/Schöler in Bellers 1989: 84).
Sei die Diensthandlung aber nicht pflichtgemäß wie bei der Vorteilsannahme sondern sei sie pflichtwidrig, so hätte man es mit dem § 332 zu tun, welcher den Tatbestand der Bestechlichkeit regle (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 85). Von der Zuständigkeit her seien die beiden Paragraphen ansonsten gleich.
,,Im übrigen gelten für die Bestechlichkeit die gleichen Vorraussetzungen wie für die Vorteilsannahme [...]"(Bellers/Schöler in Bellers 1989: 85).
Die nächsten zwei Paragraphen regelten die Strafbarkeit der anderen Personen, welche also einer Amtsperson Vorteile anbieten würden. Es werde in der Literatur auch von einer ,,Spiegelbildlichkeit der Tatbestände" (Ahlf 1998: 28) gesprochen.
Eine andere Unterscheidung werde auch bezüglich aktiver und passiver Bestechung gemacht. Dabei werde das Annehmen von Vorteilen als passiver Akt (§ 331 und 332 StGB) und das Geben von Vorteilen (§333 und 334 StGB) als aktive Handlung eingeteilt (vgl. Ahlf 1998: 27f.). Es falle auf, dass die Bestechung von Richtern härter bestraft werde, als die von übrigen Amtspersonen (vgl. Noack 1985: 14).
Auf die politische Korruption bezogen ließe sich feststellen, dass die Paragraphen, welche die Korruption im Strafgesetzbuch behandelten, für Abgeordnete nicht gelten würden (vgl. Noack 1985: 136). Denn der Begriff des Amtsträgers sei auf die Mitglieder von Bundestag und von Landtagen nicht anwendbar (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 87). Friedrich Karl Fromme wähle deutliche Worte.
,,Beim Abgeordneten ist so gut wie nichts strafbar, was er in Ausübung seines Mandates tut" (Fromme zitiert nach Noack 1985: 136).
2.2.2 Einfallstore für politische Korruption
Eine erste Variable, die bei der Ausbreitung von Korruption bedacht werden müsse, sei der Mensch. Die Motive dabei seien vielfältiger Art, so zum Beispiel materielle Motive für sich selber oder für dritte, immaterielle Motive, unter die der persönliche Karrieresprung falle, dann auf jeden Fall die persönliche Unzufriedenheit des Einzelnen mit der Institution oder dem System und als letzten Punkt noch sonstige Motive, wie zum Beispiel Erpressbarkeit, welche die Folge von zum Teil jahrelangem Anfüttern sei (vgl. Ahlf 1998: 52).
Bellers und Schöler nennen in ihren Ausführung die Bildung eines sogenannten ,,Proporzprinzips" (Bellers/Schöler in Bellers 1989: 95). Dies meine das Entstehen von Koalitionen zwischen verschiedenen Untersystemen, die sich dann gegenseitig helfen würden, indem die eine Seite einem Anliegen der anderen nur zustimme, wenn diese als Gegenleistung auch einen Vorteil in ihren eigenen Anliegen durchsetzen könne (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 95). Dieses Prinzip wird noch durch drei Faktoren verstärkt. Da sei zum Ersten das Bestreben der Politik zur Kompromissbereitschaft, welche eine Wahrung des gegenwärtigen Zustandes des Systems zur Folge habe (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 95).
Ein anderer Verstärker sei die in Deutschland übliche Koexistenz von Politischem Amt und wirtschaftlichen Positionen vereint auf eine Person, welches unter Umständen die Entscheidung derselben in gewissen Situationen beeinflussen könne (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 95f.).
Die Tatsache, dass sich Probleme durch Koalitionen schneller und einfacher aus der Welt schaffen ließen, sei als dritter Faktor anzusehen (vgl. Luhmann, zitiert nach Bellers/Schöler in Bellers 1989: 96). Da in unserer heutigen Zeit die einzelnen Systeme immer vielschichtiger und verschlungener würden, werde ihre Kontrolle durch die nächst höhere Ebene erschwert, was auch eine Vereinfachung der Nichtentdeckung von Korruption9 zur Folge habe (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 96f.). Betrachte man das System der Partei, so könne festgestellt werden, dass der Wandel zur großen Volkspartei das Auftreten von Korruption begünstige (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 98). Um größere Wählerschaften anzusprechen sei auch ein enormer Aufwand von Nöten, welcher eine kompliziertere Struktur der Partei nötig mache.
,,Die Parteien werden zu betriebsähnlichen ,Maschinen` "(Bellers/Schöler in Bellers 1989: 98).
Die Tatsache, dass Parteien ihren Wahlkampf auch unter Inkaufnahme von Schulden finanzieren müssten, mache sie in gewisser Weise auch erpressbar gegenüber zahlungskräftigen Spendern, welche ihre Unterstützung beispielsweise mit einem guten Posten honoriert haben wollten (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 98f.). Eine Regierungspartei könne aber auch korrupt sein, wenn sie der Opposition ungünstigere Finanzierungen aufzwingen würde. Aber um diesem Fall vorzusorgen habe das Bundesverfassungsgericht den sogenannten Gleichheitsgrundsatz erlassen, welcher solches Verhalten nicht toleriere (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 99). Doch auch die Justiz als gesetzgebende Gewalt im Staat sei nicht frei von der Gefahr des korrupten Verhaltens, da eine gewisse Nähe von Personen der Justiz zu politischen Parteien gegeben sei (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 100f.).
Ruge stelle in seinen Ausführungen fest, dass Korruption mit dem Machterwerb einer neuen Partei und andererseits mit der Dauer der Regierungszeit einer Partei ansteige. Auch das Fehlen einer funktionierenden Opposition begünstige sie (vgl. Ruge in Zentrum für Europaund Nordamerika-Studien 2000: 29).
Festzuhalten sei, dass die Einfallstore für politische Korruption vielfältig seien, aber auch nicht gänzlich eliminiert werden könnten.
,, Ein solches System wäre entweder voll totalitär (was nicht realisierbar ist) oder hätte illusorisch eine ideale Welt zur Vorraussetzung, ohne Konflikte und Differenzen, mit materiellem Überfluß für jedermann" (Bellers/Schöler in Bellers 1989: 102).
2.3 Zur Rolle der Massenmedien - Instrument der ,,Skandalisierung" oder ,,Vierte Gewalt" ?
Es komme vor, dass Politiker den Ermittlungen wegen Korruption gegen sie durch ihren besonderen Status der Immunität entgehen würden (vgl. Ruge in Zentrum für Europa- und Nordamerika-Studien 2000: 26). Dies könne zu der Vermutung führen, dass Politiker gerade dann zur Korruption neigen würden. Das dies jedoch nicht so sei, werde bei einer Beschäftigung mit der Rolle der Medien in diesem Zusammenhang deutlich. Deren Einmischung führe nicht selten zu einem Rücktritt des betroffenen Politikers (vgl. Ruge in Zentrum für Europa- und Nordamerika-Studien 2000: 26). Der Titel der Überschrift ließe sich auch mit zwei anderen Begriffen umschreiben, nämlich das Verhältnis der Medien zwischen ,,Geschäft" und ,,öffentlicher Aufgabe" (vgl. Fabris in Brünner et al. 1981: 240). Nehme man die bekanntgewordenen Korruptionsskandale, so falle auf, dass nicht nur deren Diskussion, sondern auch deren mögliche Würdigung mit strafrechtlichen Konsequenzen ihren Ursprung in der Berichterstattung der Presse hätten (vgl. Fabris in Brünner et al. 1981: 240). Noack führe jedoch aus, dass nicht jede entdeckte Korruption gleich skandalisiert werde (vgl. Noack 1985).
Aus diesem Phänomen sei eine neuerliche Diskussion um die Möglichkeiten und vor allem den Grenzen der Berichterstattung hervorgegangen, die zum einen den Aspekt der Skandalisierung und zum anderen den Medien die Frage nach der vierten Gewalt stellten (vgl. Fabris in Brünner et al. 1981: 239-298). In seinem Buch beschreibe Noack diesen Sachverhalt als ,,[...] Spannungsverhältnis von ,Geschäft` und ,öffentlicher Aufgabe`[...]" (Noack 1985: 104). Mit dem Begriff der Skandalisierung werde die Kritik bezeichnet, dass die Medien nur an einem regen Absatz der eigenen Produkte - der Nachrichten - interessiert seien. Der Sensationshunger der Bevölkerung werde gnadenlos befriedigt, und wenn nötig werde auch schon mal ein Skandal dort gefunden, wo überhaupt keiner sei (vgl. Fabris in Brünner et al. 1981: 241).
Fabris sehe zudem noch enge Beziehungen zwischen einzelnen Medien und Wirtschaftsunternehmen, welche zusammenarbeiten, und so die politische Opposition sehr stark verunglimpfen könnten (vgl. Fabris in Brünner et al. 1981: 241). Auch würden von den Medien Skandale produziert, um im täglichen Quotenkampf der verschiedenen Sender eine möglichst gute Position zu erlangen (vgl. Fabris in Brünner et al. 1981: 249). Den Unterhaltungswert von Skandalen in der Öffentlichkeit sehe auch Noack, jedoch seien bei ihm mehr positive Aspekte zu finden (vgl. Noack 1985: 105fff.). So sei für ihn die Skandalisierung vor allem eine Kontrollfunktion der Gesellschaft, akute Missstände anzusprechen und sozusagen als Notbremse zu fungieren (vgl. Noack 1985: 106). Die Berichterstatter seien durch die Wahrnehmung dieser Kontrollaufgaben charakterisiert und sie selbst würden diese Aufgabe als hohes ideelles Gut ihres Berufs ansehen, wie es aus der Geschichte heraus resultiere (vgl. Fabris in Brünner et al. 1981: 243-255). Bei Fabris finde sich noch ein Argument gegen die Unabhängigkeit journalistischer Berichterstattung. Da Reporter und Politiker ihrer Arbeit oft jahrelang nachkommen, würde es zu Beziehungen zwischen diesen Berufsgruppen kommen. Diese äußerten sich hauptsächlich durch die Tatsache, dass einige Politiker vorrangig speziellen Reportern Exklusivinterviews gewährten oder sie früher als andere ihrer Kollegen mit Informationen versorgt würden, um so eine gute Berichterstattung zu erhalten.
,,[...] so kann zuweilen eine Kameraderie entstehen, die dann die Bereitschaft der Medien zur Kritik und Kontrolle entsprechend reduziert" (Fabris in Brünner et al. 1981: 252f.). Zusammenfassend könne zur Rolle der Medien gesagt werden, dass weder die Bezeichnung als Skandalisierungsinstrument, noch die Titulierung als Vierte Gewalt ihren Charakter genau treffen würde (vgl. Fabris in Brünner et al. 1981: 263f.). Fest stehe, dass die öffentliche Meinung eine wichtige Rolle bei der Ächtung eines korrupten Politikers spiele (vgl. Ruge in Zentrum für Europa- und Nordamerika-Studien 2000: 26f.). Jedoch könne den Medien generell keine Aufgabe als Vierte Gewalt im Staate eingeräumt werden, was eher als unerreichbares Idealbild der Medien zu sehen sei (vgl. Fabris in Brünner 1981: 263). Ebenso wenig lasse sich generalisierend sagen, dass alle Medien nur gute Quoten erzielen wollten und so harmlose Fälle skandalisieren würden, um den Sensationshunger der Menschen zu befriedigen (vgl. Noack 1985: 106). Kennzeichnend für die Rolle der Medien sei, ,,[...] daß sie dort, wo bestehende (Kontroll-)Einrichtungen versagen, in die Bresche springen können" (Fabris in Brünner et al. 1981: 263).
2.4 Die Hauptstadt- Affäre 1949
Ziel dieses Abschnittes soll es sein, die bisher festgestellten Eigenschaften der politischen Korruption an Hand eines Beispieles zu verdeutlichen. Um dieses zu erreichen, wurde ein Fall ausgewählt, welcher in die Anfangsphase der Bundesrepublik Deutschland fällt, und somit politische Korruption als ein Phänomen darstellt, dass nicht nur seit letzter Zeit für Schlagzeilen sorgt, sondern dass in unserem Staat praktisch seit seiner Gründung10 vorhanden sei (vgl. Noack 1985: 137).
Die Kenntnis des geschichtlichen Ablaufs der Ereignisse wird dabei beim Leser vorrausgesetzt, da dies sonst den begrenzten Umfang dieser Arbeit sprengen würde und weil dies auch nach Absprache mit dem Dozenten so vereinbart worden ist. Zwar liegt bei einer Geldzuwendung noch nicht automatisch Korruption vor, da Adenauer jedoch dadurch seinen persönlichen Hauptstadtfavoriten ,,unterstützen" wollte, haben wir es hier, wie schon erörtert, mit der Durchsetzung von privaten Interessen zu tun (vgl. Huge/Schmidt/Thränhardt in Bellers 1989: 39f.). Adenauer habe dieses Abweichende Verhalten jedoch nie zugegeben (vgl. Noack 1985: 137).
Es zeige sich sehr schön die Erpressbarkeit des Menschen durch die materiellen Zuwendungen, die in der Form von materiellen Sanktionen in der Höhe zwischen 1.000 und 20.000DM an die Mitglieder der verschiedenen Fraktionen gerichtet worden seien (vgl. Huge/Schmidt/Thränhardt in Bellers 1989: 40). Der ,,Spiegel" habe dafür gesorgt, dass der Sachverhalt in der Öffentlichkeit in bisher nicht gekannter Weise publik wurde (vgl. Huge/Schmidt/Thränhardt in Bellers 1989: 38f.). Dabei habe er sich selbst als Vierte Gewalt im Staat gesehen, welche als ,,öffentliches Kontrollorgan" (Huge/Schmidt/Thränhardt in Bellers 1989: 39) fungiere. Von Teilen der Bevölkerung habe es jedoch auch Kritik gegeben, da die Art der schonungslosen Berichterstattung einigen doch zu weit gegangen sei. Letztendlich hätten die Enthüllungen des Spiegels zur Einsetzung des ersten Untersuchungsausschusses geführt, was auf eine Erhöhung des öffentlichen Druckes seitens der Bevölkerung auf die Politik zurückzuführen sei (vgl. Noack 1985: 137). Ein Charakteristikum, dass ebenfalls bedacht werden müsse, sei die Fokussierung der Öffentlichkeit auf einzelne Personen bei einem Korruptionsskandal, der oftmals einen personellen Wechsel an der jeweiligen Position oder sogar die Opferung von unwichtigeren Personen zur Folge habe (vgl. Huge/Schmidt/Thränhardt in Bellers 1989: 76f.). Durch die Tatsache, dass den Abgeordneten keine Zuwendungen an Geldern nachgewiesen werden konnten, zeige sich auch die Vertuschungsmöglichkeit, die mit dem Tauschmedium Geld zusammenhänge (vgl. Neckel 1995: 15; Huge/Schmidt/Thränhardt in Bellers 1989: 79). Merkwürdig für den Betrachter sei die Tatsache, dass der Untersuchungsausschuss keinen seiner Untersuchungspunkte als erfüllt oder beweisbar befunden habe (vgl. Noack 1985: 136f.). Bei Huge, Schmidt und Thränhardt werde sogar der Frage nachgegangen, ob der Untersuchungsausschuss die angeblichen Drahtzieher nicht sogar bewusst geschützt habe, indem er sich in Grundsatzfragen zur Parteienfinanzierung verzettelt habe (vgl. Huge/Schmidt/Thränhardt in Bellers 1989: 41f.). So seien Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem untersuchten Sachverhalt hätten beisteuern können, nicht vor dem untersuchenden Ausschuss gehört worden.
,,Ein Informant, der in einer Zeitung geäußert hatte, Schäffer habe einige Tage nach der Wahl der Bundeshauptstadt auf Weisung Adenauers größere Beträge an Abgeordnete der BP gezahlt, wurde vom Ausschuß nicht gehört, obwohl er bereit war auszusagen" (Huge/Schmidt/Thränhardt in Bellers 1989: 41).
Dies rechtfertige jedoch nicht den Vorwurf einer erneuten Korruption durch den Ausschuss, es impliziere jedoch das Vorhandensein von Seilschaften unter den Politikern. In den systematischen Bemerkungen zur Korruption in der Bundesrepublik merkten die drei Autoren zusätzlich die häufige Unzulänglichkeit der Änderungsvorschläge durch die Untersuchungsausschüsse an (vgl. Huge/Schmidt/Thränhardt in Bellers 1989: 77). Weiterhin werde die Zusammensetzung der Kommissionen bezüglich der Parteizugehörigkeit der Mitglieder moniert. Da deren Zusammensetzung nach den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag geregelt werde, könne es zu Vertuschungen oder kontraproduktiven Verhaltensweisen bei der Aufklärung kommen, wenn angebliches Fehlverhalten von Mitgliedern der Regierungspartei untersucht würde (vgl. Huge/Schmidt/Thränhardt in Bellers 1989: 77).
Auch die Problematik des oftmaligen Fehlens von jeglichem Unrechtsbewusstseins seitens der Korrumpierenden oder des Korrumpierten zeige sich durch die Hauptstadtaffäre. So hätten die Abgeordneten argumentiert, dass sie Gelder nicht als Personen, sondern als Teil der Partei erhalten hätten (vgl. Huge/Schmidt/Thränhardt in Bellers 1989: 42). Ein aufkommendes Unrechtsbewusstsein sei jedoch ein erster Schritt, damit sich Korruption eindämmen ließe (vgl. Ahlf 1989: 53).
2.5 Korruptionsvorbeugung und Korruptionsbekämpfung
In diesem Abschnitt soll dargelegt werden, welche Maßnahmen geeignet sind, Korruption zu verhindern und welche grundlegenden Aktionen es zur Bekämpfung der Korruption gibt. Ausgangspunkt für Handlungen, unter denen auch die Korruption zu sehen sei, seien persönliche Wertevorstellungen des einzelnen Individuums, deren Ausprägungen und Intensität zu Handlungen führen könnten oder auch nicht (vgl. Sturm in Bellers 1989: 162ff.). Ein zweiter wichtiger Punkt sei die Hypothese, dass es in einem System, welches seinen Mitgliedern keine Möglichkeit zu korrupten Verhalten biete, überhaupt nicht zu Korruption kommen würde (vgl. Sturm in Bellers 1989: 163). Wolle man dazu übergehen, die individuelle Korruptionsneigung zu bekämpfen, so werde man feststellen müssen, dass es dazu kein Patentrezept gebe (vgl. Sturm in Bellers 1989: 165).
Wolle man an die Personen appellieren, ihre Einstellung zur Korruption zu ändern, so bleibe oftmals nur ,,[...] der Appell an die Moral bzw. das Gewissen" (Sturm in Bellers 1989: 165). Dies sei gerade in Zeiten wichtig, wenn wertevermittelnde Institutionen wie die Kirche oder das Militär keinen hohen Einfluss mehr auf die Gesellschaft aufweisen würden (vgl. Sturm in Bellers 1989: 165).
Des Weiteren gelange der Autor zu der Auffassung, dass es gerade in den afrikanischen Staaten durch eine Angleichung an das Demokratische Staatssystem der Europäischen Länder zu einer Einschränkung der Korruptionsneigung komme, indem sich in der Verwaltung oder auch in der Politik ein ähnliches Beamtenethos wie zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland entwickeln würde (vgl. Sturm in Bellers 1989: 165).
Wende man sich den institutionalisierten Vorkehrungen zur Korruptionsbekämpfung zu, so ließe sich vor allem das Manko des fehlenden Straftatbestandes für Korruption in Deutschland nennen (vgl. Ahlf 1998: 27). Änderungen des Strafgesetzbuches seien dringend erforderlich, jedoch würden Reformbestrebungen meist von den Politikern wieder schnell als unnötig fallengelassen (vgl. Sturm in Bellers 1989: 167f.).
Ein weiterer Ansatzpunkt für die Bekämpfung von Korruption sei die Durchführung einer Gesellschaftsreform, welche durch Friedrich oder auch Acham propagiert werde. Dem vorherrschenden Sitten- und Werteverfall in der Gesellschaft müsse entgegengewirkt werden (vgl. Sturm in Bellers 1989).
In unseren heutigen westlichen Industriestaaten müsste, wenn es nach der ökonomischen Theorie gehen würde, der Markt mehr staatliche Funktionen übernehmen, damit sich Korruption einschränken ließe (vgl. Sturm in Bellers 1989: 170). Dies führe jedoch nach Meinung des Autors nicht zu einer Einschränkung, sondern lediglich zu einer Verschiebung von Korruption. Es komme also nicht zu einer Eliminierung von abweichendem Verhalten, die Verfolgung erweise sich sogar noch als schwieriger, da die Korruption aus dem relativ offenen Bereich der Politik in die undurchsichtigen Kanäle der Wirtschaft führe (vgl. Sturm in Bellers 1989: 170).
Friedrich gebe einen Vorschlag zur Korruptionsbekämpfung, der unabhängig sei von der jeweils im System vorherrschenden politischen Ordnung.
,,Das Ausmaß der Korruption nimmt ab, je mehr die Machthaber von der Zustimmung der Bevölkerung abhängig sind" (Sturm in Bellers 1989: 171).
Hier würden die Medien einen wichtigen Beitrag zur Kontrolle der Politik leisten können (vgl. Fabris in Brünner 1981: 239-264).
Abschließende Betrachtung
Ein einheitliches Postulat von politischer Korruption lässt sich definitiv nicht bestätigen. Die Autorenschaft bedient sich bei der Erschließung seines semantischen Raumes unterschiedlicher Ansätze. Je nach Geistestradition wird politische Korruption als reine private Interessensdurchsetzung im Amt, als Konflikt zwischen privater und öffentlicher Moral und Interessen, oder als tauschförmige Nutzenmaximierung betrachtet. Die Verschiedenheit der Ansätze führt dazu, dass der Begriff multidimensional ausgelegt werden muss und durch das zeitgeschichtliche Ereignis der Hauptstadtaffäre an Aktualität und Bedeutung gewinnt. Wenn man die Überzeugung großer Teile der deutschen Bevölkerung betrachtet, die davon ausgeht, dass gerade sie im Besitze höherer Moral sei, wie es sich unter anderem im Selbstverständnis der Beamten dokumentiert, dann erhält die Noacksche Betrachtung präindustrieller Zustände in Deutschland ein besonderes Gewicht (vgl. Noack 1985: 113), wenn er behauptet, dass idealtypische Abbilder einer Legendenbildung Vorschub geleistet hätten. Diese Ideale vom ,,ehrbaren Kaufmann" oder ,,unbestechlichen Beamten" hat es nie in Reinkultur gegeben, sondern waren stets Produkte einer idealisierenden Gesellschaft (Kultur, Weltanschauung), wie schon Max Weber 1921 in ,,Wirtschaft und Gesellschaft" ausführte. Das Wörterbuch der Soziologie führt in diesem Zusammenhang an, dass Weber der Auffassung gewesen ist, dass das preußisch deutsche Beamtentum unbestechlich, streng formalistisch, nach rationalen Regeln und nach sachlicher Zweckmäßigkeit, ,,ohne Ansehen der Person", einen legal herrschen bürokratischen Verwaltungsapparat schuf (vgl. Hillmann 1994: 450).
Eindeutig kann die Frage nach einer strafrechtlichen Dimension von politischer Korruption beantwortet werden: Es gibt keine! Wie Ahlf und Bellers hinlänglich darlegen, hat politische Korruption keine strafrechtlichen Sanktionen zur Folge, da die Strafgesetzgebung den Begriff der politischen Korruption nicht kennt (vgl. Ahlf 1998: 27; Bellers/Schöler in Bellers 1989). Die Korruption wird nur fragmentarisch in den Bestechlichkeitsdelikten § 331-334 Strafgesetzbuch behandelt. Politiker fallen jedoch nicht unter den Amtsträgerbegriff, und somit erfüllt sich der Straftatbestand für diesen Personenkreis nicht. Auf Grund dieses rechtsfreien Raumes, der gesellschaftlich nicht erwünscht ist, hat es den Anschein, als wenn die Medien Jurisprudenz walten lassen. Denn es drängt sich der Eindruck auf, dass durch Zusammenspiel von Auflagenstärke und einer damit verbundenen politischen Meinungsbildung in der Öffentlichkeit, stellvertretend Gericht gehalten wird. Durch die Effekte öffentlichen Meinungsdruckes oder Skandalisierung sind ,,politisch korrupte" Mandatsträger für die Parteien nicht mehr tragbar, so dass durch die so ,,erzwungene" Selbstreinigung der politischen Bühne ein Rücktritt des Politikers am Ende unausweichlich ist.
Einfallstore für politische Korruption sind vielfältig. Es ist jedoch eine mangelnde Bereitschaft unter den Politikern für Veränderungen zu erkennen, die sich an den Ergebnissen von oftmals agierenden Untersuchungsausschüssen messen lässt, die überwiegend auf die Erhaltung des Status Quo hin ausgerichtet sind (vgl. Huge/Schmidt/Thränhardt in Bellers 1989: 76-81).
Betrachtet man die Möglichkeiten der Korruptionsbekämpfung, so bleibt zum einen die Möglichkeit, an die Werte und Normen der Personen zu appellieren, um die Korruption in das schlechte Gewissen zu rufen, oder aber man stärkt die institutionalisierenden Vorkehrungen, indem Gesetze ausgedehnt oder konkretisiert werden (vgl. Sturm in Bellers 1989: 161-176).
Die exklusive Betrachtung des Korruptionsbegriffes unter Ausblendung anderer Einflussfaktoren wie Macht, Lobbyismus und weiterer Begriffe der Politik ist nicht sinnvoll. Denn die Gründungsväter unserer demokratischen Tradition haben sich bei der Einführung rechtstaatlicher Instrumente, wie der Gewaltenteilung, Legitimation von Macht und deren gleichzeitiger Beschränkung und Kontrolle etwas gedacht. Politische Korruption endet dort, wo Machtwechsel durch Volkeswillen ihr ein Ende bereitet. Insofern erhalten die Medien die wichtige Rolle für die politische Willensbildung des ,,gemeinen" Wählers, wenn sie aufklärend oder manipulierend informieren.
Literaturverzeichnis
Ahlf, E.-H.: Lehr- und Studienbriefe Kriminologie Nr. 13, Hilden 1998.
Barth, H. P.: Schlüsselbegriffe der Soziologie, 7. Aufl., München 1997.
Bellers, J. (Hg.): Politische Korruption - Vergleichende Untersuchungen, Münster 1989.
Benz, A., Seibel, W. (Hg.): Zwischen Kooperation und Kontrolle, Baden-Baden 1992.
Brünner et al. (Hg.): Studien zu Politik und Verwaltung. Bd.1: Korruption und Kontrolle, Wien - Köln - Graz 1981.
Drew, E.: Politics and Money. The New Road to Corruption, New York 1983.
Hillmann, K.-H.: Wörterbuch der Soziologie, 4. überarb. u. erw. Aufl., Stuttgart 1994.
Neckel, S.: ,,Der unmoralische Tausch. Eine Soziologie der Käuflichkeit". In: Michel, K. M.; Spengler, T. (Hg.): Kursbuch. Bd. 120, Berlin 1995.
Noack, P.: Korruption - die andere Seite der Macht, München 1985.
Smelser, N. J.: Stabilität, Instabilität. Aus einem Arbeitspapier zum Seminar Kriminalsoziologie, Hamburg 2000.
Zentrum für Europa- und Nordamerika-Studien (Hg.): Politische Korruption, Hemsbach 2000.
[...]
1 Als Beispiel ist hier die angebliche Liebesheirat des amerikanischen Busenwunders Anna Nicole Smith mit einem äußerst wohlhabenden achtzigjährigen Mann zu nennen (vgl. Neckel 1995: 12).
2 Hillmann charakterisiert in seinem Wörterbuch der Soziologie den Begriff Freundschaft unter anderem mit dem Fehlen von Rollenverpflichtungen. Des Weiteren fehle ein gemeinsames Handlungsziel (vgl. Hillmann 1994: 244).
3 Der Begriff bezieht sich auf eine moralische Verurteilung, da Korruption kein Tatbestand nach dem StGB darstelle. Ausnahme: Im öffentlichen Dienst gebe es den Tatbestand der Vorteilsannahme, Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung. Dies seien § 331, §332, §333, §334 StGB (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 83ff.).
4 Siehe Abschnitt 2.2.
5 Als andere Phänomene können Ämterpatronage, Protektion und Vetternwirtschaft gezählt werden. Das Strafgesetzbuch unterscheidet noch die sogenannten Wettbewerbsdelikte, wie zum Beispiel Betrug, Untreue und Urkundenfälschung (vgl. Ahlf 1998: 9).
6 Zur Verbergung von politischer Korruption siehe auch die Rolle der Massenmedien unter Abschnitt 2.3.
7 Zur Korruptionsvorbeugung und Korruptionsbekämpfung siehe auch Kapitel 2.5.
8 Zu dem Themenbereich Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention siehe auch Kapitel 2.5.
9 So werde beispielsweise die Nachvollziehbarkeit von korrupten Handlungen durch die heutzutage überwiegend fernmündliche Abwicklung von amtlichen Kontakten, anstatt wie früher schriftlich, erschwert (vgl. Bellers/Schöler in Bellers 1989: 97).
Häufig gestellte Fragen
Was ist Korruption gemäß Neckel?
Neckel beschreibt Korruption als eine Form des Tausches, bei dem ein Gut seinen Besitzer wechselt. Entscheidend sind die moralischen Regeln, die diese Handlung begleiten. Nicht alle Güter sind käuflich, und es gilt das moralische Äquivalenzprinzip. Korrupte Personen werden in ihrem Ansehen abgewertet, und die Illusion eines lässlichen Fehlverhaltens muss bewahrt werden.
Wie definiert Smelser den Begriff Korruption?
Smelser definiert Korruption als einen Tausch von Sanktionen oder Belohnungen zwischen Parteien. Er nutzt das Schema der generalisierten Medien (Reichtum, Macht, Einfluss, Wertbindung), um Korruption von anderen Phänomenen abzugrenzen. Korruption erfordert ein politisches System mit unterscheidbaren Elementen, eine Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten Interessen und eine Überkreuzung ökonomischer und politischer Sanktionen.
Welche verschiedenen Aspekte zur politischen Korruption werden unterschieden?
Es werden verschiedene Konzepte unterschieden: Korruption im Amt zur privaten Interessendurchsetzung, politische Korruption als Konflikt zwischen privater und öffentlicher Moral, und Korruption als tauschförmige Nutzenmaximierung.
Wie wird Korruption im Amt zum Zwecke privater Interessendurchsetzung betrachtet?
Korruption im Amt wird als Pflichtverletzung eines Staatsdieners gegenüber seinem Dienstherren betrachtet. Es wird auf das Spannungsfeld zwischen den Werten unbestechlicher Beamten und der Realität hingewiesen. Politiker könnten über private Altersvorsorge nachdenken, was die Möglichkeit privater Interessendurchsetzung beeinflussen kann.
Wie wird politische Korruption als Konflikt zwischen privater und öffentlicher Moral und Interessen betrachtet?
Korruption wird als abweichendes Verhalten betrachtet, bei dem Personen bevorteilt werden, obwohl es ihnen nicht zusteht. Oft fehlt eine Einsicht in das abweichende Verhalten seitens der Gesellschaft. Politische Korruption untergräbt und schädigt die Gesellschaftsstruktur und die Institutionen des politischen Systems.
Wie wird Korruption als tauschförmige Nutzenmaximierung betrachtet?
Der Beamte wird als Unternehmer verglichen, der etwas verkauft, um seinen Profit zu steigern. Korruption wird als individuelles Mittel der Profitmaximierung unter Marktgesetzen verstanden. Die Frage ist, ob Korruption häufiger in der Wirtschaft oder im politischen System anzutreffen ist. Lösung von Selektionsprozessen, Durchsetzung höherer Erträge, schnellere Abwicklung von Entscheidungsabläufen und Absicherung anderer illegaler Handlungen können Motive sein. Die Korruption schädigt das System wirtschaftlich, indem Mehrkosten auf Mitglieder übertragen werden.
Wie sieht eine rechtliche Betrachtung des Begriffes der politischen Korruption aus?
Es gibt in Deutschland keinen Straftatbestand der Korruption. Die Korruption von Amtsträgern wird nur fragmentarisch in den Bestechungsdelikten § 331-334 des Strafgesetzbuches behandelt. Diese Paragraphen gelten aber nicht für Abgeordnete.
Welche Einfallstore für politische Korruption gibt es?
Einfallstore sind der Mensch selbst mit vielfältigen Motiven (materielle, immaterielle, Unzufriedenheit, Erpressbarkeit), das Entstehen von Koalitionen (Proporzprinzip), die Koexistenz von politischem Amt und wirtschaftlichen Positionen, die Schulden der Parteien durch den Wahlkampf.
Welche Rolle spielen die Massenmedien - Instrument der Skandalisierung oder Vierte Gewalt?
Die Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung von Korruptionsfällen. Sie können als Kontrollfunktion der Gesellschaft agieren, es besteht aber die Gefahr der Skandalisierung und der Abhängigkeit von Wirtschaftsunternehmen. Es kann eine Kameraderie entstehen, die die Bereitschaft der Medien zur Kritik reduziert. Die Bezeichnung als Skandalisierungsinstrument, noch die Titulierung als Vierte Gewalt ihren Charakter genau treffen würde.
Was war die Hauptstadt-Affäre 1949?
Die Hauptstadt-Affäre von 1949 ist ein Beispiel für politische Korruption in der Anfangsphase der Bundesrepublik Deutschland. Adenauer wollte seinen Hauptstadtfavoriten mit Geldzuwendungen "unterstützen". Der Spiegel hat den Sachverhalt in der Öffentlichkeit publik gemacht und so zur Einsetzung des ersten Untersuchungsausschusses geführt. Es gab jedoch Kritik an der Art der Berichterstattung. Keinen der Untersuchungspunkte wurde vom Untersuchungsausschuss als erfüllt oder beweisbar befunden. Die Abgeordneten argumentierten, dass sie Gelder nicht als Personen, sondern als Teil der Partei erhalten hätten.
Welche Maßnahmen gibt es zur Korruptionsvorbeugung und Korruptionsbekämpfung?
Maßnahmen sind persönliche Wertevorstellungen des einzelnen Individuums, die Veränderung des Strafgesetzbuches durch die Einführung eines Straftatbestandes für Korruption, die Durchführung einer Gesellschaftsreform zur Bekämpfung des Sitten- und Werteverfalls, die Übernahme staatlicher Funktionen durch den Markt und die Abhängigkeit der Machthaber von der Zustimmung der Bevölkerung. Auch hier leisten die Medien einen wichtigen Beitrag zur Kontrolle der Politik.
- Quote paper
- Jürgen Prumbach (Author), 2000, Politische Korruption, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/98152