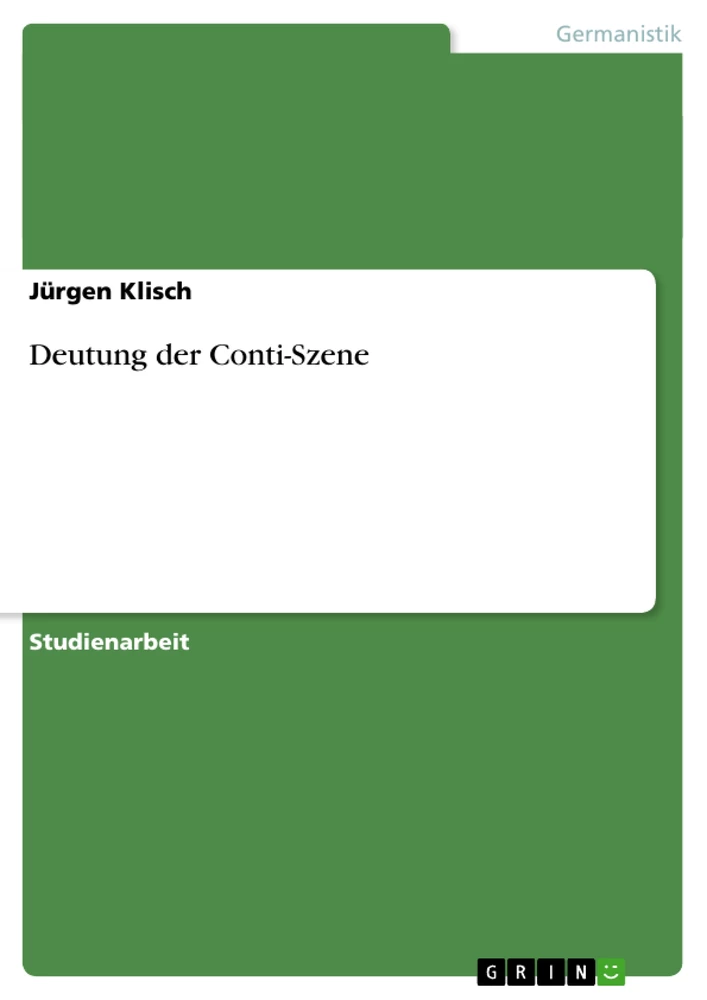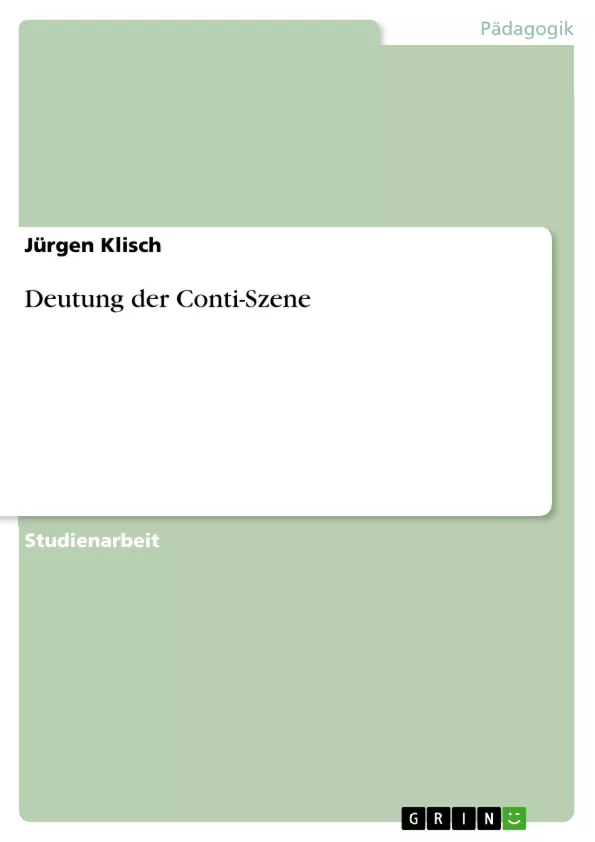Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Leinwand eines Gemäldes durchdringen und in die Seele der dargestellten Person eintauchen. In dieser tiefgründigen Analyse einer Schlüsselszene aus Lessings "Emilia Galotti" wird genau dies versucht. Die Arbeit seziert den berühmten Monolog des Malers Conti, um die vielschichtigen philosophischen und ästhetischen Strömungen des Neuplatonismus freizulegen, insbesondere im Hinblick auf Plotins Lehre von der Schönheit, der Seele und ihrer Beziehung zur Körperwelt. Der Leser wird Zeuge, wie Conti, der Künstler, die Grenzen der Darstellung und die Flüchtigkeit der Schönheit reflektiert, während er gleichzeitig die Gefahren der Verwechslung von Abbild und Urbild warnt. Die Analyse beleuchtet, wie der Prinz, verblendet von der erblickten Schönheit Emilias, in den Irrtum verfällt, diese Schönheit besitzen zu können, und somit eine tragische Kausalkette auslöst. Die Interpretation der Conti-Szene entfaltet sich als ein Spiegel, der nicht nur die Charaktere der Tragödie, sondern auch grundlegende Fragen der menschlichen Wahrnehmung, der künstlerischen Repräsentation und der moralischen Integrität reflektiert. Schlüsselwörter wie Ästhetik, Neuplatonismus, Plotin, Schönheit, Seele, Körper, Abbild, Lessing, Emilia Galotti, Conti, Prinz, Tragödie, Kunst, Wahrnehmung, Verführung und Monolog strukturieren diese vielschichtige Analyse. Die Arbeit ergründet die tiefere Bedeutung des Schönen im Kontext von Gut und Böse, und wie sich die Verstrickung des Prinzen in die sinnliche Welt letztendlich in seinem Verhängnis widerspiegelt. Die Leser erwartet eine Reise durch die Welt der Ideen, in der die Frage nach dem Wesen der Schönheit und der Möglichkeit ihrer Erfassung im Zentrum steht, und die Conti-Szene als Brennglas für die komplexen Beziehungen zwischen Kunst, Philosophie und menschlicher Existenz dient. Es geht um die Entlarvung des Irrtums, die vergängliche Schönheit mit der ewigen Wahrheit zu verwechseln, und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Akteure der Tragödie. Die Seminararbeit von Jürgen Klisch bietet somit einen erkenntnisreichen Beitrag zur Interpretation von Lessings Werk und regt zu einer neuen Betrachtung der zeitlosen Frage nach dem Schönen und seiner Bedeutung für unser Leben an. Lassen Sie sich entführen in die Tiefen der Philosophie und Ästhetik, wo die Analyse der Conti-Szene eine neue Dimension der Interpretation von "Emilia Galotti" eröffnet.
Zur Deutung der Conti-Szene
Auszüge aus einer Seminararbeit von Jürgen KIisch (1991) ©Jürgen Klisch
1. Die Philosophie Plotins
1 .1. Die Weltenlehre: Trennung von Körper und Seele
Die Wirklichkeit wird bei1Plotin als eine Stufenfolge von Welten begriffen, die aufgrund ihres Seins und ihres Wirkens eine Reihe bilden. An der Spitze des Systems steht die Gottheit, die nur als das Eine, das Sein und das Gute zu bezeichnen ist, da menschliche Prädikate zu seiner Bezeichnung unbenutzbar sind Der Grundgedanke der “Schöpfung“ ist die Emanation Gottes: Das Ureine ist so reich an Sein, dass es überquillt. Aus dem Überquellen entsteht alles Andere. Das Eine bleibt dabei erhalten, es verströmt sich nicht. Auf das Eine folgt (durch Emanation) die Welt desNous, des Geistes. In ihm entstehen die vom Geist gedachten Ideen. Die Welt des Geistes ist zugleich die Welt des ewigen Seins. Aus dem nus entfließt die Welt der Seele. Sie zerfällt in zwei Ebenen: in eine Weltseele und den aus der Weltseele hervorgehenden Einzelseelen, indem die Weltseele nach unten hin zerfällt. Die Seelen schaffen aus der letzten Welt, der Materie abgegrenzte, geformte Körper. Gleichzeitig gestalten sie die Körper den Ideen gemäß, die ihnen durch dasNousgegeben werden. Die Seele vermittelt also zwischen der Ideen- und der Körperwelt.
Die Materie ist, da in ihr nichts Geistiges enthalten ist, das Prinzip des Nichtseins.
Aus dem Weltenschema des Plotin wird deutlich, dass die Seele selbst unkörperlich, zugleich aber im Körper gegenwärtig ist. Die Seele ist ein eigenständiges, unteilbares, nicht an einen Körper gebundenes “Wesen“. Ihr kommt im Weltenschema die Vermittlerrolle zwischen Geist und Körper zu.
1.2. Die Ästethik
1.2.1. Das Schöne
Abbilder und Schatten, die aus der oberen Welt gewissermaßen entfließen und in die Materie hinabgehen, verursachen es, dass sie wohlgeformt sind und ihr Anblick entzückt. Plotin 16, s18 Nach Plotin stammt das Schöne von Gott, „ oder vielmehr ist das wahrhaft Seiende das Schöne, das nicht wahrhaft Seiende aber das Hässliche“ (vgl. 16 §31). Es besteht eine Identität zwischen dem Guten und dem Schönen bzw. der Schönheit. Das Prinzip der Emanation des Seienden gilt somit auch für das Schöne:
“Als Erstes ist anzusetzen die Schönheit, welche zugleich das Gute ist, von daher wird der Geist unmittelbar zum Schönen, und durch den Geist ist die Seele schön; und das weitere Schöne dann, in den Handlungen und Tätigkeiten kommt von der gestaltenden Seele her, und die Leiber schließlich, welche man schön nennt, macht die Seele dazu; denn da sie ein Göttliches ist und gewissermaßen ein Stück des Schönen, so macht sie das, was sie anrührt und bewältigt, schön, soweit es an der Schönheit Teil haben kann.“ (16 §32)
Die Folge der Welten kann auch als eine Reihe von Spiegelungen und Abbildern verstanden werden: Das Gute (zugleich das Schöne) spiegelt sich imNous,das Schöne des Geistes in der Seele und die Schönheit der Seele in einem schönen Körper wider.
Aufgrund der Reihung von Spiegelungen (Spiegelbildern) kann auch in umgekehrter Weise in der Schönheit des Körpers die Schönheit der Seele erblickt werden, der schöne Körper als Abbild, Schattenbild, Abdruck oder Spiegelbild einer schönen Seele verstanden werden (vgl. 16 §18,19). Entsprechend spiegelt sich in einem hässlichen Körper eine hässliche Seele. Auch die Einzelteile des Körpers, die Augen, der Mund, das Kinn, der Hals und die Miene usw. sind ein Spiegelbild der Seele, denn in jedem Teil des Körpers kann die Idee erblickt werden, die Seele bei der Schaffung des Körpers verwandte (Prinzip der Sichtbarwerdung des Unteilbaren in der Vielheit) (vgl. 16 §13-15). Abbildern kommt demnach eine Vermittlerrolle zu, sie ermöglichen die Betrachtung des oberen Schönen. Folglich kann das obere Schöne immer nur betrachtet werden, es kann nie ergriffen oder besessen werden (vgl. 16 §37).
1.2.2. Das Hässliche
So wie eine Identität zwischen dem Guten und dem Schönen besteht, ist eine Identität zwischen dem nicht wahrhaft Seienden und dem Hässlichen gegeben, “und das ist zugleich das ursprünglich Böse“ (16 §31).
Der Begriff des Hässlichen ist - anders als der Begriff des Schönen, welcher identisch mit dem Guten ist -‚ ein zusammengesetzter Begriff: Das Hässliche ist eine Hässlichkeit der Seele, die entsteht, wenn sich die allein mit sich verweilende, unkörperliche Seele zum Leib hinwendet, eine zu innige Gemeinschaft mit dem Leib eingeht, dadurch von den Begierden des Leibes erfasst wird und infolge der Vermischung mit dem Niedrigen eine fremde Gestalt annimmt (vgl. 16 §25-27).
Eine derartig verunreinigte Seele kann wieder schön werden. “Löst sie sich von den Begierden, die sie durch die zu innige Gemeinschaft mit dem Leibe erfüllen, befreit sie sich von allen anderen Leidenschaften und reinigt sich von den Schlacken der Verkörperung und verweilt allein mit sich, dann hat sie das Hässliche, das ihr aus einem fremden Sein kommt, restlos abgelegt.“ (16 §27)
Die Lehre von dem Schönen bzw. dem Hässlichen, dem Guten und dem Bösen ist auf der Relation zwischen körperloser Seele und dem von der Seele geschaffenen und in ihm gegenwärtigen Körper aufgebaut.
1.3. Der Tod
Der Tod als Katharsis ist die Trennung von Körper und Seele (vgl. 16 §29). Die Seele wird “völlig frei vom Leibe, geisthaft und ganz dem Göttlichen angehörig, aus welchem der Quell des Schönen entspringt und von wo alles kommt, das ihr angestammt ist. Wird so die Seele hinaufgeführt zum Geist, so ist sie in noch höherem Grade schön“ (16 §30). Denn der Geist ist für die Seele die wesenseigene Schönheit, weil sie dort allein wahrhaft Seele ist (vgl. 16 §30). Da Schönheit mit dem Guten und mit dem Göttlichen identisch ist, ist eine in noch höherem Grade schöne Seele Gottähnlich (vgl. 16 §31).
2.2. Das Bild der Emilia: Abbild der schönen Seele
Denn wenn man die Schönheit an Körpern erblickt, so darf man nur sich ihr nicht nähern, sondern muss erkennen, dass sie nur Abbild, Ausdruck und Schatten ist, und fliehen zu jenem, von dem das Irdische ein Abbild ist. Plotin 16 §38 Im Monolog des 3. Auftritt des 1. Aufzugsäußert der Prinz nicht nur Erwartungen hinsichtlich des Portraits der Orsina, sondern er stellt dem Bild der Orsina ein anderes Bild gegenüber, da er hofft, ihr (das Bild der Orsina] möge einem anderen Bild, welches mit anderen Farben, auf einen anderen Grund gemalt sein sollte, in seinem Herzen Platz machen (vgl. 1,3).
Als Vergleichsmaßstab, an dem dieses 2. Bild gemessen werden soll, benennt der Prinz die Idealvorstellung des Schönen, die gestaltlos-unanschauliche Ideenwelt des Geistes(Nous): “So möcht’ ich es bald - lieber gar nicht sehen. Denn dem Ideal hier (mit dem Finger auf die Stirne) oder vielmehr hier (mit dem Finger auf das Herz) kömmt es doch nicht bei“ (1,4).
Um so überraschter ist der Prinz, als er in dem Bild der Emilia tatsächlich das Ideal des Schönen zu erblicken glaubt: “Was seh‘ ich? Ihr Werk, Conti? oder das Werk meiner Phantasie? - Emilia Galotti!“ (1,4). Conti antwortet mit einer Gegenfrage, in der die Bezeichnung “Engel“ für Emilia ebenfalls auf die gestaltlose Ideenwelt des Geistes hinweist: “Wie, mein Prinz? Sie kennen diesen Engel?“ (1,4). Mit dem weiteren Ausruf des Prinzen, “Bei Gott! wie aus dem Spiegel gestohlen“ (1,4), wird nicht in erster Linie auf der Ebene ‘das Abbild als Spiegelbild des Originals (des Urbildes)‘, sondern auf der Ebene ‘das Abbild als Spiegelbild der Ideenwelt des Geistes‘ verglichen, wobei dem Prinzen Urbild, Abbild und Ideenwelt aufgrund der nahezu vollkommenen Schönheit Emilias als identisch erscheinen.
Während beim Prinzen die Relation zwischen Abbild und Ideenwelt des Geistes vorherrscht die sich mit dem Urbild vermischt, bewegt sich Conti zum einen auf der Ebene ‘die Schönheit des Urbildes (“einziges Studium der weiblichen Schönheit“ (1,4)) als Abbild der Schönen Seele‘ (“Ihre Seele, merk‘ ich, war ganz in Ihren Augen. Ich liebe solche Seelen, und solche Augen“ (1,4)). Zum anderen beschreibt er die Probleme des Künstlers, die mit den Augen erblickte Schönheit der Seele, die sich in der Schönheit des Urbildes spiegelt, im Abbild ohne Verlust zur Erscheinung zu bringen. Trotz der vollkommenen Schönheit Emilias und der in ihr sichtbar werdenden vollkommenen Schönheit ihrer Seele, kann es dem Künstler niemals gelingen, diese mit dem Auge erblickte Schönheit identisch umzusetzen, es kann ihm immer nur eine Annäherung gelingen. Seele, Körper und sein Abbild sind nie identisch: “Ha! dass wir nicht unmittelbar mit den Augen malen! Auf dem langen Wege, aus dem Auge durch den Arm in den Pinsel, wie viel geht da verloren!“ (1,4). Conti offenbart hier eineästethische Grundhaltung, die sich bereits bei Plotin findet. Die am Körpererblickte Schönheit kann nieergriffen,oderfestgehaltenwerden: “Denn wenn man die Schönheit an Körpern erblickt, so darf man nur sich ihr nicht nähern, sondern muss erkennen, dass sie nur Abbild, Abdruck und Schatten ist, und fliehen zu jenem, von dem das Irdische das Abbild ist. Denn wenn einer zu ihr eilen wollte und sie ergreifen als sei sie ein Wirkliches, so geht es ihm wie jenem Mann, von dem irre ich nicht eine Sage meldet, die hierher zu ziehen ist: der sah ein schönes Bild auf dem Wasser, wollte es ergreifen, aber stürzte in die Tiefen der Flut und wart nicht mehr gesehen; ganz ebenso wird auch wer sich an die schönen Leiber heftet und nicht von ihnen lässt, hinabsinken nicht mit dem Leibe aber mit der Seele in dunkle Tiefen die dem Geiste störend sind; so bleibt er als Blinder im Hades (im Dunkel) und lebt schon hier wie einst dort nur mit Schatten zusammen“ (Plotin 1 6 ~ 37-38).
Der Maler, dessen Aufgabe es aber gerade ist, das mit den AugenErblicktemit der malenden Hand festzuhalten, muss um die Differenz wissen, zwischen dem, was seine Hand festzuhaltenvermochte und dem, was ererblickte,will er nach seinem Selbstverständnis ein großer Maler sein:
“Ha! dass wir nicht unmittelbar mit den Augen malen! Auf dem langen Wege, aus dem Arm durch den Arm in den Pinsel, wie viel geht da verloren! - Aber, wie ich sage, dass ich es weiß, was hier verloren gegangen, und wie es verloren gegangen, und warum es verloren gehen müssen:
darauf bin ich eben so stolz und stolzer, als ich auf alles das bin, was ich nicht verloren gehen lassen. Denn aus jenem erkenne ich, mehr als aus diesem, dass ich wirklich ein großer Maler bin, dass es aber meine Hand nur nicht immer ist“ (1,4). Gerade der Hinweis Contis gegen Ende des 4. Auftritts, das Bild der Emilia sei eine Kopie eines Bildes2, also eineNachahmung eines Kunstwerks, offenbart seineästethische Haltung, die um die Distanz zwischen dem Abbild und der im Urbild erblickten schönen Seele weiß und sich mit den beim Betrachten ausgelösten Empfindungen, demästethischen Genuss, zufrieden gibt. Eineästethische Grundhaltung, für die Conti seine Hände nicht einmal braucht, denn sie spielt sich ausschließlich im Kopf ab
(“Oder meinen Sie, Prinz, dass Raffael nicht das größte Genie gewesen wäre, wenn er unglücklicherweise ohne Hände wäre geboren worden?“ (1,4)).
Im Gegensatz zu Conti, der sich immer der Eigenständigkeit von Seele, Körper, Abbild und der im Abbild sichtbar werdenden Seele bewusst ist, setzt beim Prinzen eine Vermischung dieser Ebenen ein.
Der Prinz denkt Geist, Seele, Körper, Abbild nicht im neuplatonischen Sinne als logische Stufenfolge von Welten, aus der als eine Folge von Spiegelungen das obere Schöne im Körper ausschließlich betrachtet werden kann. Vielmehr setzt er das Schöne des Geistes mit dem Abbild, dem Urbild und den in ihnen zur Erscheinung gelangenden schönen Seelen als wesensgleich: “Was seh‘ ich? Ihr Werk, Conti? oder das Werk meiner Phantasie? - Emilia Galotti!“ [...] “Bei Gott! wie aus dem Spiegel gestohlen“ (1,4). Das Bewusstsein um die stets gegebene Differenz zwischen Bild und Person, zwischen Abbild und Urbild, welche dem Prinzen in Erwartung des Bildes der Orsina noch selbstverständlich war (“Ihr Bild, ist sie doch nicht selber“ (1,3)), fehlt ihm jetzt. In der Perspektive des Prinzen sind Abbild und Urbild der Emilia die sichtbar gewordene Idealvorstellung des Schönen. Die direkten Auswirkungen dieser Gleichsetzung zeigen sich in der Auffassung des Prinzen - insbesondere im 5. Auftritt des 1. Aufzugs -‚ er könne die in dem BildeerblickteSchönheit der Seele bzw. die Schönheit des Geistes durch Kauf oder durch erfolgreiche Verführung des Körpers besitzen;man beachte, er redet gegen dasBild:
“So viel er will! - (gegen das Bild.) Dich hab‘ ich für jeden Preis noch zu wohlfeil. - Ah! schönes Werk der Kunst, ist es wahr, dass ich dich besitze? - Wer dich auch besäße, schönres Meisterstück der Natur! - Was Sie dafür wollen, ehrliche Mutter! Was du willst, alter Murrkopf! Fordre nur! Fordert nur! - Am liebsten kauft‘ ich dich, Zauberin, von dir selbst!
- Dieses Auge voll Liebreiz und Bescheidenheit! Dieser Mund! - und wenn er sich zum redenöffnet! wenn er lächelt! Dieser Mund!“3
Seine - von ihm selbst nicht wahrgenommene - Vermischung der Welten von Geist-Seele- Körper-Abbild4 löst erst das Verlangen aus, dieerblickteSchönheit zubesitzenbzw. ergreifen.Ein Verlangen, welches Conti völlig fehlt und seinerästethischen Grundhaltung zuwiderliefe.
[...]
1Plotins Schriften werden zitiert nach: Plotins Schriften, übersetzt von Richard Harder, 2 Bd., Leipzig 1930-37.
2“Die Schildere selbst, wovor sie gesessen, hat ihr abwesender Vater bekommen. Aber diese Kopie“ (1,4)
3Gerade die oben zitierten Sätze zeigen, wie sehr der Prinz den ungeformten-unkörperlichen Geist mit Abbild und Urbild als wesensgleich ansieht. Spricht er von den Augen der Emilia, oder von den Augen des Bildes, oder von den Augen als Spiegel der Seele, also von der Seele als solche? Und wenn ja, von welcher Seele, die im Abbild erblickt wird oder von der, die er in den Augen von Emilia gesehen hat?
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus der Analyse "Zur Deutung der Conti-Szene"?
Die Analyse konzentriert sich auf die Interpretation der Conti-Szene im Kontext der Philosophie Plotins, insbesondere im Hinblick auf die Trennung von Körper und Seele und Plotins Ästhetik.
Wie wird die Philosophie Plotins in Bezug auf die Weltenlehre dargestellt?
Die Wirklichkeit wird als eine Stufenfolge von Welten beschrieben, angefangen bei der Gottheit (dem Einen) bis hin zur Materie. Die Seele vermittelt zwischen der Ideen- und der Körperwelt, wobei die Materie als das Prinzip des Nichtseins betrachtet wird.
Welche Rolle spielt die Ästhetik Plotins in der Analyse?
Plotins Ästhetik, insbesondere die Konzepte des Schönen und des Hässlichen, werden untersucht. Das Schöne wird mit dem Guten und dem Seienden identifiziert, während das Hässliche mit dem Nichtseienden und dem Bösen in Verbindung gebracht wird.
Wie wird der Begriff des Schönen bei Plotin erklärt?
Das Schöne stammt von Gott und spiegelt sich in verschiedenen Welten wider (Geist, Seele, Körper). Es wird betont, dass die Schönheit des Körpers ein Abbild der Schönheit der Seele ist.
Was bedeutet der Begriff des Hässlichen im Kontext der Analyse?
Das Hässliche wird als eine Hässlichkeit der Seele beschrieben, die entsteht, wenn sich die Seele zu stark dem Leib zuwendet und von dessen Begierden erfasst wird. Eine solche Seele kann jedoch durch Loslösung von diesen Begierden wieder schön werden.
Wie wird der Tod im Zusammenhang mit Plotins Philosophie dargestellt?
Der Tod wird als Katharsis betrachtet, als die Trennung von Körper und Seele. Die Seele wird dadurch von den Fesseln des Körpers befreit und dem Göttlichen nähergebracht.
Wie wird das Bild der Emilia in Bezug auf Plotins Philosophie interpretiert?
Das Bild der Emilia wird als Abbild einer schönen Seele betrachtet. Der Prinz sieht in dem Bild das Ideal des Schönen, was zu einer Vermischung der Ebenen von Geist, Seele, Körper und Abbild führt.
Welche unterschiedlichen Perspektiven auf das Bild der Emilia werden dargestellt?
Der Prinz vermischt die Ebenen und glaubt, die Schönheit der Seele durch den Körper besitzen zu können. Conti hingegen betont die Distanz zwischen Abbild und Urbild und die Unmöglichkeit, die Schönheit der Seele vollständig im Abbild festzuhalten.
Welche Kritik wird an der Haltung des Prinzen geübt?
Dem Prinzen wird vorgeworfen, die Ebenen von Geist, Seele, Körper und Abbild zu vermischen und dadurch das Verlangen zu entwickeln, die erblickte Schönheit zu besitzen oder zu ergreifen, was im Widerspruch zu Contis ästhetischer Haltung steht.
- Quote paper
- Jürgen Klisch (Author), 1991, Deutung der Conti-Szene, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/98042