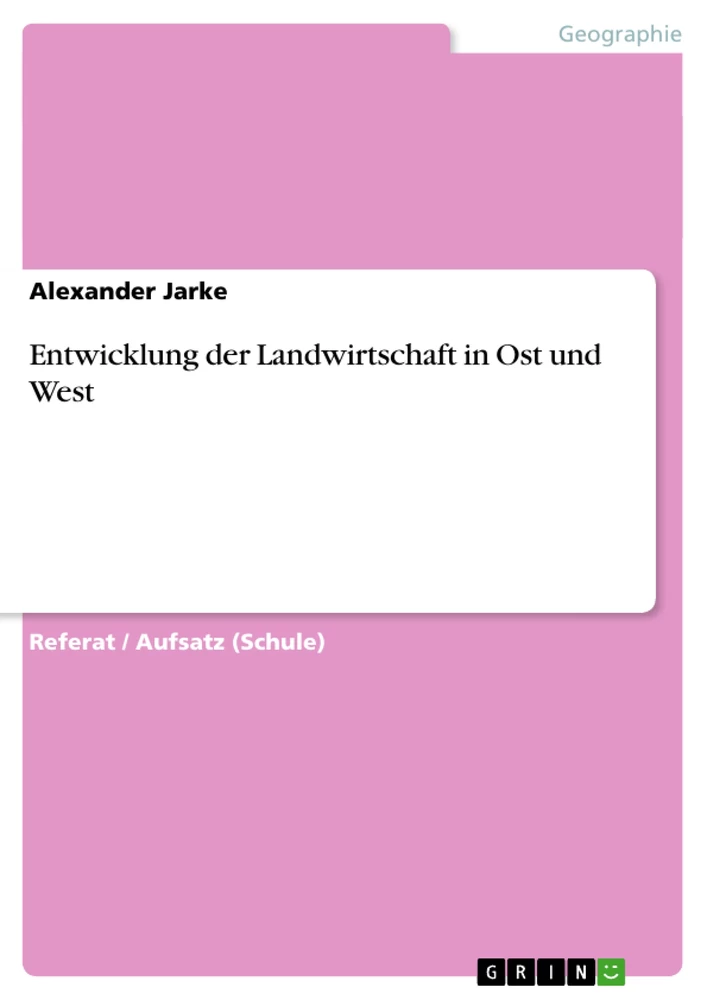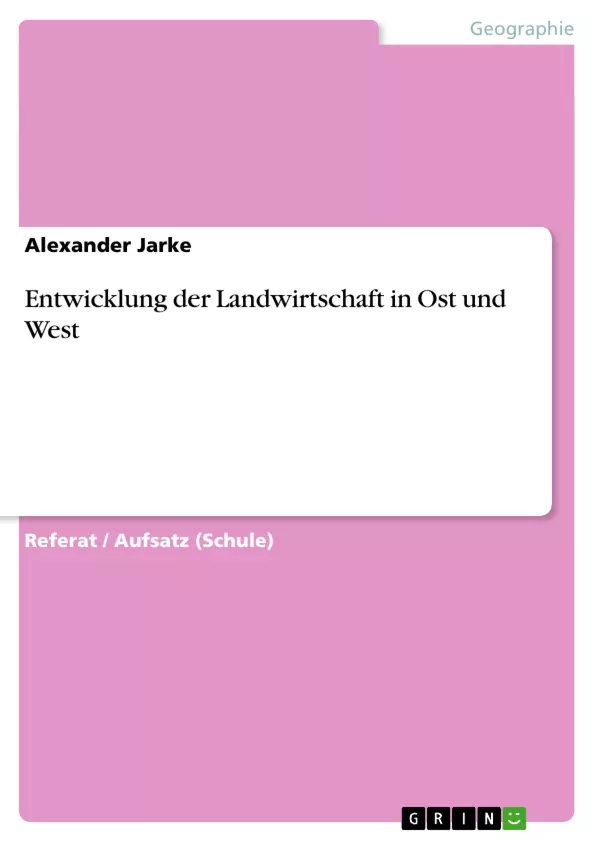Gliederung:
1. Entwicklung in der BRD
2. Fehlentwicklungen in den alten Bundesländern
3. Zukunftsperspektiven der Lw in den alten Bundesländern
4. Entwicklung in der DDR
5. Fehlentwicklungen in den neuen Ländern
6. Zukunftsperspektiven der Lw in den neuen Bundesländern
1.Entwicklung in der BRD
- Strukturwandel nach 2.WK => ,,Industrialisierung" => Organisationen + Produktionsvorgänge bedienten sich industrieller Techniken, auch in bäuerlichen Familienbetrieben
- lief in einzelnen Regionen unterschiedlich schnell ab Grund: Unterschiedliche Betriebsgrößen + Strukturen
- Strukturwandel = reagieren auf den Anpassungsdruck durch :
- Vergleichseinkommen in Berufen außerhalb der Lw
- Preis-Kosten-Relation des Einzelbetriebes
- Agrarpolitik in EG und national
- Anpassung aus betriebswirtschaftlicher Sicht: den teuersten Prod.-faktor durch billigere andere zu ersetzen ~durch Verallgemeinerungen lassen sich einzelne Entwicklungsetappen typisieren
Entwicklungsetappen:
1. ca. 1948: Ersetzung von teuren Faktor Boden durch Faktor Kapital indem ertragssteigernde Betriebsmittel z.B. Mineraldünger/Kraftfutter eingesetzt wurden
- erhöhte Flächenproduktion
2. ca. 1955 Ersetzung des Faktors Arbeit durch Faktor Kapital indem man mechanisierte und sich spezialisierte (Beschränkung der Produktionsbreite)
Folgen: Arbeitskräftebesatz nahm ab; Arbeitsproduktivität nahm zu
3. ca. 1962 Ersetzung des Faktors Arbeit durch Faktor Boden wegen
Einkommens => Unterschiede zw. Lw und Vergleicheinkommen außerhalb der Lw
Weg:
- Erhöhung der landwirtschaftlichen Nutzfläche durch Zupacht/Zukauf (äußere Aufstockung)
- Weg über arbeitsintensive Organisation z.B.
Getreideverarbeitende Veredelungsprod. (innere Aufstockung)
- Nebenerwerbstätigkeit
- Abstockung durch vollständige Betriebsaufgabe
4. ca. 1975 Strukturwandel verläuft gemäßigter, da keine umwälzenden Innovationen stattfanden und sich die Breitenwirkung abschwächte Neben Agrarproduktion gewinnt Landschaftspflege wegen Erholungsfunktion des ländlichen, agrarisch genutzten Raumes an Bedeutung
- Doppelfunktion des Landwirts
- Ausdruck des modernen Strukturwandels: Tendenz zu Monokulturen und Beschränkung auf einen Betriebszweig
- Vorraussetzung für Spezialisierung: Flurbereinigung und Aussiedelung; Mechanisierung in Flur und landwirschaftlichen Gebäuden kommt zum tragen
Fazit:
Der technische Fortschritt hat die Landarbeit in allen Beriechen
humanisiert. Die Vorraussetzung für viele Betriebe war die Aussiedelung. Der Deagrarisierungsprozeß (Weg von der Lw zur Industrie) hat eine Vielzahl der ehemals landwirtschaftlich geprägten Dörfer erfasst.
2. Fehlentwicklungen in den alten Ländern
- verführt von niedrigen Energiepreisen und von kurzfristigen Erfolge
- Landwirte änderten Bewirtschaftungsweise
- Vorbild für Bauern: wirtschaftende Unternehmer => Industrialisierung der Lw mit hohem Fremdinvestitionsbedarf + Betriebsvergrößerungen mit extremen Maschinenkosten + Überlastung der eigenen Arbeitskraft
- Schlagworte dieser Entwicklung:
- Betriebsvereinfachung statt organischen Betriebsaufbau
- Spezialisierung mit risikoreichem Kapitalaufwand statt Vielfalt
- Monokulturen statt Fruchtwechsel
- Betriebsvergr. mit schweren Großmaschinen statt Betriebsanpassung an die Arbeitskraft
- Maximalleistung (Ausbeutung) von Pflanze und Tier
- Krankheitsbekämpfung statt Gesundheitsvorsorge
-Biologisches Ergebnis:
- Abnahme der Bodenfruchtbarkeit und der Gesundheit von Pflanzen und Tieren
- Schwere Verdichtung
- zunehmende Erosion
- immer höhere Dünger- und Pflanzenschutzmitteln
- Auswaschung von Giftstoffen in Trinkwasser
3. Zukunftsperspektiven in den alten Ländern
- Zukunftsperspektiven benötigen agrarpolitisches Umdenken:
- Abbau der Überproduktion
- Abmilderung sozialer Härten beim Strukturwandel
- stärkere Berücksichtigung ökologischer Belange
- Maßnahmen durch EG und auf der Ebene nationaler Agrarpolitik: Gegen Überproduktion:
- Freiwillige Ackerstillegung (gegen Entschädigung)
- Produktionsaufgabenrente (Für Landwirte ab 58, die den Betrieb aufgeben)
- Extensivierung der Flächennutzung (weniger intensive Anbauformen; auch zur ökolog. Regeneration)
- Produktionsumstellungen (auf Anbauprodukte, die nicht zur Überprod. beitragen)
Gegen Tendenz zur ,,Agrarfabrik":
- Stärkung des bäuerlichen Familienbetriebs durch Obergrenze für die Förderung und Einkommensausgleich für EG-bedingte Währungsverluste
Weitere Maßnahmen:
- Direktverkauf ab Hof
- Alternativer Landbau (biologischer Anbau)
4. Entwicklung in der DDR
- bestimmt durch 2.WK
- Zerstörungen in Oderbruch, Nieder- und Oberlausitz und Umgebung von Berlin am größten
- Folgen:
- Bauern gefallen oder gefangen
- Mangel an Vieh, Zugmittel, Saatgut und Geräten
- Weitere Probleme:
- Zustrom dt. Umsiedler aus Osteuropa
- deutsch-deutsche Wanderung von Ost nach West
- Sowjetische Militärverwaltung ersetzte den bestehenden Verwaltungsapparat durch unerfahrene Kräfte
- Herbst 1945: Beginn der Enteignung von Großgrundbesitz über 100 ha _ 47 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche
- Mit 1/3 der Fläche wurden VEG (Volkseigene Güter) aufgebaut
- folgende Bildung von LPGs (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften) geschah unter Zwang und Belastung für die Betroffenen
- Im vgl. mit den VEGs war die Entwicklung der LPGs langwierig und widersprüchlich:
- von 1952 bis 1960 wurden 880 000 Bauernstellen zu LPGs zusammengefasst
- 3 Formen von LPGs: LPG von Typ III der Typ II und I untergeordnet sind (Unterteilt nach Grad der Vergemeinschaftung Typ III_Höchster Grad)
- diese verbanden genossenschaftliche und private Nutzung
- 1975 wurden die Pflanzen- und Tierproduktion auf getrennte LPGs verteilt
- Die Gesamtentwicklung der LPGs stand im Zusammenhang mit der Landtechnischen Ausstattung, da sie begrenzt war
- dadurch Verteilung Druck auf die Bauern
Fazit:
Durch die Vergrößerung der Betriebe wurde die Industrialisierung
(Übergang zu Agrarfabriken) und die Vorraussetzung für soziale
Leistungen für in der Landwirtschaft Tätige geschaffen. Aber es wurden auch erhebliche ökonomische und ökologische Nachteile in Kauf genommen.
5. Fehlentwicklungen in den neuen Ländern
- auf ersten Blick: Großbetriebe besser als Betriebsstrukturen in der BRD
- ABER: Fehlentwicklungen durch sozialistisches System
1. Einseitige Orientierung auf das volkswirtschaftliche Ziel der möglichst vollständigen Selbstversorgung_keine Rücksicht auf Wirtschaftlichkeit/ internationale Wettbewerbsfähigkeit (Zeichen: überhöhte Beschäftigungszahl, unzureichende Rationalisierung, zurückbleiben des Mechanisierungsgrad, uvm.)
2. Preispolitik (Um Differenzen zw. Erzeugerpreisen und künstl. niedrig gehaltenen Ladenpreisen zu kompensieren
- laufende Erhöhung der Subventionen)
3. Maßnahmen zur Prod.-steigerung nur überhastet und unkritisch vorgenommen (~gr. Schäden bei natürlichen Ressourcen)
6. Zukunftsperspektiven in den neuen Ländern
- Perspektiven hängen von:
- Folge-Formen für LPGs ab die gefunden werden
- Geschwindigkeit einer allg. Modernisierung
- Zu bewältigende Probleme:
- Reprivatisierung:
- an schnelle Klärung der Besitzverhältnisse und an die Bereitschaft der LPG - Mitglieder private Betriebe zu gründen, gebunden
- Bereitschaft ist selten, da Bauern den Verlust der soz. Sicherheit fürchten Arbeitskräfteabbau:
- es müssen 50% der Beschäftigten ausscheiden z.B. durch Privatisierung
- außerdem könnten z.B. Dienstleistungsbetriebe neu entstehen
Flächenstilllegung:
- Minderwertige Böden (15% der Fläche sollen aus Prod. genommen werden.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen des Textes "Gliederung"?
Der Text behandelt die Entwicklung, Fehlentwicklungen und Zukunftsperspektiven der Landwirtschaft (Lw) sowohl in der BRD (alte Bundesländer) als auch in der DDR (neue Bundesländer) nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wie hat sich die Landwirtschaft in der BRD entwickelt?
Die Entwicklung in der BRD war von einem Strukturwandel geprägt, der durch die Ersetzung teurer Produktionsfaktoren (Boden, Arbeit) durch Kapital (Mineraldünger, Mechanisierung) gekennzeichnet war. Dieser Wandel verlief in Etappen, die durch technologischen Fortschritt und Anpassung an wirtschaftliche Bedingungen beeinflusst wurden.
Welche Fehlentwicklungen gab es in der Landwirtschaft der alten Bundesländer?
Fehlentwicklungen umfassten die Industrialisierung der Landwirtschaft, die zu Betriebsvereinfachung, Spezialisierung, Monokulturen, Überlastung der Arbeitskraft und der Ausbeutung von Pflanze und Tier führte. Dies resultierte in biologischen Problemen wie Abnahme der Bodenfruchtbarkeit, Erosion und zunehmendem Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln.
Welche Zukunftsperspektiven gibt es für die Landwirtschaft in den alten Bundesländern?
Zukunftsperspektiven erfordern ein agrarpolitisches Umdenken, das den Abbau der Überproduktion, die Abmilderung sozialer Härten, die Berücksichtigung ökologischer Belange und die Stärkung bäuerlicher Familienbetriebe durch Maßnahmen wie Ackerstillegung, Produktionsaufgabenrente, Extensivierung der Flächennutzung und Produktionsumstellungen beinhaltet.
Wie war die Entwicklung der Landwirtschaft in der DDR?
Die Entwicklung in der DDR war durch Enteignung von Großgrundbesitz und die Bildung von LPGs (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften) unter Zwang geprägt. Die LPGs wurden in verschiedene Typen unterteilt und waren von der landtechnischen Ausstattung abhängig, was zu Druck auf die Bauern führte.
Welche Fehlentwicklungen gab es in den neuen Bundesländern?
Fehlentwicklungen in den neuen Ländern resultierten aus dem sozialistischen System, das eine einseitige Orientierung auf Selbstversorgung ohne Rücksicht auf Wirtschaftlichkeit, überhöhte Beschäftigungszahlen, unzureichende Rationalisierung und überhastete Maßnahmen zur Produktionssteigerung mit Schäden an natürlichen Ressourcen beinhaltete.
Welche Zukunftsperspektiven gibt es für die Landwirtschaft in den neuen Bundesländern?
Zukunftsperspektiven hängen von den Folgeformen für LPGs, der Geschwindigkeit der Modernisierung und der Bewältigung von Problemen wie Reprivatisierung, Arbeitskräfteabbau und Flächenstilllegung ab.
Was bedeutet die Reprivatisierung für die Landwirtschaft in den neuen Bundesländern?
Die Reprivatisierung bezieht sich auf die Klärung der Besitzverhältnisse und die Bereitschaft der LPG-Mitglieder, private Betriebe zu gründen. Dies ist jedoch oft durch die Furcht vor dem Verlust der sozialen Sicherheit erschwert.
Warum ist der Arbeitskräfteabbau ein Problem in der Landwirtschaft der neuen Bundesländer?
Der Arbeitskräfteabbau ist ein Problem, da schätzungsweise 50% der Beschäftigten ausscheiden müssen, was soziale und wirtschaftliche Herausforderungen mit sich bringt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass neue Dienstleistungsbetriebe entstehen.
Was bedeutet Flächenstilllegung und welche Probleme ergeben sich daraus?
Flächenstilllegung bedeutet, dass minderwertige Böden aus der Produktion genommen werden sollen. In einigen Regionen, wie Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, könnte dies jedoch dazu führen, dass ganze Landstriche wegfallen, was erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen hätte.
- Quote paper
- Alexander Jarke (Author), 2000, Entwicklung der Landwirtschaft in Ost und West, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97770