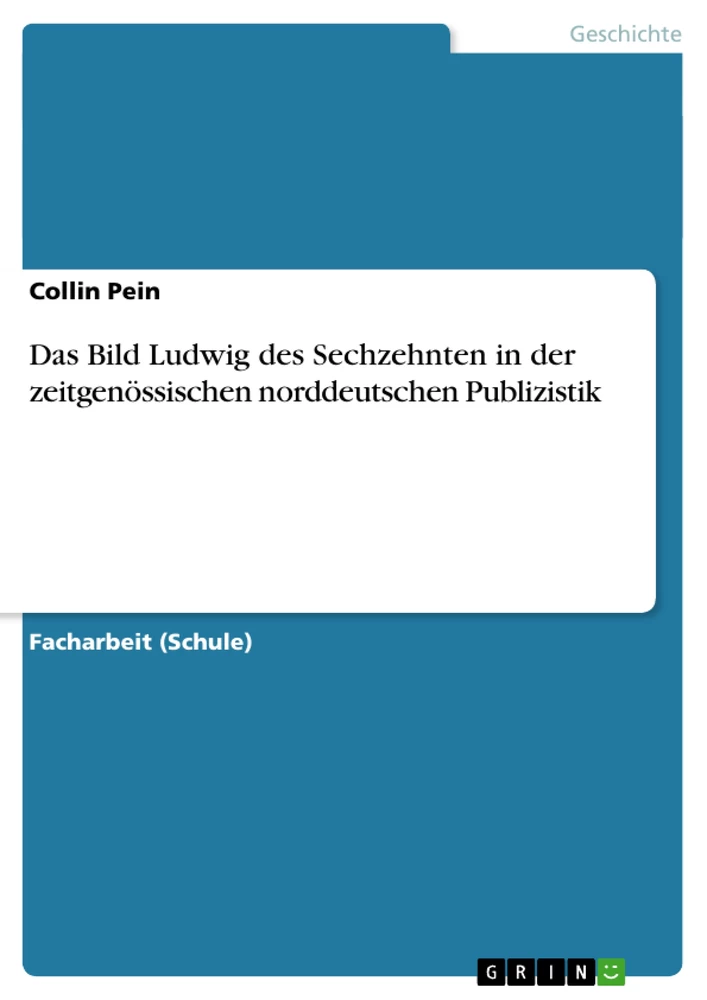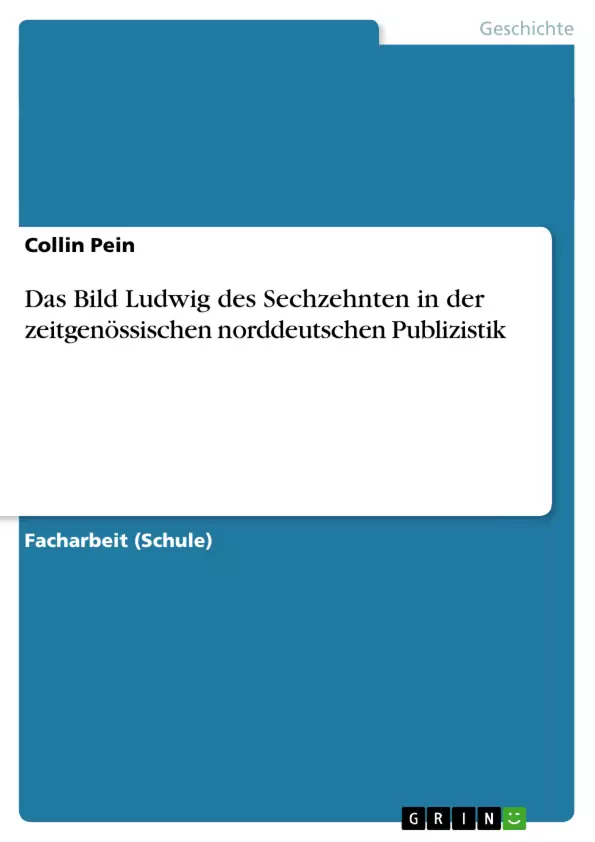INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN UND TABELLEN
I. EINLEITUNG
II. DAS KURFÜRSTENTUM HANNOVER
III. DAS NEUE HANNOVERISCHE MAGAZIN
IV. Das Bild L. XVI im NHM
V. SCHLUSS
LITERATURVERZEICHNIS
NACHWORT
VORWORT
Konrad Adenauer beschreibt in dem Vorwort zu seinen Memoiren ein Gespräch, welches er mit einem Professor für neuere Geschichte führte, in welchem sich zwei kontrastierende Meinungen klar abzeichneten. Während der Historiker den Standpunkt vertrat, "es sei nicht Aufgabe des Historikers, Entwicklungen im voraus zu sehen. Die Historiker seien eben keine Propheten. Ihre Aufgabe sei es, das, was geschehen sei, möglichst wahrheitsgetreu festzuhalten oder zu ermitteln."1, weist Adenauer darauf hin, dass er es für die Aufgabe eines Historikers halte "auf dem Wege von Analogieschlüssen aus dem Geschehen unserer Zeit, sogar unserer Tage, zu erkennen, wohin der Lauf der Entwicklung wahrscheinlich gehen werde, und sie müßten in ihrer Lehre hinweisen auf zu erwartende Entwicklungen und eventuell warnen."1 Des weiteren macht er darauf aufmerksam, dass Erfahrung "eine Führerin des Denkens und des Handelns sein"1 kann, die durch nichts zu ersetzen ist. Meiner Ansicht nach ist es nicht nur wichtig das Geschehen unserer Zeit zu analysieren und anhand von Analogieschlüssen auf den Lauf der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung hinzuweisen, sondern die gesamte Geschichte in dieser Hinsicht zu bearbeiten. Die daraus gewonnene Erfahrung kann dann wirklich eine Führerin unseres Denkens und Handelns sein. Viele bittere Erfahrungen könnten uns dadurch erspart bleiben. Es ist also folglich sehr wichtig, bei jedem geschichtlichen Aufsatz auf Lehrpunkte hinzuweisen, um dadurch an den Leser oder Zuhörer, die bei dem Studium des Themas gewonnene Erfahrung weiterzugeben, dass sie ihm von Nutzen sei, durch das Leben leite und so auch die Gesellschaft festige. Unter diesem Gesichtspunkt bin ich an meine Facharbeit herangegangen und beabsichtige dem Leser eine hoffentlich gelungene Nutzanwendung präsentieren zu können. Die mir zur Verfügung stehende Zeit reichte natürlich nicht aus, ein sehr sorgfältiges Studium zu betreiben, mit dem Zweck alle Aspekte des Themas voll zu erfassen und darzustellen. Ich hoffe also nicht, dass der Leser meiner Arbeit, von wissenschaftlicher Genauigkeit derselben ausgeht, denke allerdings, dass meine Arbeit durchaus in der Lage ist, einen für meine Gedanken aufgeschlossenen Leser, einen groben Überblick über das als Reaktion auf die Französische Revolution im Kurfürstentum Hannover entstandene Bild Ludwigs des Sechszehnten, oder besser gesagt das Bild eines absolutistischen Herrschers, sowie eine passable Nutzanwendung zu vermitteln.
Bei der Bearbeitung meines Themas: "Das Bild Ludwig des Sechszehnten in der zeitgenössischen norddeutschen Publizistik", kam es mir nicht darauf an, eine detaillierte Beschreibung von Ludwig dem Sechszehnten zu erarbeiten, sondern vielmehr die Darstellung desselben in den mir zur Verfügung stehenden zeitgenössischen norddeutschen Quellentexten aus dem Neuen Hannoverischen Magazin zu analysieren und Abweichungen zu einer objektiven Betrachtungsweise herauszustellen, also das Bild Ludwigs des Sechszehnten nachzuzeichnen und mögliche Gründe für Verschönerungen, Übertreibungen und Falschdarstellungen, d.h. jegliche Abweichungen zur realen Person zu erarbeiten und Gründe für diese Abweichungen festzustellen. Aufgrund zeitlicher Restriktionen, dem damit verbundenem Problem der Literaturbeschaffung, sowie der Komplexität des zu bearbeitenden Stoffes, sei es mir verziehen, wenn ich einige Behauptungen nicht lückenlos beweisen kann. Bei einer intensiven Forschungsarbeit werden Sie meine Annahmen sicherlich als bestätigt finden. Ich wollte diese Thesen allerdings nicht als mangelhaft begründet weglassen, da sie viel Aussagekraft besitzen und zu noch intensiverer Forschung, auch von Seiten des Lesers anregen. Im übrigen habe ich auch noch zeitgenössische französische Quellentexte zu Rate gezogen um, zu sehen, welche Abweichungen zwischen diesen Quellentexten und der Beschreibung im Neuen Hannoverischen Magazin auftreten und um festzustellen ob diese verschiedenen Beschreibungen von Ludwig dem Sechszehnten zwei Extreme darstellen, ob sich etwa eine royalistische und eine revolutionäre, republikanische Ansicht der Dinge abzeichnet.
Bardowick, den September 18, 2000 Collin Pein
Einleitung
"Es war die beste aller Zeiten, aber auch die schlimmste aller Zeiten"2, so begann Charles Dickens seinen historischen Roman Eine Geschichte von zwei Städten, der die Französische Revolution behandelte. Er wollte damit sowohl, den Optimismus, von dem die damals lebenden Menschen aufgrund der drastischen Änderungen, die in der Geschichte vor sich gingen erfüllt waren, als auch die Unruhen jener Zeit beschreiben. Ja, die Ereignisse in Frankreich ab 1789 führten zu Umwälzungen, die sich weit über die Landesgrenzen hinaus bemerkbar machten. Die Aristokratie büßte den größten Teil ihrer Sonderrechte ein, das Feudal- system wurde abgeschafft, die Macht der Kirche gesetzlich beschnitten und man erklärte die Menschen- und Bürgerrechte, sowie eine ganz neue Verfassung. Das Zeitalter des Absolutismus fand sein Ende.
Man kann sich sicherlich gut vorstellen, dass diese Ereignisse auch am Kurfürstentum Hannover nicht ohne Schatten vorrüberzogen. Die französische Kultur, angefangen von Mode, Etikette und Architektur, bis hin zur Politik hatte besonders bei den deutschen Fürsten großes Gefallen gefunden, wie aus vielen zeit- genössischen Bauten in Deutschland ersichtbar3. Dieser Nachahmungstrieb, sei es nun im architektonischem oder politischem Bereich erreichte seinen Höhepunkt in der Herrschaft Ludwigs des Vierzehnten, bis zum Anfang der Regierung Ludwigs des Sechszehnten, also kurz vor der Französischen Revolution, durch die die glanzvolle Epoche des Absolutismus in Frankreich sein jähes Ende fand. Es entwickelte sich in der Folge von Seiten anderer absoluter Monarchen Europas verständlicherweise4 eine Furcht vor dem Übergreifen der Revolution in ihr Land, sie sahen ihre Macht wie die, der Herrscher Frankreichs schwinden. Als konsequente Maßnahme, um ihre Macht zu sichern wurde nun zumindest in frankreichnahen Staaten versucht breiten Bevölkerungsschichten ein negatives Bild der Französischen Revolution zu vermitteln, insbesondere, durch die gezielte Steuerung der Medien. Dementsprechend wurde das bestehende System hoch angepriesen und auch das Bild der absolutistischen Herrscher Frankreichs wurde ver- schönert, wo man konnte, die Revolutionäre dagegen wurden als arme verführte und gottlose Menschen beschrieben. In Kurhannover, war dies aufgrund der politischen Lage besonders notwendig, den der Kurfürst war aufgrund der Personalunion mit England5 weit weg und ohne persönlichen Bezug zu seinen hannoveranischen Untertanen, Frankreich und seine revolutionären Gedanken waren aber desto näher. In meinen weiteren Ausführungen werde ich versuchen die soeben geschilderte zentrale These meiner Fach- arbeit (kursiv gedruckt) dadurch zu untermauern, dass ich Stellen aufweise, wo das verstaatlichte Neue Hannoverische Magazin [NHM], eine zeitgenössische norddeutsche Quelle ganz klar ein der Realität nicht entsprechendes Bild von Ludwig dem Sechszehnten [L. XVI] und der Beziehung zu seinen Gegnern, den Revolutionären aufzeigt und so diese "gelehrten Beiträge" dazu verwendet wurden, die Revolutionsbegeisterung in Kurhannover zu mildern oder gar auszumerzen. Die Fragestellung, war L. XVI wirklich so sehr, wie im NHM beschrieben, am Wohl des französischen Volkes interessiert, oder war es vielmehr die Aufgabe eines absoluten Herrschers seine eigenen Interessen nach dem Motto "L'état c'est moi" an die erste Stelle zu setzen, wird z. B. eine der zentralen Fragen, dieser Arbeit sein, auf die ich versuche eine befriedigende Antwort zu erarbeiten. Ich werde dann nach intensiver Betrachtung einiger Detailbeispiele auf die zentrale These schließen, und einen Vergleich mit der heutigen Zeit anstellen. Denn die Beeinflußung breiter Gesellschaftsschichten durch die Publizistik war nicht nur zu Zeiten der Französischen Revolution ein beliebtes Mittel. Aufgrund zeitlicher Restriktionen bitte ich nochmals darum nicht von wissenschaftlicher Exaktheit meiner Ausführungen auszugehen, sondern sie als Anregung weiter zu forschen zu verstehen.
Das Kurfürstentum Hannover
Das Kurfürstentum Hannover, welches zur Zeit der Französischen Revolution in etwa das heutige Ost- niedersachsen ausgenommen des Braunschweiger und Hildesheimer Landes, mit den Provinzen, um nur einige anzuführen: Bremen, Osnabrück, Lüneburg und natürlich Hannover beinhaltete, war alles in allem ein armes Land. Es nahm, wie eine zeitgenössische Quelle beschreibt "an Größe, Volksmenge und Kriegsmacht die fünfte Stelle unter den Staaten Deutschlands"6 ein. Gemäß L.W. Gilbert hatte Kur- hannover 1790: 869.643 Einwohner, von denen allerdings die meisten auf dem Land lebten und so arm waren, dass sie sich nur durch einen Nebenverdienst im Leinengewerbe wirtschaftlich über halten konnten. Zu dieser Armut, die sicherlich aufgrund der kargen Heide- und Moorlandschaft im Norden des Landes, sowie den Verwüstungen und finanziellen Belastungen des siebenjährigen Krieges (1756 - 63) herrschte, kamen dann noch die Mißernten 1771-73 mit den damit verbundenen Hungersnöten und dem Anstieg der Lebensmittelpreise, sowie die strengen Winter in den 1780er Jahren mit Temperaturen, bis zu -35,5 °C. Das fehlen der Kaufkraft in vielen Landstädten führte zum Rückgang des Lebensmittelangebots und dann auch zum allgemeinen Verfall vieler Städte. Das Dorfleben hob sich in Bezug auf die Lebens- bedingungen von den Städten nicht positiv ab, hier war jedoch eher die Hygiene das Hauptproblem.
Schon seit dem Mittelalter waren die Stände in Kurhannover in zwei Klassen eingeteilt: die Gesellschaft und die Bürger. Wobei erstere Gruppe den alten und den neuen Adel beinhaltete. Außer dem Adel gab es dann auch noch das Bildungsbürgertum, die Kauf- und Handelsleute, hochrangige Militärs, sowie unter anderem auch Geistliche, Juristen und Ärzte, die ein geregeltes gutes Einkommen bekamen und steuerlich zum Teil begünstigt waren, im Gegenteil zur meist armen, ungebildeten Landbevölkerung.7 Die Bildungssprache war Französisch, Hoch- und Plattdeutsch die Muttersprachen, wobei der ärmliche Teil der Bevölkerung letztere sprach. Auffällig ist, das es, vielleicht zufolge der gesonderten Provinzen, mit jeweilig unter- schiedlichen Rechts- und Steuergesetzen in Kurhannover zu keiner einheitlichen Bewußtseinsbildung kommt, wie in Frankreich. Politisch gesehen war Kurhannover im Fahrwasser der englischen Politik. Der Kurfürst, der durch die Personalunion mit England, d.h. er war zugleich auch König von England, seinen Aufenthaltsort in London hatte, schrieb der von ihm eingesetzten Regierung der Geheimen Räte8 in Hannover eine grundlegende Politik vor. Um sein äußerstes Gefalllen an seinen hannoverannischen Untertanen zu zeigen, machte der damalige Kurfürst Georg III. (1760-1820) diese für seine englischen Kolonien dienstbar, indem er Truppen abkommandierte. So mußte das hannoveranische Militär, dann auch auf Befehl Georg III. gegen Frankreich in den Krieg ziehen und so an den sogenannten Revolutionskriegen teilnehmen. Die hohe Desertionsrate zeigt uns den Unwillen großer Teile der Bevölkerung, dem Kurfürsten zu gehorchen, denn seit der Personalunion hatte der Kurfürst keine persönliche Verbindung mehr zu seinen Untertanen und so wurde bei vielen aus der Vaterlandsliebe die Heimatsliebe. Ganz entgegen den Erwartungen der wohlhabenden Führungsschicht und der allgemeinen Unzufriedenheit aufgrund der Lebensumstände blieb es trotz der Revolution in Frankreich in Kurhannover relativ ruhig. Es stimmt zwar, dass es seit 1789 zu vermehrten lokalen Unruhen kam, doch durch verstärkten Druck der Obrigkeit gegenüber Personen mit revolutionären Gesinnungen, die Umverteilung der Steuerlast, staatserhaltende Propaganda, die Zensur und auch das Verbot revolutionsfreundlich gesinnter Zeitschriften und Zeitungen wurde das bestehende Regierungs- system gefestigt und damit die Macht des Kurfürsten, sowie der Führungsschicht in Kurhannover gefestigt. Die Regierung in Hannover versuchte nur den Anschein zu erwecken liberal zu sein, war es aber nicht.
Das Neue Hannoverische Magazin
Schon seit 1750 erschien eine verschiedentlich benannte, seit 1763 unter dem Namen Hannoverisches Magazin bekannte Wochenschrift, welche `gelehrten Beiträge' beinhaltete. Diese stammte aus einem Privatunternehmen, dem Intelligenzcomtoir,der verantwortliche Herausgeber der Zeitschrift A.C. von Wüllen, welcher als Hofgerichtsassesor und Landsyndikus tätig war, folglich also in öffentlichen Diensten stand. 1791 nach dem Tode von A.C. von Wüllen wurde diese Zeitschrift, sie erschien zwei mal pro Woche, `um die dauerhafte Herausgabe zu garantieren' in landesherrliche Administration übernommen und von nun an erschien sie unter dem Namen Neues Hannoverisches Magazin, durch den Königlich Kurfürstlichen Intelligenzcomtoir, wobei anscheinend der Geheime Kanzleisekretär F.A. Klockenbring der verantwortliche Herausgeber ist. Die meisten bekannten Schreiber der Beiträge im NHM sind Staatsdiener gewesen und so scheint es dann auch ohne Zweifel, dass das NHM wie C. Haase es ausdrückt "das Sprachrohr der höheren Beamtenschaft"9 darstellt, d.h. regierungskonform ist. Schon allein der ausführliche Name gibt uns genügend Hinweise in Bezug auf den Zweck des NHM, er lautet: "Neues Hannoverisches Magazin worin kleine Abhandlungen, einzelne Gedanken, Nachrichten, Vorschläge und Erfahrungen welche die Verbesserung des Nahrungsstandes, die Land- und Stadtwirthschaft, Handlung, Manufakturen und Künste, die Physik, die Sittenlehre und angenehmen Wissenschaften betreffen, gesammelt und aufbewahret sind."10 Hier wurden dann die durch Zensur staatlich kontrollierte Beiträge abgedruckt, um aufklärerisch und gemeinnützig, die Verbesserung der Lebensumstände, der Sitten und der Moral aller Untertanen zu bewirken und nebenbei auch Staatspropaganda betreiben zu können, wie man aus zahlreichen Beiträgen entnehmen kann.11 Meiner Meinung nach, muss das NHM, wie auch das HM eifrigen Zuspruch gefunden haben, ja die Leser- schaft muss mindestens so groß gewesen sein, dass es sich für den Staat lohnte diese in Administration zu nehmen, um sie als Propagandamittel benutzen zu können. Es sei denn dieser habe sie nur übernommen, um, bei strikter Einhaltung seiner Zensur- und Verbotspolitik eine Zeitschrift auf Dauer zu veröffentlichen und so zu propagieren, dies sei das staatliche Organ der freien Meinungsäußerung des selbstbewußten Bürgers. Da in den unteren Schichten der Bevölkerung größtenteils der Analphabetismus herrschte war und die Zeitschrift zu beziehen für die meisten, sicherlich auch ein finanzielles Problem dargestellt haben würde, bin ich der Ansicht, das NHM sei an Teile des Bildungsbürgertums gerichtet, also z.B. an Regierungsbeamte, Ärzte oder Handelsleute, um zu verhindern, dass Intellektuelle diesen Standes sich mit den unteren Volksschichten verbinden, damit diese gegen die bestehende Regierung rebellieren. Da es in Kurhannover keine großen Volksbewegungen gab, war der Zweck dieser Zeitschrift sicherlich erreicht, wenngleich sie wahrscheinlich nur wenig dazu beigetragen hat das bestehende System zu stabilisieren. Da ich in den nun folgenden Kapiteln mit verschiedenen Beiträgen eines gewissen G.F. Palm beschäftigen werde, möchte ich an dieser Stelle kurz erläutern, was ich zu seiner Person weiß, um dann auch ein besseres Textverständnis erlangen zu können. C. Haase gibt an dieser Stelle zwei Personen an, welche er nach intensiven Nachforschen in Betracht zieht, die Beiträge im NHM geschrieben zu haben, da wäre zunächst ein Georg Frider. Palm, Adensius Calenbergens. theol., der am 12. 4. 1780 in Göttingen immatrikuliert, aber scheinbar kein hannoverscher Geistlicher geworden ist, sowie einen unter den Lizentbediensteten genannten Einnehmer Palm in der Stadt Hannover, welcher im Staatskalender von 1769 als Einnehmer adjunctus, 1791 dann aber als Einnehmer adjunctus, emeritius bezeichnet wird und selbst 1798 im Hannöverschen Adreßbuch erscheint.12 Nach intensiver Textarbeit und einem Vergleich der von mir geschätzten Alter, der Berufe, sowie der mir bekannten Aufenthaltsorte oder Wohnsitze, kam ich zu dem Schluss, dass anscheinend der Lizentbedienstete Palm die Beiträge zum NHM geleistet hat. Welcher folglich als Staatsdiener in mit einem Alter zwischen 40-50 Jahren am 9. Oktober 1789 einen der Französischen Revolution noch relativ gut gesonnen Artikel schreibt, dann 1791 emeritiert wird und 1793, also kurze Zeit später drei ausführliche Charakterschilderungen von L. XVI und M. Antoinette für das NHM schreibt, die im Gegensatz zu seinem ersten Artikel 1789, die Französische Revolution verurteilen und den absolutistischen Herrscher ver- herrlichen, wahrscheinlich hatte er seine Meinung nach der Radikalisierung der Revolution in Frankreich, wie es übrigens viele zuerst begeisterte Anhänger revolutionären Gedankenguts taten, geändert.
Das Bild L. XVI im NHM
G.F. Palm stützt sich bei seinen Ausführungen, die am 22+25 März 1793 im NHM auf jeweils acht Seiten erscheinen, wie auch schon in seinem früheren Beitrag von 1789 auf zahlreiche andere Schriften. Drei davon erwähnt er sogar namentlich, da wäre zuerst ein französischer Artikel von 1780, von einem gewissen Abbe Proyart aus Paris, sodann bezieht er sich auf eine deutsche Zeitung und zuletzt zitiert er wörtlich einen mehrseitigen Auszug aus der Verteidigungsschrift L. XVI von J. Necker. Das Anführen von so vielen verschiedenen Beschreibungen des Königs, erklärt die vielen Widersprüche, die in seinem Text auftreten. Ein Beispiel gibt uns die falsche Datierung des Sterbedatums L. XV, dies wird in einer der Schriften, auf die sich Palm bezieht fälschlicherweise auf den 20.12. 1765 festgelegt wurde, während L. XV aber tatsächlich erst am 10.5. 1774 gestorben ist. Palm korrigiert dies nicht, erwähnt aber wenige Seiten später, Ereignisse, die deutlich zeigen, dass L. XV erst in den 1770er Jahren gestorben sein kann.13 Entweder wollte sich Palm nicht die Arbeit machen, diese Widersprüche zu erklären und es kam ihm bei dem Schreiben nur auf das damit verbundene Honorar an, oder er wollte die Beweisführung L. XVI sei ein besonders guter Mensch, durch gravierende Widersprüche im Text und den damit verbundenen Verlust des Vertrauens der Leser an dem Wahrheitsgehalt, gleichzeitig wiederlegen. Letzteres würde zwar zu der wirklich übertriebenen Beschreibungsweise L. XVI passen, dessen gutes Herz Palm 11 mal auf den 16 Seiten beschreibt, immer verbunden mit vielen Adjektiven, seinem Mitgefühl und seinen überaus guten Absichten in Verbindung mit dem Volk, welches ihn insgesamt als fast vollkommenen Menschen darstellt. Doch der sich durch seine Langatmigkeit, durch viele Beispiele und überlange Zitate auszeichnende Artikel, weist eher darauf hin, dass sich Palm nicht noch die Arbeit machen wollte diese Widersprüche aufzuklären, sondern vielmehr er einfach gesagt nur das geschrieben hat, was der Herausgeber hören wollte, etwas, was der Aufgabe des NHM absolut gerecht wird und gründlich beschrieben das Verhältnis der bösen Revolutionisten zu dem guten König. Bei einem neutralem Lesen des Artikels, empfindet man
LITERATURVERZEICHNIS
Verwenden Sie den Bibliographie-Assistenten, um mit minimalem Aufwand ein
Literaturverzeichnis für Ihre Seminararbeit zu erstellen. Stellen Sie sicher, daß Sie den gleichen Stil wie im Literaturverzeichnis auch für Ihre Fußnoten verwenden.
Anhang
Abbildung 1: Großes Staatswappen des Königreich Hannover
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle:http://www.koenigreich-hannover.de
Abbildung 2: Ludwig der Sechszehnte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: http://www.geschichte.2me.net/dch/dch_1562.htm
Abbildung 3: Georg III.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: http://www.geschichte.2me.net/dch/dch_1527.htm
Abbildung 4: Hannover Herrenhausen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dieses Photo zeigt Schloß Herrenhausen in der Zeit als das Königreich Hannover von Preußen im Jahre 1866 annektiert wurde. Nach der Annexion verblieb das Schloß im Besitz der Welfen. Das Schloß Herrenhausen wurde 1943 im 2. Weltkrieg zerstört und trotz wiederholter Diskussionen und Planungen nicht wieder aufgebaut. Erhalten geblieben ist hingegen das Galeriegebäude und der Große Garten im Stile des Barock. Das Schloß und der Große Garten in Herrenhausen gehen auf einen Wirtschaftshof von 1638 zurück. Der barocke, in mehreren Bauabschnitten entstandene Schloßbau, der 1819/20 von Georg Ludwig Laves im Stil des Klassizismus umgestaltet wurde, lag im Zentrum alter Wegachsen und Gartenerweiterungen, ursprünglich vor den Toren der Stadt Hannover.
Quelle: http://www.welfen.de/schlossHerrenhausen.htm
Abbildung 5: Hannover Herrenhausen (Gärten)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: http://www.geschichte.2me.net/dch/dch_1428.htm
Abbildung 6: Emblem der Französischen Revolution
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: http://www-geschichte.fb15.uni-dortmund.de/vl/fnz/revol.htm
Tabelle 1: Versuch der Identifizierung von G.F.Palm
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Rechnung: Alter
Georg Frider. Palm
wird am 12.4. 1780 in Göttinge immatrikuliert, geschätztes Alter bei Immatrikulation 15-25 Jahre, geschätzte Studienzeit 5 Jahre: dann wäre er am 9. Oktober 1789 zwischen 20- 30 Jahre alt
Der Lizentbedienstete Palm
wird 1769 bereits als Einnehmer adjunctus erwähnt, wird 1791 als emeritius bezeichnet, wenn wir annehmen er wäre 1769 20- 30 Jahre alt gewesen und würde dann mit 42-52 Jahren emeritiert und wird dann noch 1798 mit 49-59 Jahren im Hannöverschen Adreßbuch erwähnt, so entspricht dies bestimmt der durchschnittlichen Lebenserwartung eines Lizentbediensteten,
er hätte dann mit 40-50 Jahren am 9 Oktober 1789 den ersten Beitrag zum NHM tätigen
können.
Ich stütze mich bei all meinen Angaben auf dieser Seite, auf die Ausführungen von C.Haase, für dessen Richtigkeit ich nicht garantieren kann!
Wiederprüche in G.F. Palms Artikeln
(eine Ergänzung, siehe Fußnotenvermerk: Fn. 14)
Während es im ersten Teil des Artikels "Ludwig der Sechszehnte" vom 22+25 März 1793 in Bezug auf L. XV und seine Gemahlin heißt: "Beide hatten sich in den ersten Wochen ihres Ehestandes verabredet, ihre gegenseitige moralische Besserung, als tägliche Pflicht der Liebe und Freundschaft anzusehen; beide achteten es für eine unabläßliche Schuldigkeit, ihren Kindern, im erhabensten Sinne, ..., ihnen von der Wiege an, selbst Weisheit und Tugend durch Lehre und Beispiel einzuflößen.", gibt die Geschichte uns ein ganz anderes Bild von L. XV, der bereits 1745 ein Verhältnis mit der bekannten Pompadour hat und 1773 sein Plan eine andere Mätresse, nämlich eine gewisse du Barry zu heiraten scheitert. Ein Widerspruch tritt zutage, wenn man betrachtet, das Palm wohlweißlich wenige Seiten später über die königliche Familie, also auch über L. XV schreibt: "Die Unsittlichkeit im Umgange beider Geschlechter, war ihm (L. XVI) schon im Jünglingsalter äußerst verhaßt. Von der ganzen königlichen Familie war Er allein durchaus nicht dahin zu bringen der berüchtigen dü Barri zu heucheln "
Versicherung der selbstständigen Erarbeitung
Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit selbstständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und die Stellen, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt aus anderen Werken entnommen wurden, mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht habe.
Verwendete Informationen aus dem Internet sind dem Lehrer vollständig im Ausdruck zur Verfügung gestellt worden (tw. nach Absprache).
Bardowick, den 17. Dezember 1999
Collin Pein
NACHWORT
"GESCHICHTE" wird unter anderem als die Aufzeichnung des vergangenen Geschehens in Bezug auf den Menschen definiert. Die Geschichte kann natürlich von verschiedenen Seiten aus betrachtet werden. Zum einem gibt es Personen, die die Auffassung vertreten, dass wer sich weigere, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, dazu verurteilt ist sie zu wiederholen. Andererseits gibt es auch eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die behaupten, das Geschichte Unsinn sei.
Ein Körnchen Wahrheit steckt in beiden Ansichten, denn man aus der Geschichte lernen, wenn man aus den Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht wurden, eine Lehre zieht und in seinem Leben entsprechend handelt. Die Geschichte kann aber auch, wie zum Beispiel in den 1930er und 40er Jahren von den Nationalsozialisten, dazu gebraucht werden Personen irrezuführen. Die Nationalsozialisten gebrauchten eine verzerrte Geschichtsdarstellung, um das Volk vom Mythos der germanischen Herrenrasse zu überzeugen. Diese Geschichtsdarstellung war mitverantwortlich, für die Katastrophe die dann folgte und damit für den Tod von Millionen Menschen.
Ja, man kann aus der Geschichte nur lernen, wenn man auch ein richtiges Bild der Vergangenheit hat und sich zuverlässigen Quellen zuwendet.
Der Philosoph Georg W.F. Hegel sagte einmal: "Was die Erfahrung aber und die Geschichte lehren, ist dieses, daß Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte gelernt und nach Lehren, die aus derselben zu ziehen gewesen wären, gehandelt haben."14 Der Verlauf der Menschheitsgeschichte wurde sogar schon als "Parade der Torheit" bezeichnet, als eine Reihe entsetzlicher Irrtümer und Krisen, von den viele hätten vermieden können, wenn der Mensch aus früheren Fehlern gelernt hätte.
Der englische Dichter und Philosoph Samuel Taylor Coleridge bringt die Sache auf den Punkt, wenn er sagt: "Welche Lehren könnten wir aus der Geschichte ziehen, wenn der Mensch nur daraus lernen wollte!"
Die heutige dem Ichkult ergebene Generation läßt das, was man aus der Geschichte lernen kann jedoch einfach außer acht. Das fängt schon allein bei dem Geschichtsuntericht vieler Schulen an, der sich vielfach nur über vergangene Ereignisse, Schlachten, Dokumente und berühmte Personen dreht. Gemäß dem englischen Schriftsteller H.G. Wells erschöpft sich "der knappe Geschichtsunterricht" in der Schule sozusagen in "einer langweiligen und größtenteils wieder vergessenen Namensliste von Königen und Präsidenten". Doch für denkende Menschen sollte die Geschichte eine Lampe sein, die die Irrtümer der Vergangenheit und der Gegenwart gewissermaßen erhellt und wie eingangs, im Vorwort bemerkt auch aufgrund von Analogieschlüssen einen Ausblick in die Zukunft vermittelt.
Das ist es, was ich von meinem Leser wünsche, das er das, was er am Beispiel der Mediensteuerung in Norddeutschland zu Zeit der Französischen Revolution gelernt hat, nicht vergißt wie eine Namensliste, sondern nach einem persönlichen Studium des vorliegenden Wekes für sich persönlich eine Lehre zieht und diese dann auch beherzigt. Der Leser meines Werkes mag bedenken, dass zur Zeit der Französischen Revolution, viele Intellektuelle Europas davon überzeugt waren, das die Revvolution mit ihrem aufrüttelnden Schlachtruf "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" den Beginn eines neuen Zeitalters für die ganze Menschheit darstellt.
Fragen Sie sich aber ehrlich, sind die utopischen Träume der Französischen Revolution in Erfüllung gegangen?
Aufgrund der Geschichte muss die Antwort verneint werden. Finanzprobleme, Bürger- und Freiheitsrechte werden nicht nur in den sogenannten Dritte Welt Ländern mit Füßen getreten, selbst in der sogenannten zivilisierten Welt spotten viele Regierungs- oder von den Regierungen gebilligte Handlungen, dem Beitritt vieler Politiker und anderer Persönlichkeiten der Öffentlichkeit in sogenannte Menschenrechts- organisationen, die die armen Dritte Welt Länder unterstützen und deren Erfolge von der Presse hoch gelobt wird, die Mitglieder natürlich mit eingeschlossen. Wenn wir hier in Deutschland zwar auch nicht das Problem haben, das die Presse einer strengen staatlichen Zensur unterliegt, so haben wir trotzdem eine starke Meinungsbeeinflussung durch diese und da Geld die Welt regiert, Presse käuflich ist haben wir vielmehr auch das Problem den Wahrheitsgehalt so mancher zu überschätzen.
Das NHM verfolgt wie wir gesehen haben, ein ganz klares Ziel, dass festigen des bestehenden monarchistischen Staates. Doch welches Ziel verfolgt jeder einzelne, der so zahlreichen Presseartikeln, die uns heute, sei es in Massen durch das Internet, im Fernsehen, oder in den Zeitungen begegnen? Es liegt an uns das herauszufiltern, was wahr ist, denn nur so können wir ohne Vorurteile und ungewollte Beeinflußung, d.h. objektiv Entscheidungen treffen. Etwas, das für unsere Zeit unheimlich wichtig ist.
[...]
[1] Zit. nach: Konrad Adenauer, Konrad Adenauer Erinnerungen 1945- 1949, 7 Bde., Augsburg 1996, S.11
[2] Zit. nach: Charles Dickens, Eine Geschichte von zwei Städten, 1987, S.
[3] s. Abbildung , : Hannover Herrenhausen [Anhang S. , ]
[4] Vgl.: Walter Markov, Die Französische Revolution im Zeugenstand Frankreich, Bd. 1, ?? ?? 1987, S. 278 [Anhang S. ??????]
[5] Vgl. Abbildung 1 (das Staatswappen des Königreiches Hannover)
[6] Zit. nach: L.W.Gilbert, Handbuch eines Reisenden, 3????????, ????S. 122
[7] Vgl. Abbildung (Schaubild: Der Aufbau der Gesellschaft in Kurhannover)
[8] die Geheimen Räte waren vom Kurfürst eingesetzte Minister, die mit ihm in Korrespondenz blieben und gemäß seinen Anweisungen regieren sollten
[9] Carl Haase, Obrigkeit, ???? S. 203
[10] Neues Hannoverisches Magazin, Titelblatt in der gebundenen Fassung, 1791, S. 1?????
[11] s. Anhang [S.??]: staatliche Propaganda im NHM
[12] Carl Haase, Obrigkeit und öffentliche Meinung in Kurhannover 1789-1803. In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 39 (1967), S. 205 Anm. 60
[13] G.F. Palm, Ludwig der Sechszehnte. In: Neues Hannoverisches Magazin (1793), S. 364, 367 Vgl.: ähnliche Widersprüche in Texten von Palm (Anhang: S. )
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses HTML-Dokuments?
Dieses HTML-Dokument enthält den Text einer Facharbeit, die sich mit dem Bild Ludwig des Sechszehnten (L. XVI) in der zeitgenössischen norddeutschen Publizistik beschäftigt, insbesondere im Neuen Hannoverschen Magazin (NHM). Es analysiert, wie L. XVI dargestellt wurde und welche Gründe es für mögliche Abweichungen von einer objektiven Betrachtungsweise gab.
Was ist das Neue Hannoversche Magazin (NHM)?
Das Neue Hannoversche Magazin war eine Wochenschrift, die ab 1791 unter staatlicher Verwaltung in Kurhannover herausgegeben wurde. Es enthielt "gelehrte Beiträge" und diente als Sprachrohr der höheren Beamtenschaft, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und staatserhaltende Propaganda zu betreiben.
Wer war G.F. Palm und welche Rolle spielte er im NHM?
G.F. Palm war ein Autor, der mehrere Beiträge für das NHM verfasste. Es wird vermutet, dass es sich um den Lizentbediensteten Palm in Hannover handelte. Seine Artikel behandelten unter anderem das Bild von Ludwig dem Sechszehnten und Maria Antoinette, wobei er sich auf verschiedene Quellen stützte.
Welche Thesen werden in der Facharbeit aufgestellt?
Die zentrale These der Facharbeit ist, dass in frankreichnahen Staaten, zu denen auch Kurhannover gehörte, gezielt versucht wurde, breiten Bevölkerungsschichten ein negatives Bild der Französischen Revolution zu vermitteln, insbesondere durch die Steuerung der Medien. Das NHM wurde demnach genutzt, um ein bestimmtes Bild von L. XVI zu zeichnen und Revolutionsbegeisterung zu mildern.
Welche historischen Hintergründe werden beleuchtet?
Die Facharbeit geht auf die politische und wirtschaftliche Situation des Kurfürstentums Hannover zur Zeit der Französischen Revolution ein, einschließlich der Armut, der Ständegesellschaft und der Personalunion mit England. Sie beschreibt, wie diese Faktoren die Reaktion auf die Revolution beeinflussten.
Welche Rolle spielte die Zensur in Kurhannover?
Die Zensur spielte eine wichtige Rolle bei der Steuerung der öffentlichen Meinung in Kurhannover. Revolutionsfreundliche Zeitschriften und Zeitungen wurden verboten, und die staatlich kontrollierten Medien, wie das NHM, wurden genutzt, um das bestehende Regierungssystem zu festigen und die Macht des Kurfürsten zu sichern.
Welchen Zweck verfolgte die Darstellung von Ludwig dem Sechszehnten im NHM?
Die Darstellung von Ludwig dem Sechszehnten im NHM zielte darauf ab, ein positives Bild des absolutistischen Herrschers zu vermitteln und die negativen Aspekte der Französischen Revolution hervorzuheben. Dies diente dazu, die Loyalität der Bevölkerung zum Kurfürsten zu stärken und revolutionäre Ideen abzuwehren.
Welche Abbildungen sind im Anhang enthalten?
Der Anhang enthält Abbildungen wie das Staatswappen des Königreichs Hannover, Porträts von Ludwig dem Sechszehnten und Georg III., Ansichten von Hannover Herrenhausen und ein Emblem der Französischen Revolution.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Facharbeit kommt zu dem Schluss, dass die Beeinflussung breiter Gesellschaftsschichten durch die Publizistik nicht nur zu Zeiten der Französischen Revolution ein beliebtes Mittel war. Sie betont die Notwendigkeit, Medieninhalte kritisch zu hinterfragen und objektiv zu entscheiden, um sich nicht von ungewollter Beeinflussung leiten zu lassen.
- Quote paper
- Collin Pein (Author), 1999, Das Bild Ludwig des Sechzehnten in der zeitgenössischen norddeutschen Publizistik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97634