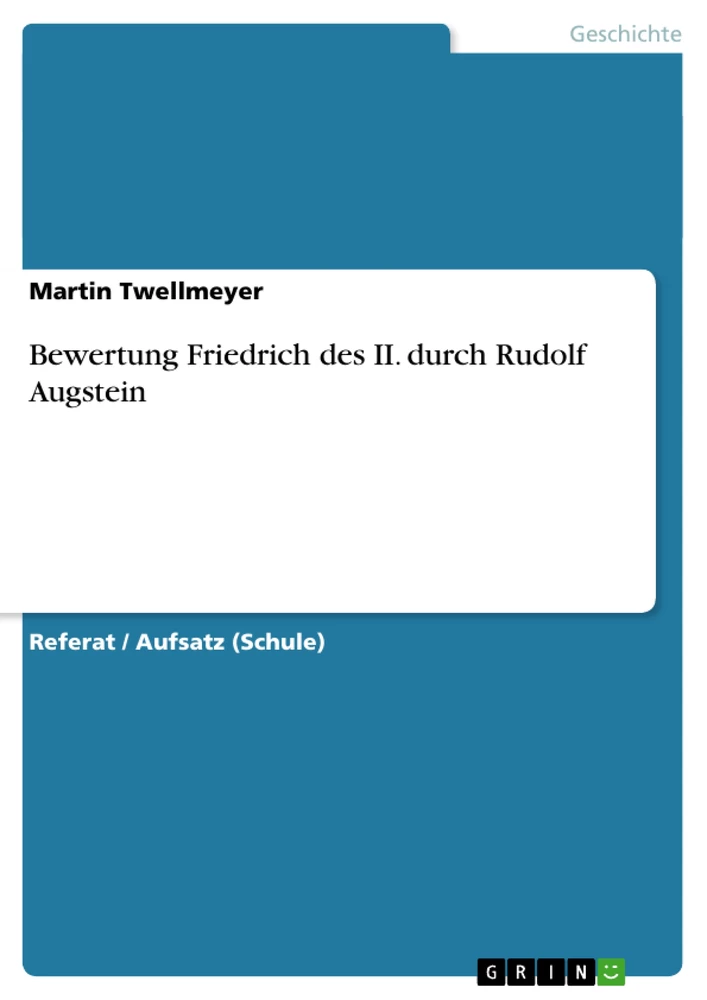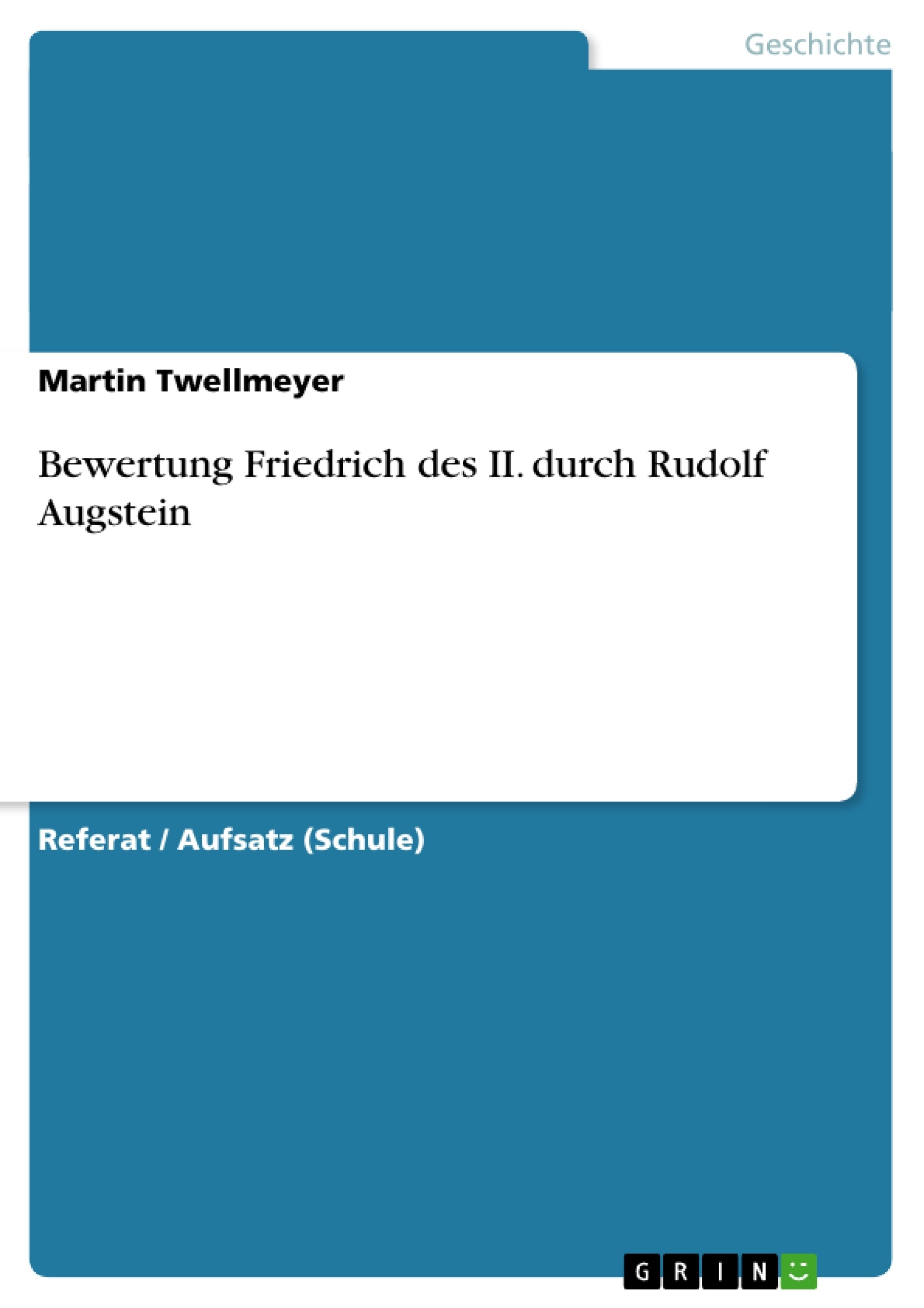Geschichtsreferat zu Friedrich II. anhand des Buches ,,Preußens Friedrich und die Deutschen" von Rudolf Augstein
- Dieses Buch wurde 1968 herausgegeben. Rudolf Augstein wurde 1923 in Hannover geboren und ist vor allem bekannt als der Herausgeber des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, der er seit 1947 ist.
Schon anhand der einzelnen Kapitelüberschriften wird die grundsätzlich kritische Haltung Augsteins gegenüber Friedrich dem Gro ß en sichtbar, wie z.B. `Der unaufgeklärte Staat' und `Der böse Friedrich'. Auch wenn einige Historiker, wie Paul Pfizer und Ranke, meinten, dass Friedrich der Schöpfer des preußischen und des deutschen "Volksgefühls" gewesen sei, versucht Augstein klarzustellen, dass Friedrich, nichts mit ,,dem deutschen Gott von 1914/18 sowie der Vorsehung des Adolf Hitler" zutun gehabt habe. Er will auch nichts von irgendeiner anderen Art von ,,Vorsehung" bezüglich des geplanten Wiederaufbaus des Deutschen Reiches durch Friedrich wissen, wie es z.B. Treitschke tut. Denn auch Friedrich meinte schon vor seinem Tod, dass er zwar an eine Wiedervereinigung des Deutschen Reiches glaube, diese jedoch, durch das zur damaligen Zeit noch mächtigere Österreich, zustande kommen werde. Augstein versucht sich weiter von den Friedrich verherrlichenden und in allen Situationen und Aktionen unterstützenden Historikern wie Treitschke, Schlosser und Droysen zu entfernen. Treitschke hatte nämlich unter anderem behauptet, dass Friedrich schon als Jüngling die Schwäche des heiligen Reiches verdammt hatte, weil dieses Lothringen an Frankreich übergeben habe. 1752 hatte Friedrich jedoch das Fazit gezogen, dass Schlesien und Lothringen zwei Schwestern seien von denen die eine Preußen, die andere Frankreich geheiratet habe, und, da er in derselben Aussage die Bündnispolitik mit Frankreich weiterführen möchte, wiederspricht dies der Ausführung Treitschkes ja eindeutig. Anhand von weiteren Beispielen und Beweisen versucht Augstein weitere vorschnelle oder auch falsche Aussagen verschiedener Historiker zu wiederlegen.
Vor allem betont wird das wahnsinnige Glück, welches Friedrich während aller seiner Kriege und vor allem des Siebenjährigen Krieges gehabt habe, als sich z.B. Österreich und Russland als stärker und Frankreicher sich als stetiger erwiesen hätten, als von den meisten erwartet. Ferner merkt Augstein an wie verwunderlich es sei, mit was für einer spärlichen und dürftigen Staatsphilosophie Friedrich ausgekommen sei, obwohl er doch als Kronprinz in seinem Antimachiavell über solch ein großes Repertoire verfügt habe und diesem mit der wirklich bestehenden Politik jetzt auch noch direkt wiederspreche. Als König hatte er nur zwei Grundgedanken, und zwar erstens, dass das vordergründige Handeln eines Herrschers, gleichgültig, wie groß sein Herrschaftsgebiet sein möge, immer durch den Expansionsgedanken bestimmt sein müsse, und zweitens, dass ein Herrscher insbesondere für das Glück und Wohl der Gesellschaft zu arbeiten habe, an dessen Körper er ein Glied sei. Immer wieder betonte Friedrich, dass ein König zu sparen habe und er genauso viel Geld für sich selbst, wie für sein Land ausgeben solle, doch auch daran hielt er sich nicht, denn im Vergleich zur Armut Preußens, vor allem nach den großen Kriegen, gab er eine Menge Geld für neue Bauten, insbesondere für Sanssouci und für das ,,Neue Palais" aus.
Doch war Friedrich überhaupt als König geboren worden? Als Philosoph und Musiker fühlte er sich viel wohler und als Kronprinz ging er diesen Tätigkeiten ja auch eifrig nach, doch warum stürzte er sich dann nach Besteigung des Throns so in die Arbeit? War Friedrich nur ein Schauspieler, der wahnsinnig gefallsüchtig war? Augstein behauptet es. Es schien so als habe Friedrich von Anfang an mit dem Publikum kokettiert und sei mit diesem gewachsen. Als Dreißigjähriger sei Friedrich noch voll Feuer, Sinn und Enthusiasmus gewesen. Später verlor Friedrich diese Eigenschaften, welche das europäische Staatensystem, zu Beginn von Friedrichs Amtsperiode, so heftig erschüttert hatten. Häufig beklagte sich Friedrich, dass ihm die Zeit davon laufe, doch selbst während der Beschwerlichkeiten des Siebenjährigen Krieges, dichtete und philosophierte Friedrich mehrere Stunden täglich. Es ist wohl zu vermuten, dass der Philosoph Friedrich nicht sehr viel Beachtung gefunden hätte, wäre er zur selben Zeit nicht auch der König Friedrich gewesen wäre. Friedrich selbst sagte häufig, dass seine Verse nicht überragend seien, doch er wollte wohl entweder einen Wiederspruch seiner Kritiker hören, dass seine Gedichte doch gar nicht so schlecht seien, oder er wollte der Kritik ebendieser an seinen Werken vorbeugen. Es war nicht so, dass Friedrich der erste Mensch auf einem Königsthron war, der in der Lage gewesen wäre zu denken und seine Gedanken in Gedichten und anderen philosophischen Werken auszudrücken, aber für Fürsten schickte es sich einfach zu dieser Zeit nicht, etwas wie dieses zu tun. Ferner hatte das Wort ,,Philosoph", damals noch nicht dieselbe Bedeutung wie heute. So wollte auch Friedrichs Vater manchmal ein philosophisches Leben führen, was genauso viel hieß, wie einfach nicht zu handeln, ein kontemplativer (besinnlicher) Betrachter der Dinge und ein Liebhaber der Wissenschaften zu sein. In seiner eigenen Sprache, dem Deutschen, wurde Friedrich, wie es scheint, häufig unterschätzt, denn auch im Deutschen gibt es einige von Friedrich verfasste Gedichte und, dass er so wenig auf Deutsch las, lag nicht daran, dass er es nicht beherrschte, sondern dass er sich der eigenen ursprünglichen Sprache gegenüber einfach abgeneigt und uninteressiert verhielt. Auch wenn Friedrich wenig Deutsch sprach, kann man ihm dieses nicht wirklich anlasten, da es zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich war, dass ein Adliger in der französischen Sprache bewanderter war, als in seiner eigenen. Was man Friedrich jedoch vorwerfen kann, ist, dass er im Lateinischen nicht sehr gebildet war, seinem Kabinett jedoch Vorwürfe machte, wenn dieses richtiges Latein benutzte. Freilich wandte sich Friedrich dem Französischen nie vollständig ab, denn er war sehr geübt in der Sprache und außerdem war er dem französischen Wesen und den Menschen schon immer zugeneigt gewesen, doch er wurde von vielen seiner französischen Freunde enttäuscht und so begann er auch Vorzüge der deutschen Lebensart zu finden, obwohl es nie so weit ging wie beim französischen Wesen.
In Verbindung mit Friedrich, wird zwar häufig die Förderung von Wissenschaften, Museen, Theatern und ähnlichem genannt, doch in wie fern unterstützte er sie wirklich? Zwar sagte Friedrich ,,Berlin solle ein Tempel der großen Männer werden", doch diese großen Männer durften nur Franzosen sein. In der Berliner Akademie z.B. durfte kein Preuße Mitglied werden und nur französisch gedruckt werden. Hervorragende Dichter, wie z.B. Lessing, wurden von Friedrich vollkommen vernachlässigt. Häufig passierte es Friedrich, dass wenn er z.B. einen Bildhauer benötigte er Vater und Sohn oder Vater und Enkel verwechselte (Lambert Sigisbert Adam; Francois Gaspard Adam, Bruder), da er nur auf den französischen Nachnamen achtete. Persönlichkeiten wie Johann Sebastian Bach ignorierte er vollkommen und Goethe sah er als noch billigeren Abklatsch des bereits schlechten Shakespeare. Sein Geschmack für Musik war wohl ein wenig eingeschränkt, denn bis auf Stücke seines Lehrers Quantz und seine eigenen spielte er keine anderen Komponisten. Dennoch wird Friedrich ein besserer Geschmack und mehr Gefühl für die Musik, als für die Literatur nachgesagt. Sein ganzes Leben lang blieb Friedrich beim selben Geschmack und er war nicht einmal bereit, andere Musik zu akzeptieren. Durch seine Ignoranz verpasste er viele berühmte Komponisten seiner Zeit. Auch in Verbindung mit den neu errichteten Gebäuden in Preußen wird Friedrich ein schlechter Geschmack nachgesagt, da diese häufig nicht an die Stelle passten, an der er sie errichten ließ. Augstein hält Friedrich vor, dass seine Kenntnisse von musikalischen und architektonischen Dingen, sowie von deutscher Literatur bis zu seinem Tod auf dem Stand seiner Kronprinzenzeit stehen geblieben wären. Viele Historiker, wie z.B. Richter, behaupten, dass Friedrich erst durch den französischen Geist zu großen Taten inspiriert worden wäre. Zwar war eine der ersten Reformen des Königs Friedrich die Festlegung der Pressefreiheit gewesen, doch wirklich frei war die Presse nie. Schon im Dezember 1740 wurde die Pressefreiheit wieder verschärft. Noch 1772 gestand Friedrich in einem Brief, dass er fast überzeugt sei, ,,dass abhaltende Zwangsmittel erforderlich sind, weil die Freiheit stets missbraucht wird". Durch die Zensur sei eine schnelle Berichterstattung unmöglich gewesen und es habe in jeder Hinsicht die Aussprache eines eigenen Urteils verhindert. Kein Privatmann sei in der Lage gewesen seine Meinung frei auszusprechen und es habe nur eine öffentliche Meinung gegeben, und das sei die Friedrichs gewesen. Die angeblich fantastische neue Rechtssprechung sieht Augstein, als vollkommen sinnlos an. Zur Zeit der Publikation des neuen Gesetzbuches, war dieses schon fast wieder überholt und konnte z.B. dem später veröffentlichten napoleonischen Recht in nichts standhalten. Es sei ihm mit seiner Justizreform zwar bitter ernst gewesen, doch wie es nach Augsteins Ansicht nicht anders zu erwarten gewesen sei, wäre Friedrich auch in Justizfragen nur ein Dilettant gewesen, der nur an der Oberfläche herumgekratzt habe, ohne dabei Übersicht zu beweisen und tieferes Verständnis für die Materie zu haben. Freilich sei der Justizreformer seiner ersten Regierungshälfte, Cocceji, nicht schlecht gewesen, doch erstens habe er ihn nicht selber eingesetzt sondern bereits vorgefunden, und zweitens habe Friedrich ihm nicht genügend Freiheiten gelassen. Cocceji schaffte es einiges zu erreichen, doch Friedrich versuchte immer wieder einzugreifen, obwohl er, wie sein Biograph Koser weiß, ,,von der Rechtswissenschaft nie mehr als die allgemeinsten Grundbegriffe angeeignet" hatte. Nach Coccejis Tod 1755 stoppte die Justizreform abrupt, denn Friedrich gab sich erst einmal mit diesen ersten Versuchen zufrieden, auch wenn Cocceji nichts wirklich fertiggestellt hatte. Der zweite Reformversuch startete erst 1780 durch den neuen Großkanzler Graf Cramer. Diese Reform wurde jedoch erst nach Friedrichs Tod fertiggestellt.
Friedrich war vermutlich Deist, was hieß, dass er zwar an die Existenz eines Gottes und die Schöpfung der Erde durch diesen Gott glaubte, aber er war ein Verächter jeglicher Religion, da er diese aber als wichtig für die Aufrechterhaltung von Ordnung und Gehorsam ansah, tolerierte er sie. Trotz allem meint Augstein, dass es um die Religionsfreiheit zwar besser geschaffen gewesen sei als um die Pressefreiheit, aber nicht so viel besser. Friedrich fand es immer sehr witzig Witze auf Kosten der Kirche und der Religion zu machen. Trotzdem wurde 1743 bei Strafe untersagt, gottlose und ärgerliche Bücher zu drucken.
Während des ganzen Siebenjährigen Krieges spielte Friedrich mit dem Gedanken, Selbstmord zu begehen. Er trug immer eine Dose mit achtzehn Opiumpillen um den Hals und war immer bereit, im äußersten Fall auch eine zu schlucken. In der Armee wurden Selbstmordversuche mit der Höchststrafe belegt, doch das galt selbstverständlich nur für die einfachen Soldaten und nicht für den ,,Großen Friedrich". Schon nach der ersten Niederlage im Siebenjährigen Krieg bei Kolin spielte er mit dem Gedanken, sich umzubringen, da er einfach an Niederlagen nicht gewöhnt war und den Untergang des preußischen Reiches nicht miterleben wollte. Friedrich ging immer bis zum äußersten und selbst gegen doppelte Übermächte zog er noch in die Schlacht. Bei einem Untergang hätte er aber nicht dabei sein wollen. Friedrichs Armee war im Vergleich zur Größe Preußens immer übermäßig groß. Doch wie schaffte er es so viele Rekruten aus seinem Land zu pressen? Friedrich benutzte zur Rekrutierung seiner Armee immer noch Methoden, die in den anderen Ländern Europas schon im 17. Jahrhundert abgeschafft worden waren. Er ließ Bauern und andere Wehrfähige einfach einfangen und sperrte sie häufig ein, bis sie sich nicht mehr wehrten. Teilweise bestand die Hälfte seines Heeres aus ausländischen Söldnern, die er im Ausland entweder angeworben oder einfach hatte einfangen lassen. Während des Siebenjährigen Krieges nahm er ganze Armeen der Gegner, die kapituliert hatten, drehte die Richtung in die sie kämpften einfach um und ließ sie gegen ihr eigenes Vaterland kämpfen. Während des Siebenjährigen Krieges tat er dies mit fast der kompletten Armee der Sachsen und mit Teilen der österreichischen Armee. Doch damit hatte Friedrich häufig auch Probleme. Während des Feldzuges in Böhmen gingen ihm 15000 Mann von der Fahne und bei der Besetzung Breslaus durch die Österreicher 1757 blieb der größte Teil der preußischen Besatzung gleich in Breslau und schloss sich den Österreichern an. Das Gefährlichste für Friedrich überhaupt war also die Desertion, so dass sie folgerichtig auch schwer bestraft wurde. Die gewöhnliche Strafe für Desertion war der Spießrutenlauf und es war nicht ungewöhnlich wenn dabei jemand starb. Eine berühmte Beschreibung des Spießrutenlauf ist der Bericht des Schweizers Ulrich Braeker in seiner Lebensgeschichte ,,Der arme Mann im Tockenburg": ,,Da mussten wir zusehen, wie man sie durch zweihundert Mann achtmal die lange Gasse auf und ab Spießruten laufen ließ, bis sie atemlos hinsanken, wie sie des folgenden Tages aufs neu dran mussten, die Kleider vom zerhackten Rücken heruntergerissen, und wie wieder frisch drauflosgehauen wurde, bis Fetzen geronnenen Bluts ihnen über die Hosen hinabhingen. Dann sahen Schärer (sein Landsmann) und ich uns zitternd und todblass an und flüsterten einander in die Ohren: `Die verdammten Barbaren'". Augstein vergleicht die Art und Weise, auf welche Friedrich das Heer disziplinierte, sogar als Vorbildung von Konzentrationslagern unter Hitler. Um der Desertion aber von vorneherein vorzubeugen, durfte im Krieg keine Einheit in der Nähe großer Wälder lagern. Wollte man durch einen Wald marschieren, mussten Kavallerie-Patrouillen neben der Infanterie herreiten. Zum Holz- und Wasserholen durfte die Mannschaft nicht allein gehen, sondern mußte von Offizieren geführt werden. Nachts sollen die Zelte revidiert, das Lager muss von Aufpassern umstellt werden. Während des Krieges hatte Friedrich auch immer Probleme, weil er nicht in der Lage war Patrouillen auszuschicken, da diese sonst auf der Stelle desertierten. Augstein gibt zwar zu, dass Preußen nicht das einzige Land Europas gewesen, welches seine Rekruten auf schlimmste Art behandelt habe, denn auch die englische Flotte habe nicht durchweg aus Freiwilligen bestanden, und auch die Desertion sei auf ähnlich grausame Art wie der Spießrutenlauf bestraft worden, doch immerhin hätten die Engländer ihre Flotte größtenteils aus dem Inland rekrutiert. Außerdem kritisiert Augstein insbesondere den großen Verschleiß an Söldnern und Soldaten allgemein. Er bestreitet auch nicht, dass die Soldaten in Russland vor ihren Offizieren mehr Angst hatten, als vor der gegnerischen Armee, doch zu dieser Zeit müsse man Russland noch sehr viel mehr als östliches Land bezeichnen und dürfe es nicht mit den gewöhnlichen europäischen Großmächten vergleichen. Für Friedrich sei die Furcht vor dem Offizier jedoch sehr wichtig gewesen, denn seiner Meinung nach sei ein Soldat nicht in der Lage dreihundert feindlichen Geschützen in die Augen zu blicken, wenn man seinen Offizier nicht fürchte.
Im ganzen Handeln Friedrichs entdeckt Augstein nichts wirklich bemerkenswertes. Friedrich sei als Kriegsherr, als welcher er von seinen Zeitgenossen besonders verehrt wurde, nicht wirklich außergewöhnlich gewesen, er habe vielmehr von dem unglücklichen Händchen der Königin Maria Theresia profitiert, deren Generäle nicht wirklich überragende Kriegsherren gewesen wären. Ebenso kann man nicht sagen, dass Friedrich das Wohl seiner Untertanen in den Vordergrund gestellt habe, was heutzutage auch keiner mehr tut. Noch 1924 hatte der Historiker Friedrich Meinecke behauptet, dass die Erweckung von Vernunft und sittlicher Tüchtigkeit Friedrichs Verdiensten zuzurechnen sei. Diese Vernunft habe er aus einer tiefen und ursprünglichen Empfindung heraus, seinen Untertanen verschaffen wollen. Augstein fragt sich jedoch, welche Belege Meinecke da vor Augen haben möchte. Zwar war Friedrichs Jahrhundert das der Aufklärung, doch für die Ausbildung und die Erziehung seiner Untertanen habe er nicht die geringsten Interessen gehabt. Eine Frage des Geldes sei es bestimmt nicht gewesen, sonst hätte er sich nicht 300 Brillanten besetzte Tabakdosen zugelegt, oder zwei unnötige Schlösser gebaut, er habe vielmehr weder sein Offizierskorps noch sein Bürgertum noch gar die Landbevölkerung aufgeklärt wissen wollen. Friedrich selbst schrieb einmal an seinen Bruder, dass dieses Unternehmen seine Kräfte übersteige, da es seiner Meinung nach in seinem Volk, welches zehn Millionen Menschen umfasste nur ungefähr 1000 gebildete Menschen gegeben habe. Eine neue Ethik der Staatsform führte Friedrich genauso nicht ein und auch alle seine Aussprüche und Eigenschaften, waren bei anderen Herrschern zu diesem Zeitpunkt oder schon früher auch anzutreffen gewesen. Dennoch war er nicht nur wegen seiner berühmten Schlachten, wie z.B. Leuthen bekannt. Das unbestreitbar hervorstehende an der Figur des Friedrich war, dass die einzelnen Gebiete auf denen er sich betätigte, also die Philosophie und die Musik, die Heeresführung, sowie das Herrschen selber zwar jeweils nicht überragend waren, als Verbindung aller zusammen, war diese Kombination jedoch außergewöhnlich. Doch nicht nur diese Kombination, sondern auch der scharfe Kontrast im Leben Friedrichs haben ihn, wenn man nach Augstein geht, berühmt gemacht. Den Antimachiavell hatte er noch vor dem Tod des Vaters an einen Freund geschickt, doch bevor er die Verbesserungsvorschläge beherzigen konnte, war er schon weiter und zwar bei Tod des nächsten Vaters und zwar bei dem von Maria Theresia. Auch Friedrichs Vater habe wohl schon das Handeln seines Sohnes gekannt, denn noch auf dem Sterbebett soll er ihm gesagt haben: ,,Fritz wenn Du der Herr bist, wirst Du sie betrügen, denn Du kannst nicht anders. Du bist von Natur falsch und betrügerisch. Darum betrüge sie beim ersten Mal gründlich." Falls der `Soldatenkönig' dies wirklich gesagt hat, dann hat Friedrich seinen Rat in der Tat gut befolgt. Die Kämpfe der Engländer und des Heiligen Reiches gegen Ludwig XIV. schienen das machiavellistische System der rechtlosen Gewalttaten ein für alle mal überholt zu haben, doch Friedrich holte den überholten Machiavellismus mit seinem Einfall in Schlesien wieder nach Europa zurück. Mit Friedrich sei die deutsche Politik amoralisch geworden und habe alle Hemmungen verloren. Bei Fehlschlägen habe man sich seit dem Tod Friedrichs einfach auf ihn berufen können, wie es während des ersten und zweiten Weltkrieges später ja auch mehrfach geschehen sei. Überhaupt sei Friedrich nur so beliebt geworden, weil er sich im rationalen Zeitalter so zweckvoll, vielleicht auch schrecklich zweckvoll, benommen habe. Dennoch sei Friedrich einer der natürlichsten Menschen seiner Zeit gewesen, auch wenn er sich immer verstellt habe, habe man nämlich immer all seine Handlungen aus seinen persönlichen Zwecken, Wünschen und Ambitionen ableiten können. Friedrich sei sehr kaltherzig gewesen. Nachdem er den Thron bestiegen hatte sah er seine Frau noch zwei- dreimal im Jahr und seinen Bruder soll er regelrecht in den Tod getrieben haben. Auch an seine Untertanen soll er nicht viel gedacht haben. Obwohl er einmal gesagt hatte, dass die Untertanen es nicht merken sollten, wenn im eigenen Land Krieg geführt werde, presste er das Volk vor allem während des Siebenjährigen Krieges aus, um immer mehr Geld zu bekommen. Das Geld war Friedrich immer sehr wichtig, schließlich konnte man ohne Geld keinen Krieg führen und so reduzierte er den Gehalt der wirklich wertvollen Stoffe in den Münzen ohne Skrupel und Angst vor Inflation. Auf diese Weise schädigte er selbstverständlich auch das Volk denn das Geld verlor mit dem Wert 1:3.
Gerhard Ritter, ein typischer Friedrich Historiker, schrieb 1954 in seiner Friedrich Studie, Friedrich habe die politische Tradition der absoluten Monarchie bis zu letzter rationaler Konsequenz fortgebildet und gesteigert, er habe die Monarchie vergeistigt, habe sie über den naiven Machtgenuss hinausgehoben und habe bereits über die innere Entwicklung des Absolutismus hinausgewiesen; auf ein ,,letztes Höchstmass" sei die Leistungsfähigkeit der Technischen Mittel in der friderizianischen Staatsverwaltung gesteigert worden; sein Staatssystem sei von ,,unvergleichlicher Folgerichtigkeit" gewesen, alle Teile hätten genau ineinander gepasst, der Plan sei streng durchdacht gewesen. Doch warum hagelt es hier Superlativen? Die Frage stellt sich Augstein. Wo man doch viel einfacher, ohne Superlativen, hätte sagen können, dass der König sich um alles selber gekümmert habe, er für besseren Rat unzugänglich gewesen ist, oder auch, dass er ein Autokrat ein Selbstherrscher aller Preußen gewesen ist. Wo habe denn die Effektivität dieses Systems gelegen? Sein ganzes Leben lang hatte sich Friedrich um das Wohl seiner Armee gekümmert, und bei seinem Tod war sie in einer sehr viel schlechteren Verfassung, als bei seiner Übernahme 1740. Hat Friedrich zu lange regiert? Zwar kann man als König sein Abtrittsdatum nicht ändern, doch hätte er sich nicht früher zurückziehen können? Auch die Effektivität seines Systems muss man wohl in Frage stellen, da es nicht sehr lange hielt. Wie wackelig es wahr, zeigte später Napoleon. Viele Historiker nennen den Ausbau von Kanälen und Manufakturen und die Urbarmachung von Land eine herausragende Leistung Friedrichs, doch Augstein merkt an, dass zu dieser Zeit keine despotische Regierung es versäumt hätte das Land vorwärts zu bringen. Auch alle anderen Reformen, wie die Kolonisten-Politik seien nicht sehr herausragend gewesen, da er es alles nur mit dem Hintergedanken des Krieges, tat. Die wohl entscheidenste Frage, die sich Augstein stellt, ist wohl, was passiert wäre, hätte Friedrich, entweder den Krieg gegen Österreich nicht angefangen, oder wäre er nicht der erstgeborene Sohn gewesen und hätte anstelle dessen ein ruhiges Philosophenleben geführt. Hätte es ohne Friedrichs Handeln kein Bismarck Reich gegeben? Was wäre aus dem ersten und dem zweiten Weltkrieg geworden? Ludwig Reiners schrieb 1952, dass ohne Friedrichs Preußen die Mitte Europas machtpolitisch leer geblieben und Europa gegen Asien nicht geschützt worden wäre. Augstein meint, dass das was bei Reiners Asien heiße, jetzt in Königsberg sitze, wo das preußische Königtum seinen Ursprung habe. Eben dieses `Asien' habe Schlesien abgetrennt und es für Deutschland und Österreich entgültig verloren. Preußen selbst sei, wie Kaunitz 1755 nur habe träumen können: ,, ecrasieret" (ausgerottet). Zwar triumphieren Historiker wie Treitschke, dass eine protestantische Macht dem Heiligen Reich den Gnadenstoß gegeben, dass eine protestantische Macht die Weltmeere und die Kolonien den angelsächsischen Protestanten freigekämpft habe. Doch war es nicht auch Friedrich, der mithalf, dass protestantische Kaiser-Reich zu erwürgen? Hatte er nicht Landstriche wie das Elsass, Lothringen und Belgien dem Reich entfremdet, um die es vor und nach dem ersten Weltkrieg solche Auseinandersetzungen gab?
Häufig gestellte Fragen zum Geschichtsreferat zu Friedrich II. anhand des Buches ,,Preußens Friedrich und die Deutschen" von Rudolf Augstein
Wer war Rudolf Augstein und wann wurde sein Buch veröffentlicht?
Rudolf Augstein war ein 1923 in Hannover geborener Journalist, vor allem bekannt als Herausgeber des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Sein Buch ,,Preußens Friedrich und die Deutschen" wurde 1968 herausgegeben.
Welche kritische Haltung nimmt Augstein gegenüber Friedrich II. ein?
Augstein kritisiert Friedrich II. in seinem Buch und stellt dessen Rolle als Schöpfer des deutschen "Volksgefühls" in Frage. Er distanziert sich von Historikern, die Friedrich verherrlichen und versucht, falsche Aussagen zu widerlegen. Kapitelüberschriften wie `Der unaufgeklärte Staat' und `Der böse Friedrich' zeigen seine kritische Haltung.
Welche Rolle spielte Glück für Friedrichs Erfolge laut Augstein?
Augstein betont das immense Glück, das Friedrich während seiner Kriege hatte, insbesondere im Siebenjährigen Krieg, wo er sich gegenüber stärkeren Gegnern behaupten konnte.
Welche Kritik übt Augstein an Friedrichs Staatsphilosophie?
Augstein kritisiert die spärliche Staatsphilosophie Friedrichs als König, im Gegensatz zu seinen umfangreichen Schriften als Kronprinz. Er bemängelt, dass Friedrich zwar Sparsamkeit predigte, aber dennoch viel Geld für Bauten ausgab.
War Friedrich ein Schauspieler und Gefallsüchtiger laut Augstein?
Augstein behauptet, Friedrich sei ein Schauspieler gewesen, der mit seinem Publikum kokettierte und an Gefallsucht litt.
Wie stand Friedrich zur deutschen Sprache und Kultur?
Obwohl Friedrich Deutsch sprach, bevorzugte er Französisch und zeigte wenig Interesse an der deutschen Sprache und Kultur. Augstein kritisiert jedoch, dass Friedrich Lateinkenntnisse von seinem Kabinett erwartete, obwohl er selbst darin nicht sehr gebildet war.
Wie unterstützte Friedrich Wissenschaften, Museen und Theater?
Augstein kritisiert Friedrichs Unterstützung für Wissenschaften und Künste als einseitig, da er vor allem französische Künstler förderte und deutsche Größen wie Lessing, Bach und Goethe vernachlässigte.
Wie stand es um die Pressefreiheit unter Friedrich?
Augstein bemängelt, dass die Pressefreiheit unter Friedrich eingeschränkt war und einer Zensur unterlag, die eine freie Meinungsäußerung verhinderte.
Wie beurteilt Augstein Friedrichs Justizreform?
Augstein hält Friedrichs Justizreform für dilettantisch und oberflächlich, da sie nicht zu Ende geführt wurde und dem später veröffentlichten napoleonischen Recht nicht standhalten konnte.
Wie war Friedrichs religiöse Einstellung?
Augstein beschreibt Friedrich als Deisten, der Religion zwar verachtete, sie aber zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Gehorsam tolerierte.
Wie disziplinierte Friedrich seine Armee und welche Kritik wird daran geübt?
Augstein kritisiert Friedrichs brutale Methoden zur Rekrutierung und Disziplinierung seiner Armee, einschließlich des Spießrutenlaufs und der Zwangsrekrutierung. Er vergleicht diese Methoden sogar mit Vorformen von Konzentrationslagern.
War Friedrich ein außergewöhnlicher Kriegsherr laut Augstein?
Augstein argumentiert, dass Friedrichs militärische Erfolge eher dem unglücklichen Händchen seiner Gegner zu verdanken waren als seiner eigenen außergewöhnlichen Fähigkeiten.
Welche Kritik übt Augstein an Friedrichs Einfluss auf die deutsche Geschichte?
Augstein kritisiert, dass Friedrichs Handeln die deutsche Politik amoralisch gemacht habe und dass man sich bei Fehlschlägen seitdem auf ihn berufen konnte, wie es während der Weltkriege geschah. Er stellt die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen Friedrich, Bismarck und Hitler besteht, und warnt vor einer unkritischen Verherrlichung Friedrichs.
Wie beurteilt Augstein Friedrichs wirtschaftliche Politik?
Augstein räumt zwar ein, dass Friedrich wirtschaftliche Reformen durchführte, kritisiert aber, dass diese oft im Dienste der Kriegführung standen und nicht dem Wohl der Bevölkerung dienten.
Welche entscheidende Frage stellt Augstein bezüglich Friedrichs Rolle in der Geschichte?
Augstein fragt, was passiert wäre, wenn Friedrich entweder den Krieg gegen Österreich nicht angefangen hätte oder ein ruhiges Philosophenleben geführt hätte, und ob es ohne Friedrichs Handeln kein Bismarck-Reich gegeben hätte.
- Quote paper
- Martin Twellmeyer (Author), 2000, Bewertung Friedrich des II. durch Rudolf Augstein, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97586