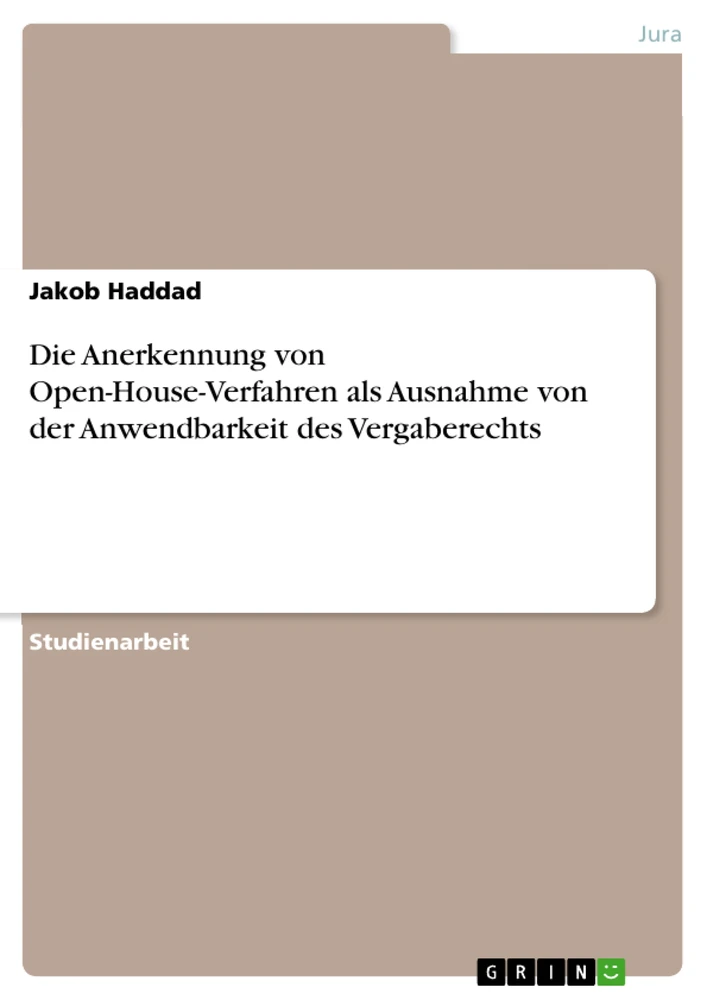Das europäische und deutsche Vergaberecht befinden sich in einer ständigen Ausdehnung, durch die immer mehr Lebensbereiche erfasst werden. Insbesondere mit Vergaben im Bereich der Arzneimittel- und Hilfsmittelbesorgung sind Bereiche betroffen, in denen ein strenges, formales Vergaberegime auf unterschiedliche und somit nicht immer passgenaue Voraussetzungen für eine öffentliche, europaweite Ausschreibung trifft.
Um die vergaberechtlichen Bindungen zu umgehen, werden in der Beschaffungspraxis viele Methoden angewandt; eine davon ist das sogenannte Open-House-Verfahren. Dieses Vertragsmodell hat sich nicht zuletzt im Bereich der Arzneimittelrabattvereinbarungen etabliert, wo heutzutage mehr als jede dritte im Wege eines Open-House-Verfahrens abgeschlossen wird. Eine in einem solchen Verfahren abgeschlossene Arzneimittelrabattvereinbarung war Gegenstand der EuGH-Urteils vom 02.06.2016 in der Rechtssache „Falk Pharma“, in der sich der EuGH erstmals und grundlegend zu Open-House-Verfahren äußerte. Der europäische Gerichtshof hatte sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob eine Auftragsvergabe nach dem Open-House-Modell zwingend dem Europäischen Vergaberecht unterfällt, und, falls dies nicht der Fall sein sollte, welche Anforderungen an ein vergaberechtsfreies Zulassungs-verfahren zu stellen sind.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriffserklärung
- III. Der Sachverhalt im Fall Falk Pharma
- IV. Instanzenzug
- V. 1. Vorlagefrage
- VI. 2. Vorlagefrage
- VII. Fazit zur „Falk Pharma“-Entscheidung
- VIII. Rechtsprechungsentwicklung seit „Falk Pharma“-Entscheidung
- IX. Kritik- und Konfliktpunkte bezüglich Open-House-Verfahren
- X. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Urteil des EuGH vom 02.06.2016 im Fall „Falk Pharma“ und dessen Auswirkungen auf die Anwendung des Vergaberechts bei Open-House-Verfahren. Der Fokus liegt auf der Klärung der Frage, unter welchen Bedingungen Open-House-Verfahren vom Vergaberecht ausgenommen werden können. Die Arbeit untersucht die Rechtsprechungsentwicklung nach dem Urteil und beleuchtet kritische Punkte des Verfahrens.
- Open-House-Verfahren im Arzneimittelbereich
- Ausnahme vom Vergaberecht
- EuGH-Urteil im Fall Falk Pharma
- Rechtsprechungsentwicklung
- Kritikpunkte und Konflikte
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die ständige Ausdehnung des europäischen und deutschen Vergaberechts und die Herausforderungen, die sich daraus insbesondere im Bereich der Arzneimittel- und Hilfsmittelbeschaffung ergeben. Sie führt das Open-House-Verfahren als eine Methode zur Umgehung vergaberechtlicher Bindungen ein und hebt die Bedeutung des EuGH-Urteils im Fall „Falk Pharma“ hervor, welches die Frage nach der Anwendbarkeit des Vergaberechts auf Open-House-Modelle klärt.
II. Begriffserklärung: Dieses Kapitel erklärt das Open-House-Modell und das Wesen von Arzneimittelrabattvereinbarungen nach § 130a Abs. 8 SGB V. Es analysiert die Besonderheiten beider Konzepte und die Berührungspunkte mit den Vorschriften des Vergaberechts, um den Kontext für die spätere Diskussion um die Ausnahme vom Vergaberecht zu schaffen. Die Definitionen legen die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel.
III. Der Sachverhalt im Fall Falk Pharma: (Dieser Abschnitt würde eine detaillierte Zusammenfassung des Sachverhalts im Fall Falk Pharma enthalten. Da der Text den Sachverhalt nur kurz anspricht, kann hier keine ausführliche Zusammenfassung erstellt werden.)
IV. Instanzenzug: (Dieser Abschnitt würde den Instanzenzug im Fall Falk Pharma detailliert beschreiben. Mangels Information im Ausgangstext ist dies hier nicht möglich.)
V. 1. Vorlagefrage: (Dieser Abschnitt würde die erste Vorlagefrage des EuGH im Fall Falk Pharma analysieren. Mangels Information im Ausgangstext ist dies hier nicht möglich.)
VI. 2. Vorlagefrage: (Dieser Abschnitt würde die zweite Vorlagefrage des EuGH im Fall Falk Pharma analysieren. Mangels Information im Ausgangstext ist dies hier nicht möglich.)
VII. Fazit zur „Falk Pharma“-Entscheidung: (Dieser Abschnitt würde das Urteil des EuGH im Fall „Falk Pharma“ zusammenfassen und dessen Bedeutung für die Anwendung des Vergaberechts auf Open-House-Verfahren erläutern. Da der Text das Urteil nur kurz erwähnt, ist eine ausführliche Zusammenfassung hier nicht möglich.)
VIII. Rechtsprechungsentwicklung seit „Falk Pharma“-Entscheidung: (Dieser Abschnitt würde die Rechtsprechungsentwicklung nach dem Urteil im Fall „Falk Pharma“ analysieren. Da keine Informationen darüber im Ausgangstext vorhanden sind, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.)
IX. Kritik- und Konfliktpunkte bezüglich Open-House-Verfahren: (Dieser Abschnitt würde kritische Punkte und Konflikte im Zusammenhang mit Open-House-Verfahren diskutieren. Da der Ausgangstext keine Details dazu liefert, ist eine Zusammenfassung nicht möglich.)
Schlüsselwörter
Open-House-Verfahren, Vergaberecht, Arzneimittelrabattvereinbarung, EuGH-Urteil, Falk Pharma, § 130a Abs. 8 SGB V, öffentlicher Auftrag, Ausschreibung, Rechtsprechungsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des EuGH-Urteils im Fall "Falk Pharma"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Urteil des EuGH vom 02.06.2016 im Fall „Falk Pharma“ und dessen Auswirkungen auf die Anwendung des Vergaberechts bei Open-House-Verfahren. Der Fokus liegt auf der Klärung der Frage, unter welchen Bedingungen Open-House-Verfahren vom Vergaberecht ausgenommen werden können. Die Arbeit untersucht die Rechtsprechungsentwicklung nach dem Urteil und beleuchtet kritische Punkte des Verfahrens.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Open-House-Verfahren im Arzneimittelbereich, Ausnahmen vom Vergaberecht, das EuGH-Urteil im Fall Falk Pharma, die Rechtsprechungsentwicklung nach dem Urteil und kritische Punkte und Konflikte bezüglich Open-House-Verfahren.
Was ist ein Open-House-Verfahren?
Die genaue Definition des Open-House-Modells und seine Besonderheiten werden im Kapitel II "Begriffserklärung" erläutert. Es wird im Kontext von Arzneimittelrabattvereinbarungen nach § 130a Abs. 8 SGB V analysiert und im Hinblick auf Berührungspunkte mit dem Vergaberecht untersucht.
Wie wird das Vergaberecht in Bezug auf Open-House-Verfahren behandelt?
Die Arbeit untersucht, unter welchen Bedingungen Open-House-Verfahren vom Vergaberecht ausgenommen werden können. Dies wird insbesondere im Kontext des EuGH-Urteils im Fall "Falk Pharma" und der darauf folgenden Rechtsprechungsentwicklung analysiert.
Welche Rolle spielt das EuGH-Urteil im Fall "Falk Pharma"?
Das EuGH-Urteil im Fall "Falk Pharma" ist zentraler Bestandteil der Arbeit. Es klärt die Frage nach der Anwendbarkeit des Vergaberechts auf Open-House-Modelle. Die Arbeit analysiert das Urteil selbst (Kapitel VII) und die darauf folgende Rechtsprechungsentwicklung (Kapitel VIII).
Welche Kritikpunkte und Konflikte werden bezüglich Open-House-Verfahren diskutiert?
Kapitel IX widmet sich den Kritikpunkten und Konflikten im Zusammenhang mit Open-House-Verfahren. Da der Ausgangstext diesbezüglich nur wenig Informationen liefert, kann hier keine detaillierte Zusammenfassung gegeben werden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Open-House-Verfahren, Vergaberecht, Arzneimittelrabattvereinbarung, EuGH-Urteil, Falk Pharma, § 130a Abs. 8 SGB V, öffentlicher Auftrag, Ausschreibung, Rechtsprechungsentwicklung.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel (Kapitel I-IX). Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über die behandelten Themen und deren Ergebnisse. Da der Ausgangstext nur begrenzt Informationen zu einigen Kapiteln enthält, sind die Zusammenfassungen für diese Kapitel entsprechend kurz.
- Quote paper
- Jakob Haddad (Author), 2020, Die Anerkennung von Open-House-Verfahren als Ausnahme von der Anwendbarkeit des Vergaberechts, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/975703